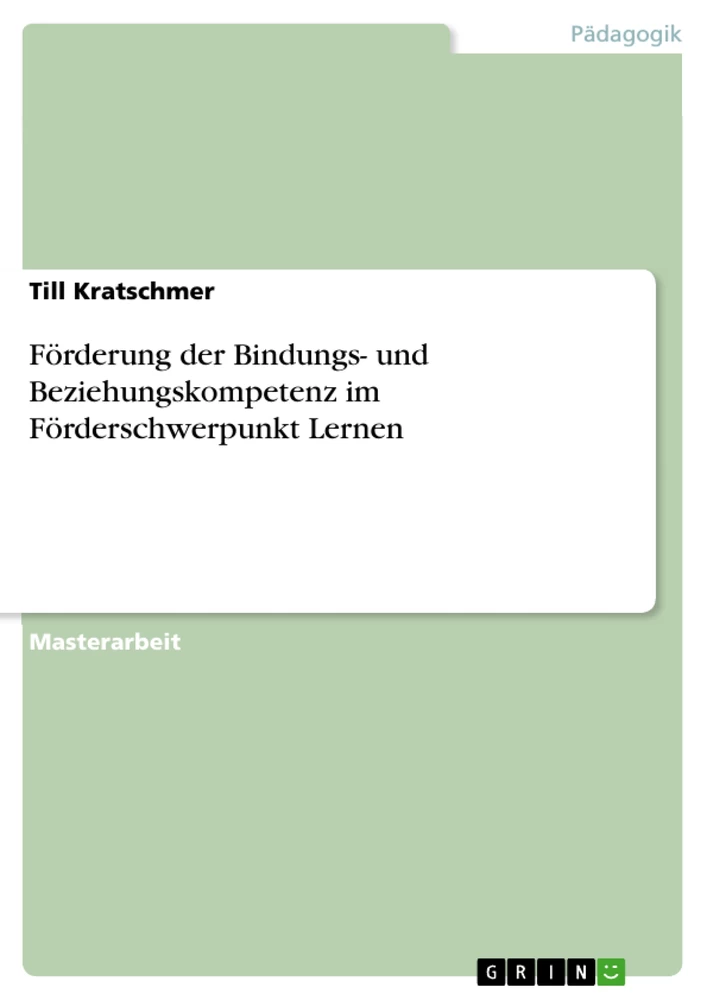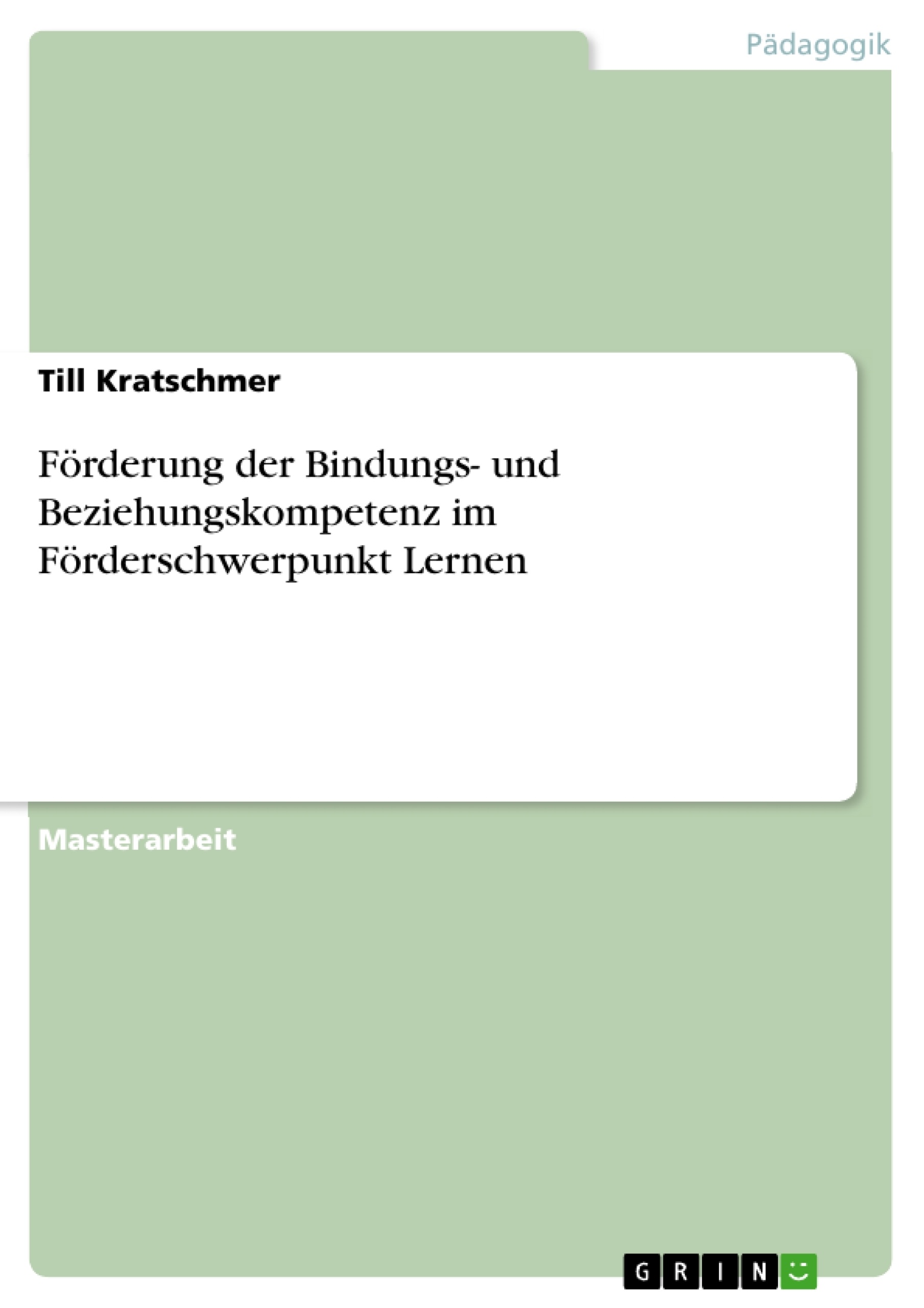Umfangreiche Arbeit über die Bindungstheorie und den Themenkomplex Beziehungen im Kontext von Schule, explizit für die Förderschule.
Anhand von verschiedenen Entwicklungslinien wird aufgezeigt, wie Beziehung wirken kann, welche Felder beachtet werden müssen und welche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit in der Schule gewinnbringende Beziehungserfahrungen möglich sind.
Es existiert kein Lernen ohne Beziehung. Diese Aussage gilt für das Neugeborene, für das Kleinkind, dies gilt ebenso im Kindergartenalter, zur Schulzeit sowie darüber hinaus. Zu keinem Zeitpunkt kann Lernen ohne Interaktion gedacht werden. Der Mensch ist ein soziales Wesen und das zu jedem Zeitpunkt seines Lebens. Die Bedeutung von Beziehung für das menschliche Sein kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Kann kein Lernen ohne Beziehung, ohne Interaktion gedacht werden, muss die Beziehungsarbeit im Kontext der Schule und des Unterrichts, als eines der wichtigsten Arbeitsinstrumente der Pädagogen1 angesehen werden. Hier lässt sich bereits eine erste Bruchstelle erkennen, denn es besteht ein Missverhältnis zwischen der Wertschätzung von Beziehung im pädagogischen Kontext und den konzeptionellen Vorstellungen und Inhalten. Gab und gibt es zwar immer wieder Menschen, die in ihrer
konkreten Arbeit mit Kindern eindrucksvoll den Wert und die Chancen, die in gelingenden Beziehungen liegen, aufzeigen konnten – exemplarisch seien hier nur GORSKI (1978), KORCZAK (1992, 2007), und JEGGE (1994) unter vielen anderen genannt –, fehlt es einer theoretischen Grundlage in Bezug auf Schule und Unterricht, welche die vielfältigen Aspekte, Verknüpfungen und gegenseitigen Beeinflussungen beschreibt, an deren Ende eine gelingende und damit förderliche Beziehung steht und die als
Grundlage der eigenen pädagogischen Arbeit, nicht als Handlungsanweisung verstanden, sondern als Reflexionsgrundlage gedacht, dienen kann. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 THEORETISCHER RAHMEN
- 2.1 DIE BINDUNGSTHEORIE
- 2.1.1 Die Bindungstheorie und ihre Konzepte
- 2.1.1.1 Die Entwicklung der Bindungstheorie
- 2.1.1.2 Grundannahmen der Bindungstheorie
- 2.1.1.3 Das Konzept der Bindung
- 2.1.1.4 Phasen der Entwicklung einer Bindung
- 2.1.1.5 Das Konzept der Feinfühligkeit
- 2.1.1.6 Das Konzept der Bindungsmuster
- 2.1.1.7 Bindungsdesorganisation und Bindungsstörungen
- 2.1.1.8 Konzept der Bindungsrepräsentation
- 2.1.1.9 Bindung und ihre Kontinuität im Verlauf des Lebens
- 2.1.1.10 Psychische Sicherheit als Ergebnis von Bindungserfahrungen
- 2.1.1.11 Bindungen in anderen psychologischen Schulen
- 2.1.2 Bindung im Kontext von Bildung
- 2.1.2.1 Bindung, Verhalten und Lernen
- 2.1.2.2 Bindung im schulischen Kontext
- 2.2 BEZIEHUNG ZWISCHEN KINDERN UND ERWACHSENEN
- 2.2.1 Prozessmodell der Erwachsenen-Kind-Beziehungen
- 2.2.1.1 Merkmale von Individuen in Beziehungen
- 2.2.1.2 Feedbackprozesse
- 2.2.1.3 Externale Einflüsse
- 2.2.2 Beziehungsprozesse und Schule
- 2.2.2.1 Eltern-Kind Beziehungen
- 2.2.2.2 Lehrer-Kind-Beziehung
- 2.2.3 Beziehungsprozesse und Mechanismen
- 2.2.3.1 Beziehungen und emotionale Regulation
- 2.2.3.2 Erwachsenen-Kind-Beziehung und die Entwicklung akademischer Fertigkeiten
- 2.2.4 Empathie und innere Haltung in der Beziehungsgestaltung
- 2.2.5 Wechselseitig bedeutsame Beziehung
- 2.2.6 Lehrer als Funktionsträger
- 2.2.7 Zusammenfassung
- 2.3 GRUNDLAGEN DER RESILIENZFORSCHUNG
- 2.3.1 Begriffsbestimmung
- 2.3.2 Theoretische Verortung des Resilienzkonstruktes
- 2.3.2.1 Resilienz als psychosoziales Konstrukt
- 2.3.2.2 Resilienz als Bewältigung
- 2.3.2.3 Resilienz als Kompetenz
- 2.3.3 Zentrale Konzepte des Resilienzkonstruktes
- 2.3.3.1 Das Risikofaktorenkonzept
- 2.3.3.2 Das Schutzfaktorenkonzept
- 2.3.4 Schule ein Schutz- oder Risikofaktor?
- 2.3.5 Desorganisierte Bindung als Risikofaktor
- 2.3.6 Resilienz als Risikobegriff in der Arbeit mit Schülern aus benachteiligtem Milieu
- 2.4 EXKURS ZUR VERWENDUNG DES KOMPETENZBEGRIFFS
- 2.4.1 Kompetenz als Teil der Handlungsregulation
- 2.4.2 Kompetenz und Erleben
- 3 FÖRDERSCHWERPUNKT LERNEN
- 3.1 DEFINITION
- 3.2 SOZIOKULTURELLE BENACHTEILIGUNG
- 3.3 PSYCHOANALYSE, TIEFENPSYCHOLOGIE UND LERNBEHINDERUNG
- 4 GRUNDSÄTZE DER BINDUNGS- UND BEZIEHUNGSFÖRDERUNG
- 5 FAZIT
- Die Bedeutung der Bindungstheorie für das Verständnis von Lernen und Entwicklung
- Die Rolle von Beziehungsprozessen in der Schule und die Herausforderungen für Kinder mit Lernschwierigkeiten
- Resilienz als Schutzfaktor und die Bedeutung von Bindung und Beziehung für die Entwicklung von Resilienz
- Konzepte der Kompetenzförderung im Kontext von Bindung und Beziehung
- Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrkräften und anderen Akteuren in der Förderung von Bindung und Beziehung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Förderung der Bindungs- und Beziehungskompetenz im Förderschwerpunkt Lernen. Ziel ist es, die Bedeutung von Bindung und Beziehung für das Lernen und die Entwicklung von Kindern mit Lernschwierigkeiten zu beleuchten und konkrete Ansätze zur Förderung dieser Kompetenzen zu entwickeln.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Forschungsfragen der Arbeit darlegt. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit vorgestellt, darunter die Bindungstheorie, die Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen, die Grundlagen der Resilienzforschung und der Kompetenzbegriff. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Förderschwerpunkt Lernen, seiner Definition und den Herausforderungen für Kinder mit Lernschwierigkeiten. Das vierte Kapitel widmet sich den Grundprinzipien der Bindungs- und Beziehungskompetenzförderung. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst und zukünftige Forschungsperspektiven aufzeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Bindung, Beziehung, Lernen, Förderschwerpunkt Lernen, Resilienz, Kompetenz, soziokulturelle Benachteiligung, psychoanalytische Perspektiven auf Lernschwierigkeiten, und die Förderung von Bindungs- und Beziehungskompetenz im schulischen Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Beziehungsarbeit im Förderschwerpunkt Lernen so wichtig?
Lernen kann nicht ohne Interaktion und Beziehung gedacht werden. Besonders in der Förderschule ist die pädagogische Beziehung ein zentrales Arbeitsinstrument für den Lernerfolg.
Welche Rolle spielt die Bindungstheorie in dieser Masterarbeit?
Die Bindungstheorie liefert die theoretische Grundlage, um zu verstehen, wie psychische Sicherheit und Bindungsmuster das Verhalten und die akademischen Fertigkeiten von Schülern beeinflussen.
Was versteht man unter Resilienz im schulischen Kontext?
Resilienz wird als Schutzfaktor betrachtet. Die Arbeit untersucht, wie Schule und tragfähige Lehrer-Kind-Beziehungen dazu beitragen können, die Widerstandsfähigkeit von Kindern aus benachteiligten Milieus zu stärken.
Welche Konzepte zur Bindungsförderung werden thematisiert?
Die Arbeit beleuchtet Konzepte wie Feinfühligkeit, emotionale Regulation und die Förderung von Bindungs- und Beziehungskompetenz als Teil der pädagogischen Handlungsregulation.
Wie werden soziokulturelle Benachteiligungen in der Arbeit berücksichtigt?
Es wird analysiert, wie soziokulturelle Faktoren und desorganisierte Bindung als Risikofaktoren für Lernbehinderungen wirken und welche Förderstrategien hier ansetzen können.
- Citar trabajo
- Till Kratschmer (Autor), 2015, Förderung der Bindungs- und Beziehungskompetenz im Förderschwerpunkt Lernen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342812