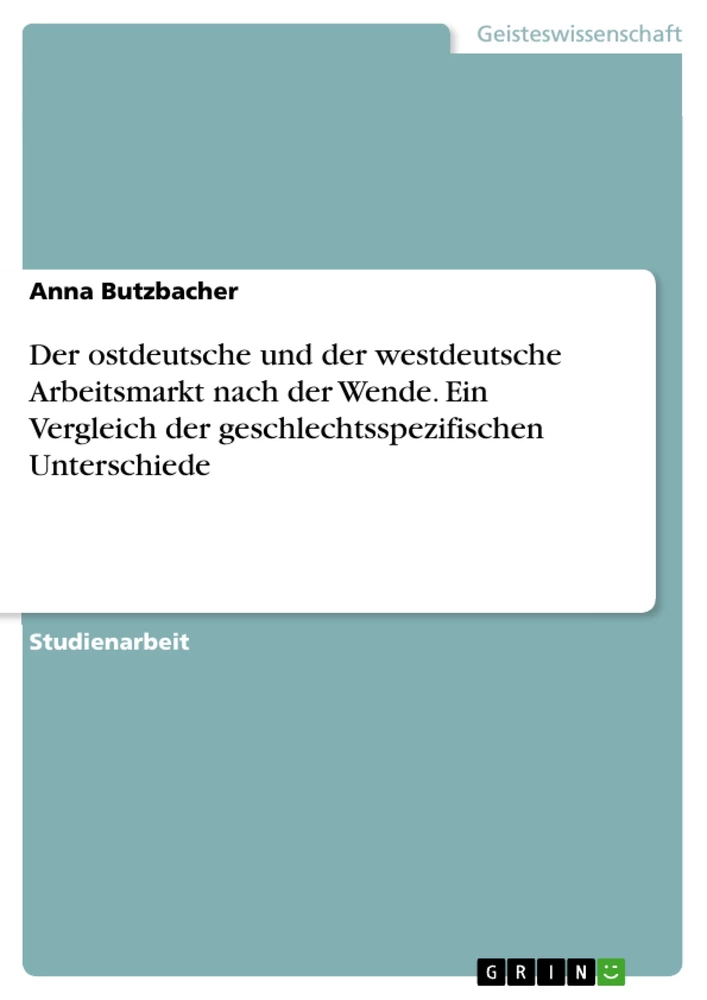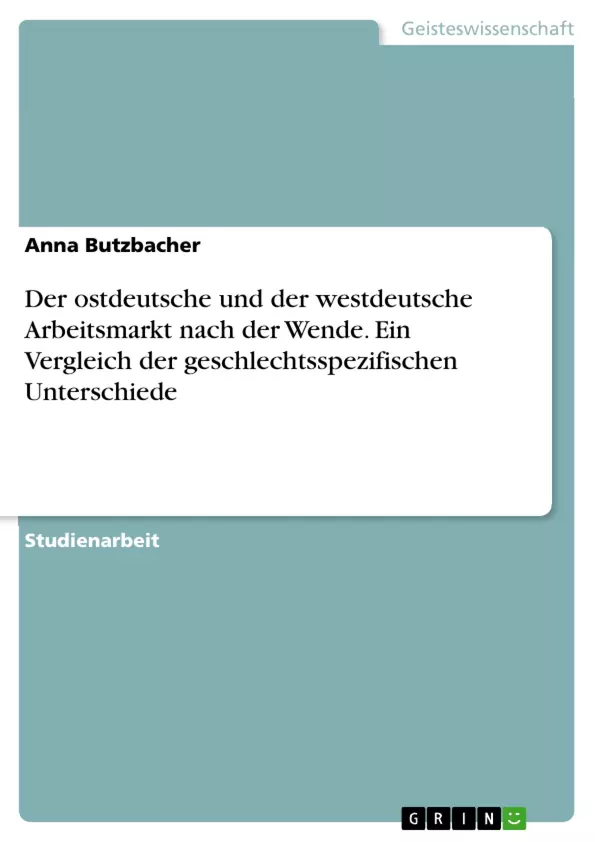„Eine berufstätige Mutter kann ein genauso herzliches Verhältnis zu ihren Kindern finden, wie eine Mutter, die nicht berufstätig ist.“ Dieser Aussage stimmten in einer Umfrage des ALLBUS 1991 nicht mehr als 9% der befragten BRD-Bürger zu, wohingegen rund 18% der teilnehmenden DDR-Mitglieder die Aussage als zutreffend empfanden. Siebzehn Jahre später fallen die Antworten mit 22% im Westen deutlich höher aus als kurz nach der Wende. Im Osten ist das Ergebnis mit 19% Zustimmung nahezu identisch zum Stand von 1991.
Die Meinungen bezüglich der Müttererwerbstätigkeit gingen zu Beginn der Wiedervereinigung beträchtlich auseinander. Interessant wäre zu wissen, welche Differenzen auf Seiten des Arbeitsmarktes noch vorhanden waren beziehungsweise heute noch existieren und vor allem wie diese zu Stande kamen.
Im Folgenden werden die Unterschiede und deren Hintergründe erörtert. Dabei wird zuerst auf die Ursachen der Unterschiede zwischen der ehemaligen DDR und der BRD eingegangen, vor allem in Hinblick auf die politischen und wirtschaftlichen Differenzen und die daraus resultierenden Schwerpunkte auch unter Betrachtung der verschiedenen Familienformen.
Anschließend werden die konkreten Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt nach der Wiedervereinigung erörtert. Zentral hierbei werden Themen wie Ausbildungssituation, Frauenerwerbstätigkeit, Lohndiskrepanzen, atypische Beschäftigungsformen und die Situation älterer Beschäftigter sein. Am Ende findet man eine mögliche Variante der zukünftigen Entwicklungen, sowie das Literaturverzeichnis und die Eidesstattliche Erklärung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- ALLBUS-Umfrage zum Thema Normen und Wertvorstellungen in Ost und West bezüglich erwerbstätigen Müttern
- Gliederung und Schwerpunkte der Arbeit
- Ursachen der Unterschiede zwischen Ost und West auf dem Arbeitsmarkt
- Grundsätze der Planwirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik
- Die Sozialpolitik der DDR nach sowjetischem Vorbild
- Das System der sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland
- BRD - Vorzüge und Grenzen des Sozialstaates
- Familienpolitik und familiäre Strukturen in BRD und DDR
- Differenzen auf dem Arbeitsmarkt nach der Wiedervereinigung
- Entwicklung des Ausbildungsmarktes
- Weibliche Erwerbstätigkeit nach der Wende
- Stand ost- und westdeutscher Frauen auf dem Arbeitsmarkt
- Potential weiblicher Beschäftigter am Arbeitsmarkt
- Lohndiskrepanzen
- Vergleich der Lohnungleichheit von Männern und Frauen in Ost- und Westdeutschland
- Mögliche Ursachen und Einflussfaktoren bezüglich der Lohnungleichheit
- Atypische Beschäftigungsformen
- Situation älterer Arbeitnehmer
- Entwicklung der Beschäftigung Älterer
- Betriebliche Einschätzung der älteren Mitarbeiter im Vergleich zu den jüngeren Angestellten
- Nachfrage nach den älteren Arbeitnehmern
- Betriebliche Bestimmungen zugunsten der Beschäftigungsfähigkeit älterer Angestellte
- Möglichkeiten zur Mehreinstellung potentieller älterer Belegschaftsangehöriger
- Fazit: positive Zukunftsvorhersage für den ostdeutschen Arbeitsmarkt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen dem ost- und westdeutschen Arbeitsmarkt nach der Wende, insbesondere hinsichtlich der geschlechtlichen Unterschiede. Sie analysiert die Ursachen dieser Differenzen, die sich aus den unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Systemen der DDR und der BRD ergeben. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der Wiedervereinigung auf die Ausbildungssituation, die Frauenerwerbstätigkeit, die Lohnungleichheit, die Verbreitung atypischer Beschäftigungsformen und die Situation älterer Beschäftigter beleuchtet.
- Die Auswirkungen der Planwirtschaft in der DDR auf den Arbeitsmarkt
- Die Rolle der Sozialpolitik in der DDR und der BRD im Vergleich
- Die Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit in Ost- und Westdeutschland nach der Wende
- Die Ursachen und Folgen von Lohndiskrepanzen zwischen Ost und West
- Die Bedeutung der Situation älterer Arbeitnehmer im Kontext der Arbeitsmarktentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die unterschiedlichen Meinungen bezüglich der Müttererwerbstätigkeit zu Beginn der Wiedervereinigung und stellt die Gliederung der Arbeit vor. Das zweite Kapitel untersucht die Ursachen der Unterschiede zwischen Ost und West auf dem Arbeitsmarkt, indem es die Grundsätze der Planwirtschaft in der DDR, die Sozialpolitik der DDR nach sowjetischem Vorbild, das System der sozialen Marktwirtschaft in der BRD und die Vorzüge und Grenzen des deutschen Sozialstaates sowie die Familienpolitik und familiäre Strukturen in beiden Ländern vergleicht. Das dritte Kapitel analysiert die Differenzen auf dem Arbeitsmarkt nach der Wiedervereinigung, mit einem Fokus auf die Entwicklung des Ausbildungsmarktes, die weibliche Erwerbstätigkeit, Lohndiskrepanzen, atypische Beschäftigungsformen und die Situation älterer Arbeitnehmer. Das Kapitel schließt mit einem Fazit, das eine positive Zukunftsvorhersage für den ostdeutschen Arbeitsmarkt aufzeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Arbeitsmarkt, Wiedervereinigung, Ostdeutschland, Westdeutschland, geschlechtliche Unterschiede, Frauenerwerbstätigkeit, Lohndiskrepanzen, Ausbildung, atypische Beschäftigungsformen, ältere Arbeitnehmer, Planwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, Sozialpolitik, Familienpolitik.
- Quote paper
- Anna Butzbacher (Author), 2016, Der ostdeutsche und der westdeutsche Arbeitsmarkt nach der Wende. Ein Vergleich der geschlechtsspezifischen Unterschiede, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342875