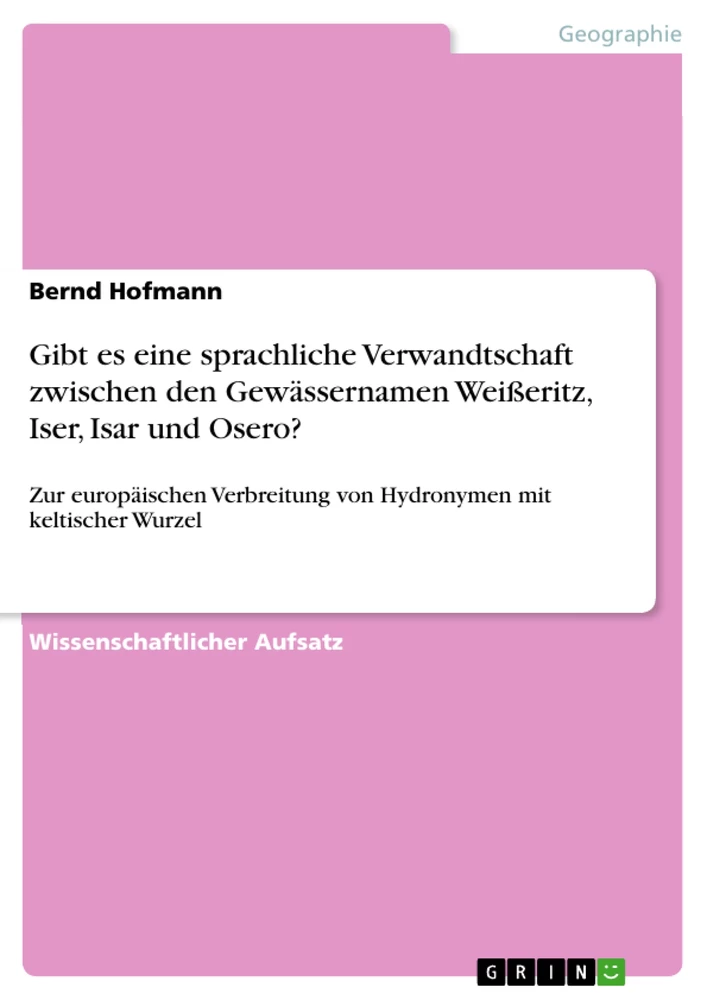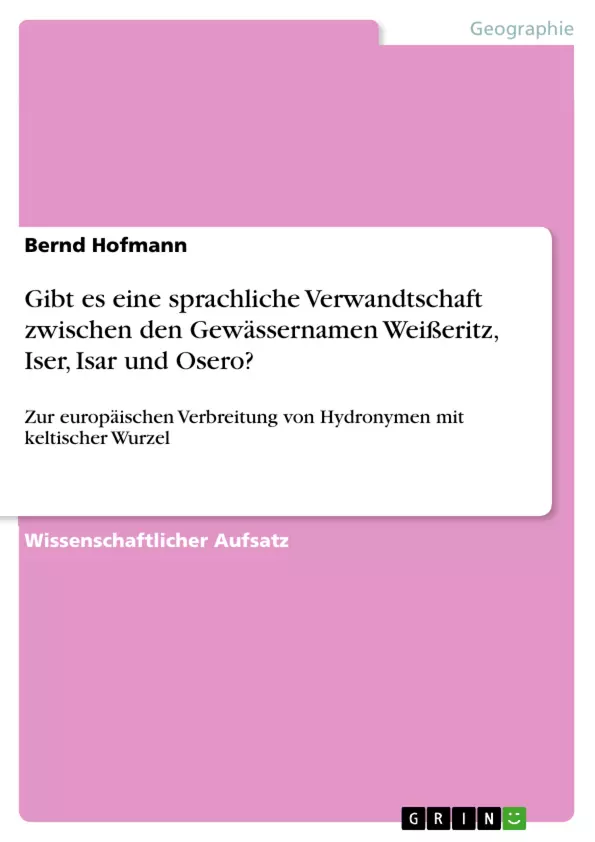Die Arbeit beschäftigt sich mit der Herkunft und Semantik (Wortbedeutung) einiger europäischer Hydronyme (Gewässernamen). Gewässernamen mit der Konsonantenfolge „s-r“ im Wortstamm wie Isar, Iser und Weißeritz für Flüsse sowie esera bzw. osero für Seen finden sich in vielen Teilen Europas. Sie lassen sich mit einiger Wahrscheinlichkeit auf die adjektivische keltische Wurzel isirás in der Bedeutung von wild, schnell, frisch, stark oder reißend zurückführen.
Flüsse mit dieser Namenswurzel zeichnen sich dadurch aus, dass sie in höheren Lagen von Mittel- oder Hochgebirgen entspringen, im Vergleich zu benachbarten Flüssen große bis sehr große Lauflängen und Gefälle sowie besonders große und niederschlagsreiche Einzugsgebiete besitzen. Wie vergleichende Untersuchungen des Autors über die hydrogeographischen Eigenschaften des Osterzgebirgsflusses Weißeritz sowie des Alpenflusses Isar und ihrer Umgebungen zeigten, trifft dies auf beide Flüsse gleichermaßen zu. Auch sind deren Quellgebiete und Oberläufe oft bis in den Nachwinter hinein besonders stark vereist oder mit großen Schneemengen bedeckt. Dies könnte bei Tauwetter häufiger als bei benachbarten Flüssen zu Eisstau und plötzlichem verheerenden Hochwässern geführt haben.
Natürlich sind die slawischen Seen (osero, esera) keine Flüsse. Gleichwohl könnte auch hier das Auftreten unerwarteter wilder und starker Überschwemmungen, wohl meist bei einer Eisschmelze infolge von plötzlichen Temperaturanstiegen, der ursprüngliche Grund für die gleiche sprachliche Wurzel sein.
Inhaltsverzeichnis
- Das Flusssystem der Wilden, Roten und vereinigten Weißeritz
- Der Flussname Weißeritz und seine Verwandten in Europa
- Zur Herkunft und Bedeutung von Gewässernamen mit der Konsonantenfolge „s-r“ im Wortstamm
- Beziehungen zwischen Flüssen mit der Konsonantenfolge „s-r“ im Wortstamm und ihren hydrogeographischen Eigenschaften
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herkunft und Bedeutung europäischer Gewässernamen, insbesondere derer mit der Konsonantenfolge „s-r“ im Wortstamm. Es wird die sprachliche Verwandtschaft verschiedener Fluss- und Seenamen analysiert und in Bezug zu deren hydrogeographischen Eigenschaften gesetzt.
- Sprachliche Analyse von Gewässernamen (Hydronymen) mit dem Konsonantenpaar "s-r".
- Untersuchung der keltischen Wurzel "isirás" und ihrer Bedeutung für die Namensgebung.
- Vergleich der hydrogeographischen Eigenschaften von Flüssen wie Weißeritz und Isar.
- Zusammenhang zwischen hydrogeographischen Merkmalen und der Namensgebung.
- Bedeutung der Konsonantenfolgen für die historische Semantik.
Zusammenfassung der Kapitel
Das Flusssystem der Wilden, Roten und vereinigten Weißeritz: Dieses Kapitel beschreibt das Flusssystem der Weißeritz im Osterzgebirge, beginnend mit den Quellflüssen Wilde und Rote Weißeritz und deren Vereinigung in Freital-Hainsberg. Es beleuchtet die geographischen Gegebenheiten, die Nähe zu Siedlungen und Verkehrswegen, und die Geschichte des Flusslaufs, inklusive der Veränderungen durch Hochwasser und Kanalisierungen, besonders im Dresdner Stadtgebiet. Die Bedeutung der Weißeritz als Verkehrsweg und die Auswirkungen verheerender Hochwasser, wie das von 2002, werden hervorgehoben. Die Beschreibung umfasst die geografische Lage, den Verlauf, und die historische Entwicklung des Flusssystems und seiner Bedeutung für die Region.
Der Flussname Weißeritz und seine Verwandten in Europa: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Analyse des Namens "Weißeritz" und seiner sprachlichen Verwandten in Europa. Die Konsonantenfolge "s-r" im Wortstamm wird als zentraler Punkt herausgestellt, mit Bezug auf altslawische Wurzeln und deren Entwicklung im Laufe der Sprachgeschichte. Der Einfluss slawischer und keltischer Sprachen auf die Namensgebung wird diskutiert, einschließlich der Bedeutung von Prä- und Suffixen. Das Kapitel veranschaulicht den evolutionären Prozess der Namensbildung und die Herausforderungen der sprachlichen Analyse über einen langen Zeitraum.
Zur Herkunft und Bedeutung von Gewässernamen mit der Konsonantenfolge „s-r“ im Wortstamm: Hier wird die umstrittene Herkunft und Bedeutung von Hydronymen wie Iser, Isar und Weißeritz erörtert. Die Diskussion umfasst Theorien zur keltischen Wurzel "ys" oder "isirás" und neuere Forschungen, welche eine ältere indogermanische Herkunft ("es" oder "is") annehmen. Der Unterschied in der Bedeutung von Vokalen und Konsonanten im Laufe der Sprachentwicklung wird detailliert erläutert, wobei die Bedeutung von Konsonantenfolgen für die historische Semantik hervorgehoben wird. Das Kapitel präsentiert verschiedene sprachwissenschaftliche Ansätze und bewertet deren Gültigkeit im Kontext der untersuchten Gewässernamen.
Beziehungen zwischen Flüssen mit der Konsonantenfolge „s-r“ im Wortstamm und ihren hydrogeographischen Eigenschaften: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen der Konsonantenfolge „s-r“ in Gewässernamen und den hydrogeographischen Merkmalen der Flüsse. Es wird die keltische Wurzel "isirás" mit Bedeutungen wie "schnell", "frisch" und "reißend" in Verbindung mit den Eigenschaften von Flüssen mit großen Einzugsgebieten, langen Lauflängen und Gefällen gebracht. Die Weißeritz und die Isar dienen als Beispiele, deren hydrogeographische Daten belegen, dass diese Flüsse zu unvorhersehbaren und verheerenden Hochwassern neigen. Das Kapitel untermauert die These, dass die Namensgebung durch die hydrogeographischen Eigenschaften beeinflusst wurde.
Schlüsselwörter
Weißeritz, Isar, Iser, Osero, Hydronyme, Gewässernamen, Konsonantenfolge „s-r“, keltische Wurzel, isirás, indogermanische Sprache, hydrogeographische Eigenschaften, Hochwasser, Sprachgeschichte, Semantik, Wortbedeutung, Einzugsgebiet, Lauflänge, Gefälle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Das Flusssystem der Wilden, Roten und vereinigten Weißeritz
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Herkunft und Bedeutung von europäischen Gewässernamen, insbesondere derer mit der Konsonantenfolge „s-r“ im Wortstamm, wie beispielsweise Weißeritz, Isar und Iser. Sie analysiert die sprachliche Verwandtschaft dieser Namen und setzt diese in Beziehung zu den hydrogeographischen Eigenschaften der entsprechenden Flüsse.
Welche Flüsse werden im Detail untersucht?
Der Schwerpunkt liegt auf dem Flusssystem der Weißeritz (Wilde, Rote und vereinigte Weißeritz) im Osterzgebirge. Zum Vergleich werden auch die Flüsse Isar und Iser herangezogen.
Welche sprachwissenschaftlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die sprachliche Verwandtschaft der untersuchten Gewässernamen, insbesondere die mögliche keltische Wurzel „isirás“ und ihre Bedeutung. Weiterhin wird die Bedeutung der Konsonantenfolge „s-r“ und der Einfluss slawischer und keltischer Sprachen auf die Namensgebung erörtert. Die Arbeit beleuchtet auch die Herausforderungen der sprachlichen Analyse über einen langen Zeitraum und den Unterschied in der Bedeutung von Vokalen und Konsonanten im Laufe der Sprachentwicklung.
Welche hydrogeographischen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht die hydrogeographischen Eigenschaften der Flüsse, wie Einzugsgebiet, Lauflänge und Gefälle, und deren Zusammenhang mit der Namensgebung. Insbesondere wird der Zusammenhang zwischen der Konsonantenfolge „s-r“ und der Neigung zu Hochwassern bei Flüssen wie Weißeritz und Isar untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Das Flusssystem der Wilden, Roten und vereinigten Weißeritz; Der Flussname Weißeritz und seine Verwandten in Europa; Zur Herkunft und Bedeutung von Gewässernamen mit der Konsonantenfolge „s-r“ im Wortstamm; Beziehungen zwischen Flüssen mit der Konsonantenfolge „s-r“ im Wortstamm und ihren hydrogeographischen Eigenschaften; Resümee.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Weißeritz, Isar, Iser, Osero, Hydronyme, Gewässernamen, Konsonantenfolge „s-r“, keltische Wurzel, isirás, indogermanische Sprache, hydrogeographische Eigenschaften, Hochwasser, Sprachgeschichte, Semantik, Wortbedeutung, Einzugsgebiet, Lauflänge, Gefälle.
Welche Hypothese wird in der Arbeit verfolgt?
Die Arbeit verfolgt die Hypothese, dass die Namensgebung von Flüssen mit der Konsonantenfolge „s-r“ im Wortstamm durch deren hydrogeographische Eigenschaften, insbesondere die Neigung zu Hochwassern, beeinflusst wurde.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine kombinierte sprachwissenschaftliche und hydrogeographische Methode. Sprachwissenschaftliche Analysen werden mit der Untersuchung hydrogeographischer Daten kombiniert, um Zusammenhänge zwischen Namen und Eigenschaften der Flüsse aufzuzeigen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studenten der Sprachwissenschaft, Geographie, und Geschichte, die sich für die Etymologie von Gewässernamen und den Zusammenhang zwischen Sprache und Landschaft interessieren.
Wo finde ich die vollständige Arbeit?
Die vollständige Arbeit ist [hier den Link zur vollständigen Arbeit einfügen].
- Arbeit zitieren
- Bernd Hofmann (Autor:in), 2016, Gibt es eine sprachliche Verwandtschaft zwischen den Gewässernamen Weißeritz, Iser, Isar und Osero?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342890