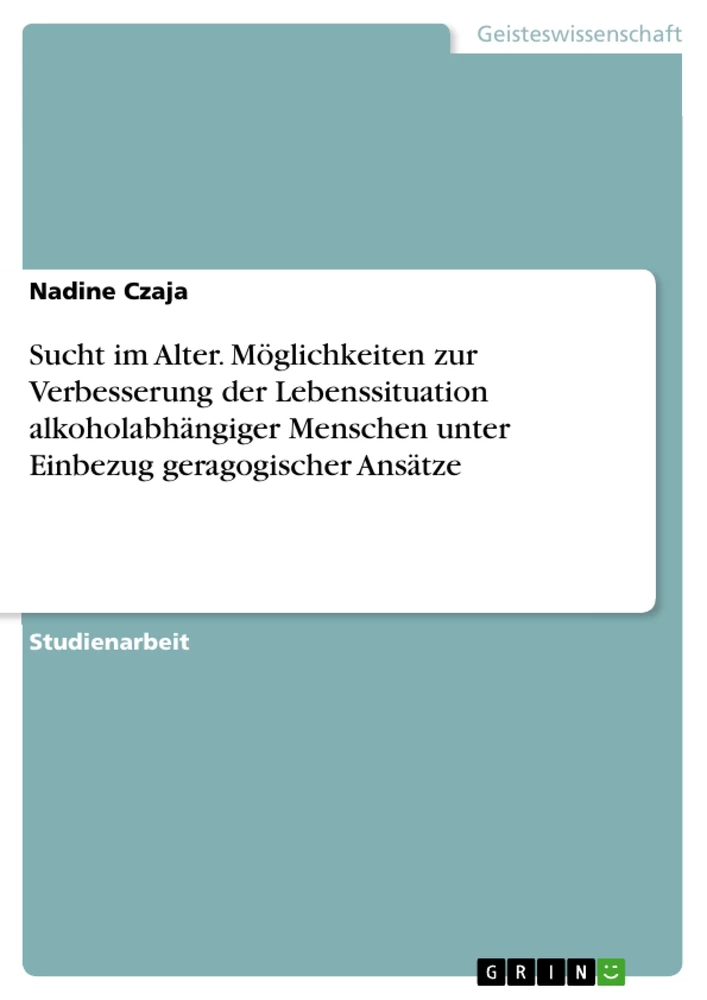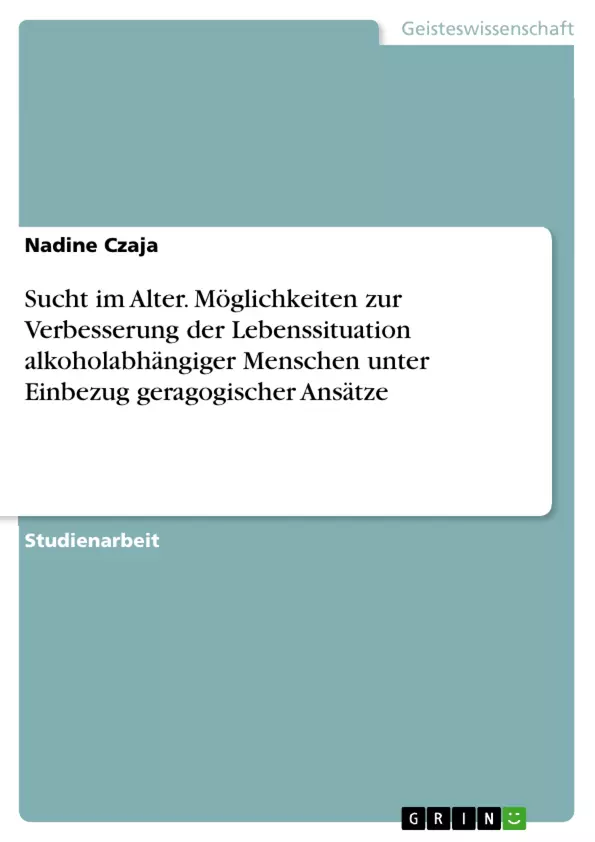Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Sucht bei älteren Menschen als besondere Herausforderung für die Praxis der Geragogik und Sozialen Arbeit in Deutschland. Das Ziel dabei ist es, im Verlauf der Arbeit aufzuzeigen, mit welchen Aufgaben und möglichen Problemlagen suchterkrankte Menschen im Alter besonders konfrontiert sind und wie die Geragogik als professionelle Instanz möglicherweise Unterstützung bieten kann.
Anlass für die Bearbeitung dieses Themas ist die scheinbar flächendeckend fehlende Berücksichtigung des hohen Alters in jeglichen Suchtfragen. So sind gemäß des Drogen- und Suchtberichts 2015 etwa 3,4 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren von Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit betroffen, entsprechende Angaben zur Altersgruppe der über 65-Jährigen hingegen fehlen. Dies spiegelt sich im selbigen Bericht auch in den aufgeführten Schwerpunkten der Drogen- und Suchtpolitik wider: In zahlreichen nationalen und internationalen Präventionsmaßnahmen werden vorwiegend Schwangere sowie Kinder und Jugendliche als Zielgruppe adressiert, gelegentlich finden sich Projekte für Erwachsene. An konkreten Präventionsmaßnahmen für ältere Menschen mit Alkoholerkrankungen mangelt es auch hier.
Vor dem Hintergrund des fortlaufenden demografischen Wandels ist die Vernachlässigung des hohen Alters in der Auseinandersetzung mit dem Thema Sucht erstrecht unverständlich. Bislang fehlen weitestgehend konkrete statistische Angaben zu Alkoholmissbrauch und –abhängigkeit im Alter; die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. schätzt jedoch, dass das Trinkverhalten von etwa einem Drittel der Männer und einem Fünftel der Frauen über 65 Jahren deutlich über einen risikoarmen Konsum hinausgeht. Aus diesen Angaben geht hervor, dass der Konsum von Alkohol für zigtausende ältere Menschen eine Gefährdung der Gesundheit und erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität darstellt, von welcher im Zuge des demografischen Wandels vermutlich in Zukunft noch mehr Menschen höheren Alters betroffen sein werden. Sucht im Alter muss also verstärkt wahrgenommen werden. Dies richtet sich nicht bloß an Drogenpolitik und Suchthilfe, sondern gleichwohl an Angehörige und Betroffene selbst, welche sich zu selten zu ihrer substanzbezogenen Störung bekennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Alter
- Zu den Begriffen „Alter“ und „Altern“
- Epidemiologie und demografischer Wandel
- Lebenssituation älterer Menschen in Deutschland
- Alkohol: Konsum und Abhängigkeit
- Zu den Begriffen „Alkoholkonsum“ und „Abhängigkeit“
- Epidemiologie
- Kurzfristige Effekte des Alkoholkonsums
- Alkoholabhängigkeit im Alter
- Ursachen von Alkoholabhängigkeit im Alter
- Auswirkungen der Abhängigkeit auf ältere Menschen
- Perspektive der Betroffenen
- Perspektive der Angehörigen
- Gegenwärtige Versorgungsstruktur
- Geragogische Zugänge im Umgang mit alkoholabhängigen Menschen im Alter
- Begriff und Grundlagen der Geragogik
- Bildungsangebote für alkoholabhängige Menschen im Alter
- Biografisches Lernen
- Künstlerisch-kulturelle Bildung
- Gesundheitsförderung
- Intergenerationelles Lernen
- Förderung des freiwilligen Engagements
- Bildungsangebote für den Umgang mit alkoholabhängigen Menschen im Alter
- Fort- und Weiterbildungen für Professionelle
- Angehörigenarbeit
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der besonderen Herausforderung der Sucht bei älteren Menschen im Kontext der Geragogik und Sozialen Arbeit in Deutschland. Sie untersucht die spezifischen Aufgaben und Problemlagen, denen suchterkrankte Menschen im Alter begegnen, und erörtert die potenziellen Möglichkeiten der Geragogik als professionelle Instanz zur Unterstützung dieser Gruppe.
- Alkoholabhängigkeit als ein zentrales Problem im Alter
- Ursachen und Auswirkungen von Alkoholabhängigkeit auf ältere Menschen
- Die aktuelle Versorgungsstruktur für alkoholabhängige Menschen im Alter
- Die Rolle der Geragogik in der Unterstützung alkoholabhängiger Menschen im Alter
- Potenzial und Herausforderungen geragogischer Bildungsangebote für alkoholabhängige Menschen und deren Angehörige
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Begriff des Alters und seine Bedeutung im Kontext des demografischen Wandels. Es werden epidemiologische Daten zur Lebenssituation älterer Menschen in Deutschland präsentiert.
Kapitel 2 fokussiert auf den Alkoholkonsum und die Abhängigkeit von Alkohol. Es werden wichtige Begriffe definiert, epidemiologische Daten vorgestellt und die kurzfristigen Effekte des Alkoholkonsums beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich der Alkoholabhängigkeit im Alter. Es werden die Ursachen und Auswirkungen der Abhängigkeit auf ältere Menschen aus der Perspektive der Betroffenen und der Angehörigen beleuchtet. Zudem wird die aktuelle Versorgungsstruktur in Deutschland in den Blick genommen.
Kapitel 4 untersucht die Möglichkeiten der Geragogik im Umgang mit alkoholabhängigen Menschen im Alter. Es werden verschiedene geragogische Bildungsangebote vorgestellt und deren Potenzial zur Unterstützung der Betroffenen und deren Angehörigen analysiert.
Schlüsselwörter
Alkoholabhängigkeit, Alter, Geragogik, Soziale Arbeit, Bildungsangebote, Intergenerationelles Lernen, Gesundheitsförderung, Angehörigenarbeit, Versorgungsstruktur, demografischer Wandel, Suchthilfe.
- Quote paper
- Nadine Czaja (Author), 2016, Sucht im Alter. Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebenssituation alkoholabhängiger Menschen unter Einbezug geragogischer Ansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342962