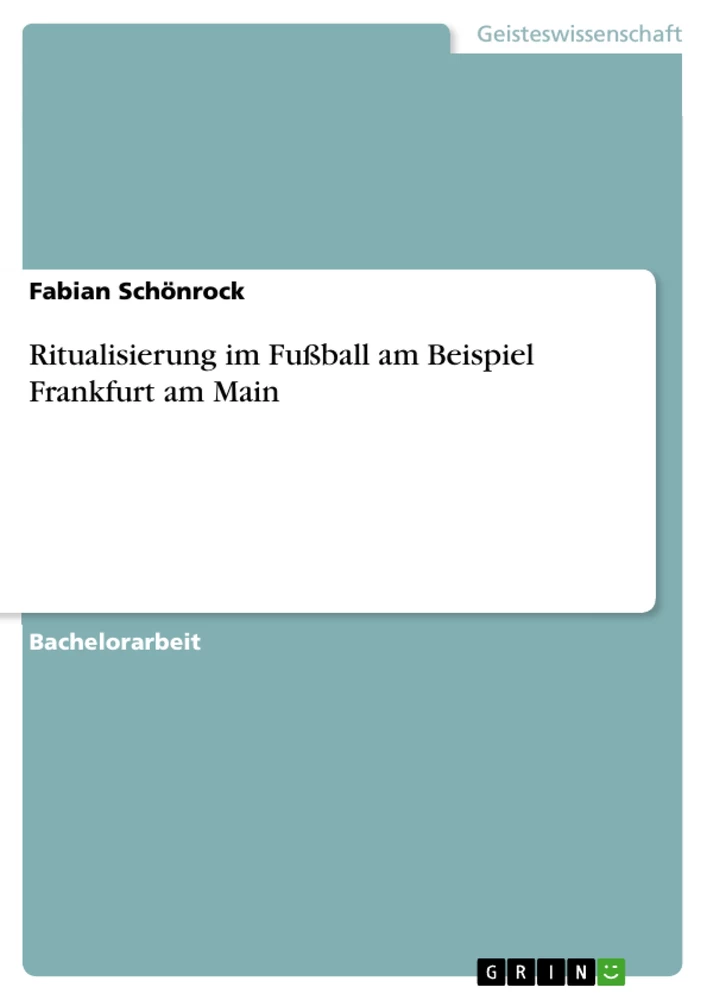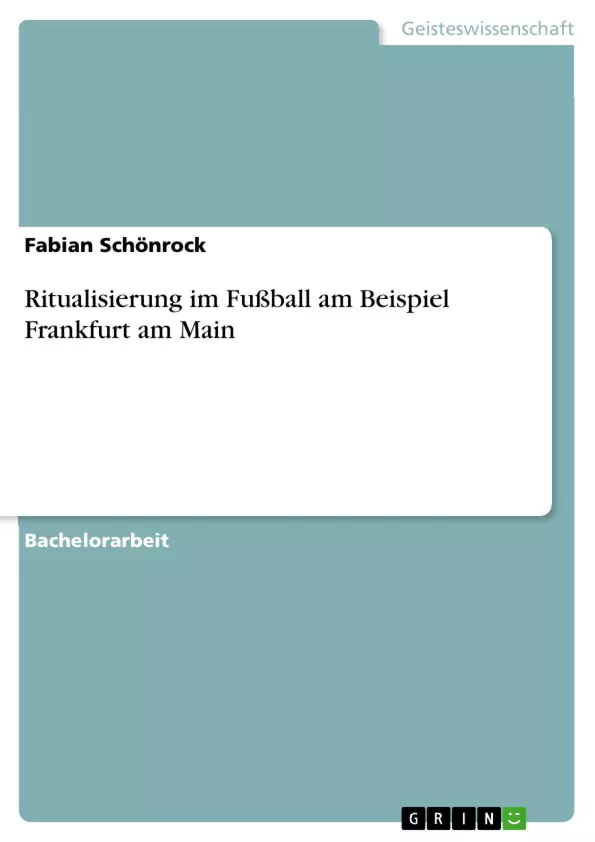Diese Arbeit thematisiert den rituellen Charakter des Volkssports Fußball im Stadion. Analysiert wurde hierbei vornehmlich der Frankfurter Raum, allen voran bei Spielen von Eintracht Frankfurt.
Woche für Woche, Samstag für Samstag pilgern Fußballfans ins Stadion. Der Fußballfan ist fanatisch, geht bei heißen 40 Grad im Sommer und biederen Minusgraden im Winter mit Fanschal und Trikot ins Stadion, um seine Mannschaft zu unterstützen und die Farben seines Vereines zu repräsentieren. Die Sinnfrage stellt sich hierbei für einen echten Fan nicht. Dem Fußballstadion, als heiligem Tempel und Ort des rituellen Geschehens, kommt hierbei eine ganz besondere Funktion zu. Es ist Austragungsort eines Spiels und Zufluchtsort zugleich.
Das Stadion als eine der wenigen noch gesellschaftlichen Schlupflöcher, um aus dem gewohnten Alltagsleben auszubrechen, ist Ort der Verwandlung, der Annäherung und Grenzüberschreitung. Das Stadion, welches Platz für tausende Anhänger bietet, sowie die Protagonisten auf dem Rasen (die Spieler), geben dem Fußballspiel den Charakter einer Theaterinszenierung. Was rund um ein Fußballspiel herum passiert, weshalb es weithin als Ritual der Moderne zu betrachten ist und welche gesellschaftlichen Konsequenzen sowie Chancen es beinhaltet, wird in der Bachelorarbeit ,,Ritualisierung im Fußball am Beispiel Frankfurt am Main'' von Fabian Schönrock erörtert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einführung
- 2. Theorie und Begriff des Rituals
- 2.1 Definition des Begriffes „Ritual“
- 2.2 Theorie der Übergangsriten von Arnold van Gennep
- 2.3 Theorie der Liminalität und Anti-Struktur von Victor Turner
- 3. Charakterisierung des Rituals
- 3.1 Bedeutung und Funktion
- 3.2 Formale Kriterien
- 3.3 Symbolcharakter
- 4. Das Stadion
- 4.1 Aufbau des Stadions
- 4.2 Inneres Geschehen
- 5. Charakterisierung des Fans
- 6. Fußball und Rivalität
- 6.1 Herstellung von Rivalität
- 6.2 Gewalt im Stadion
- 7. Fazit und Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie das Fußballspiel im Stadion zu einem Massenphänomen geworden ist und welche rituellen Handlungen und Vorkommnisse dabei eine Rolle spielen. Dabei wird das Beispiel Frankfurt am Main als Fallstudie untersucht.
- Definition und Bedeutung von Ritualen im Kontext von Fußball
- Analyse des Stadions als Ort des rituellen Geschehens
- Charakterisierung des Fans als Teilnehmer am Ritual
- Bedeutung der Rivalität im Fußball
- Soziale und gesellschaftliche Relevanz des Rituals „Fußball“
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und erläutert die Motivation für die Untersuchung. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen zum Begriff „Ritual“ und die Theorien von Arnold van Gennep und Victor Turner behandelt. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Charakterisierung des Rituals „Fußball“ im Hinblick auf Bedeutung, Funktion und formale Kriterien. Kapitel 4 widmet sich dem Stadion als Ort des rituellen Geschehens und untersucht dessen Aufbau und das innere Geschehen. Kapitel 5 analysiert die Rolle des Fans als Teilnehmer am Ritual, während Kapitel 6 die Bedeutung der Rivalität im Fußball und deren Auswirkungen auf das rituelle Geschehen beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Ritualisierung, Fußball, Stadion, Fan, Rivalität, Übergangsriten, Liminalität, Anti-Struktur, soziale Bedeutung, Massenphänomen, Frankfurt am Main. Die Erkenntnisse von Arnold van Gennep und Victor Turner spielen eine wichtige Rolle.
- Quote paper
- Fabian Schönrock (Author), 2014, Ritualisierung im Fußball am Beispiel Frankfurt am Main, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343096