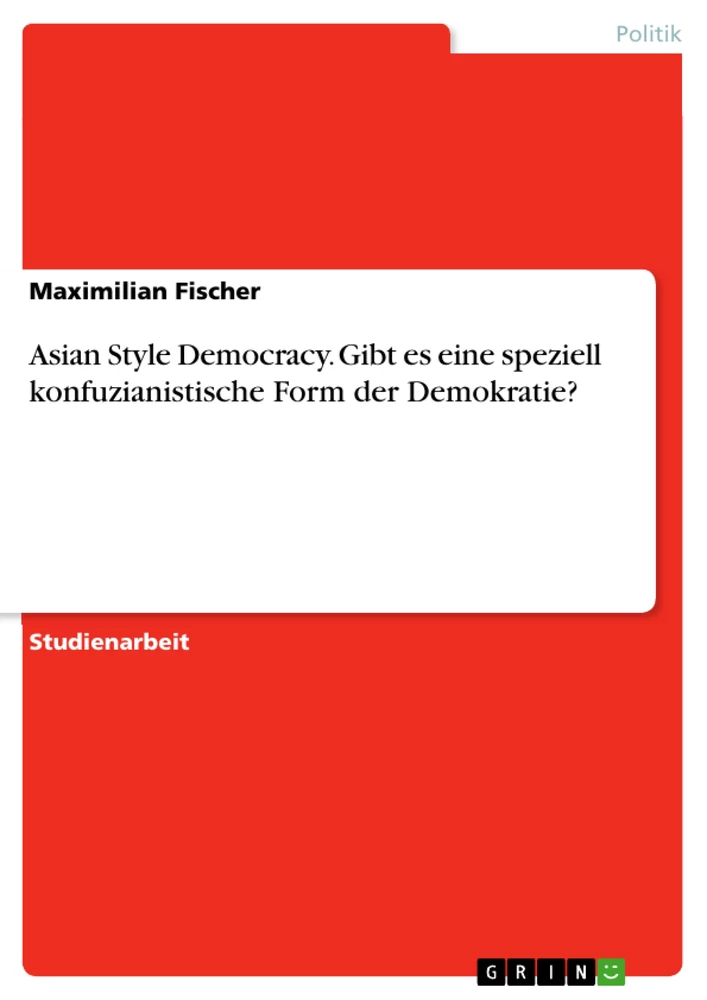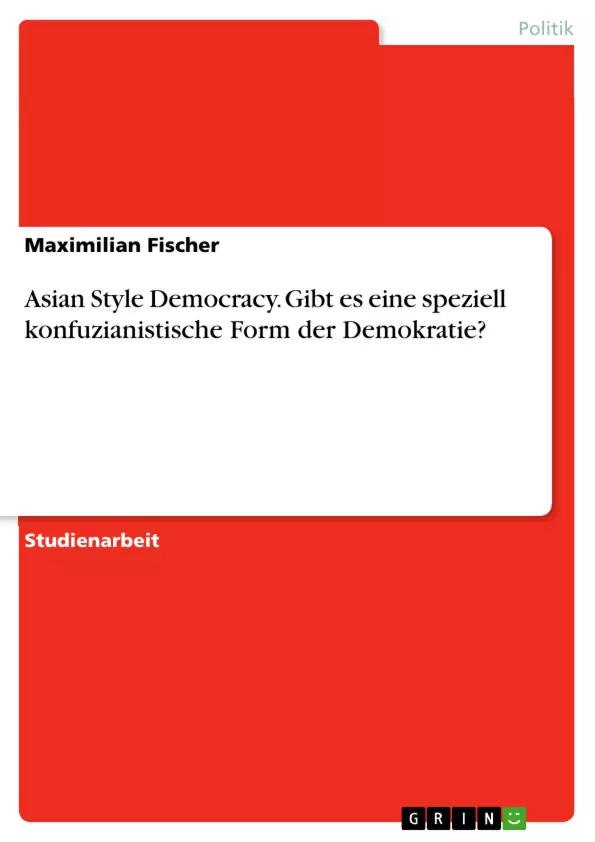Der Diskurs über die sogenannte “Asian Style Democracy“ begann mit dem Ende des Kalten Krieges, als es schien, dass die westliche Ideologie von Demokratie und Kapitalismus sich bald weltweit durchgesetzt haben würde. Die triumphale Rhetorik westlicher Politiker rief in den Ost- und Südostasiatischen Ländern eine starke Gegenreaktion hervor, die sich in dem Versuch artikulierte, die “Asian Style Democracy“ dem westlichen Demokratieverständnis entgegenzusetzen.
Kern der Debatte ist die Behauptung einiger asiatischer Staatsoberhäupter, allen voran Singapurs ehemaliger Premierminister Lee Kuan Yew und Malaysias früherer Ministerpräsident Mahatir Mohamad, dass es sich bei Asien um einen einzigartigen Kulturraum handle. Der einzigartige und auf seine Bedürfnisse zugeschnittene politische Systeme benötigt, die nicht zwangsläufig mit denen der westlichen Demokratien übereinstimmen. Das einzige akzeptable Regierungssystem sei das, das am besten vereinbar ist mit den kulturellen Werten seiner Bevölkerungsmehrheit. Im Falle der ost- und südostasiatischen Staaten sei das der Konfuzianismus, dessen Werte unvereinbar seien mit Demokratie. Auf dieser Grundlage behaupten einige Staatschefs in Ost- und Südostasien, sowie einige Wissenschaftler in Südkorea, Taiwan und dem Westen, dass ein politisches System, das teilweise demokratisch und teilweise autoritär ist, für Ost- und Südostasien besser geeignet sei als liberale Demokratie. In der politischen Praxis bedeutet dies, dass zum Wohle der Gemeinschaft, politische Freiheiten eingeschränkt werden, um Ordnung und Stabilität in der Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Darunter fallen beispielsweise die Redefreiheit, die Versammlungsfreiheit und die Freiheit der Presse.
Die Unterstützer der „Asian Values“-These gehen davon aus, dass das konfuzianistische Wertesystem Werte beinhaltet, die mit einer liberalen Ausrichtung der Demokratie unvereinbar sind und dass eine konfuzianistisch geprägte Bevölkerung, in der Mehrheit eine liberale Demokratieform als Regierungssystem ablehnt und eine autoritäre Form von Demokratie bevorzugt. Das wiederum sei die Grundlage für eine speziell konfuzianistische Demokratie, die „Asian Style Democracy“. Die Frage, ob diese Annahmen zutreffen, soll in dieser Arbeit untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Welche Staaten werden untersucht?
- Der Ursprung der „Asian Values“ Debatte
- Was macht die „Asian Values“ aus?
- Die Verbindung zwischen „Asian Values“ und „Asian Style Democracy“
- Konfuzianistische Werte und liberale Demokratie
- Definition von Demokratie: ein Vergleich von Ost und West
- Liberale Demokratie nur auf Kosten des Konfuzianismus?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob es eine speziell konfuzianistische Form der Demokratie gibt, die als „Asian Style Democracy“ bezeichnet wird. Sie untersucht, ob konfuzianistische Werte mit einer liberalen Ausrichtung der Demokratie unvereinbar sind und ob eine konfuzianistisch geprägte Bevölkerung eine liberale Demokratieform als Regierungssystem ablehnt.
- Der Ursprung und die Entwicklung der „Asian Values“-These
- Die Kernpunkte der „Asian Values“ und ihr Verhältnis zum Konfuzianismus
- Der Einfluss konfuzianistischer Werte auf die politische Kultur in Ostasien
- Die Frage nach der Vereinbarkeit von Konfuzianismus und liberaler Demokratie
- Der Vergleich zwischen westlichen und ostasiatischen Demokratiemodellen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Debatte über die „Asian Style Democracy“ ein und erläutert die zentrale These, dass konfuzianistische Werte mit einer liberalen Demokratie unvereinbar sind. Das zweite Kapitel stellt die zu untersuchenden Staaten vor, die als historisch konfuzianistisch gelten. Das dritte Kapitel analysiert den Ursprung der „Asian Values“-Debatte und beleuchtet die Rolle von Lee Kuan Yew und Singapur. Das vierte Kapitel beschreibt die „Asian Values“ selbst und geht auf ihren Inhalt und ihre Bedeutung ein. Das fünfte Kapitel untersucht den Einfluss des Konfuzianismus auf die politische Kultur in Ostasien und analysiert, ob er zur Ablehnung einer liberaldemokratischen Regierung führt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen „Asian Values“, „Asian Style Democracy“, Konfuzianismus, liberale Demokratie, politische Kultur, Ostasien, Vergleichende Politik, und empirische Studien.
- Citation du texte
- Maximilian Fischer (Auteur), 2015, Asian Style Democracy. Gibt es eine speziell konfuzianistische Form der Demokratie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343112