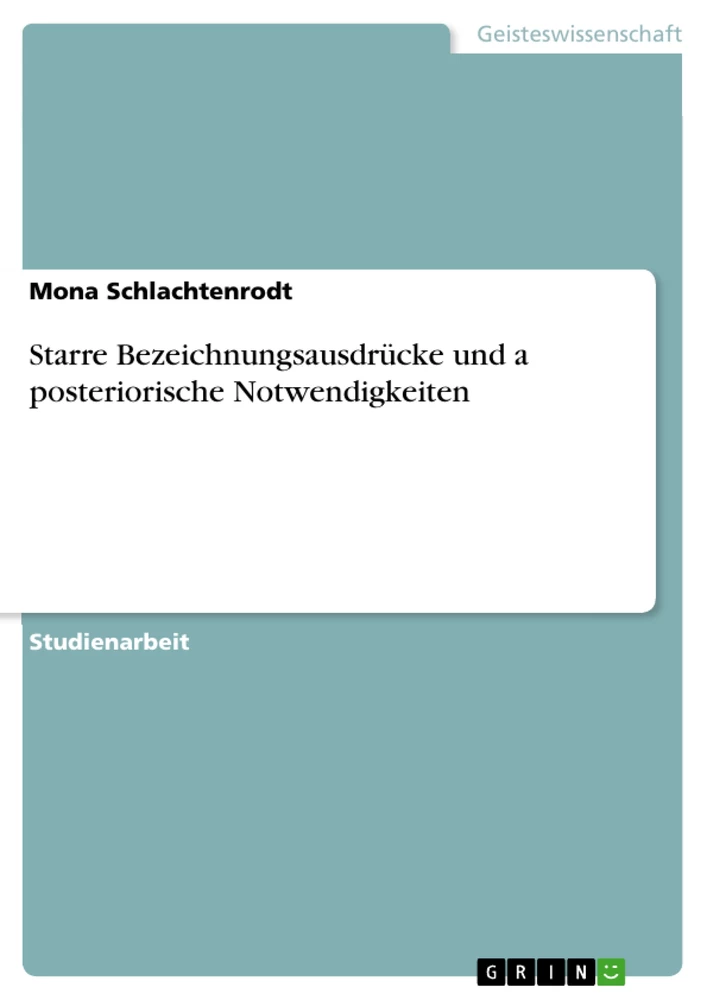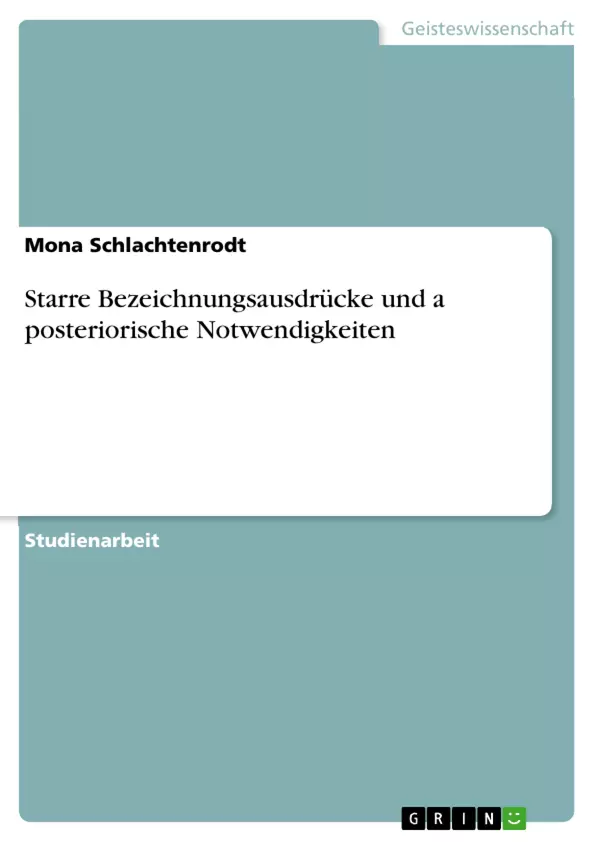Der amerikanische Philosoph Saul Aaron Kripke hielt 1970 eine Reihe von drei Vorlesungen, deren Ideen eine kleine Revolution in der Philosophie nach sich zogen. Später entstand aus den Mitschriften dieser Vorlesungen dann das Buch „Naming and Necessity“. Kripke greift zwei weitestgehend akzeptierte Paradigmen seiner Zeit an. Zum einen ist das die Kennzeichnungstheorie welche sich damit beschäftigt, was Namen eigentlich sind und wie sie mit der Sache zusammenhängen, die sie bezeichnen. Und die zweite bezieht sich auf „Necessity“ also auf den Begriff der Notwendigkeit, hierbei geht es vor allem darum, wie er damit zusammenhängt ob man etwas a priori erkennen kann und ob es notwendige Eigenschaften gibt.
In dieser Arbeit werden zunächst die eben erwähnten Theorien, welche sich vor Kripke etabliert hatten genauer dargestellt. Danach wird es um die Kritik gehen welche Kripke daran übt und die Theorie (beziehungsweise das Bild wie er es nennt), welches er alternativ dazu vorschlägt und abschließend wird Kripkes Standpunkt zu Identitätsaussagen, der sich aus seiner restlichen Theorie ergibt, erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Situation vor Kripke
- Namen vor Kripke
- Notwendigkeit vor Kripke
- Kripkes kritischer Standpunkt
- Kritik zur Notwendigkeit
- Kritik an der Namenstheorie
- Kripkes Vorstellung der Festlegung einer Referenz
- Identitätsaussagen von starren Bezeichnungsausdrücken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Saul Kripkes Kritik an der Kennzeichnungstheorie und der Notwendigkeitstheorie, wie sie vor 1970 in der Philosophie vertreten wurden. Sie analysiert Kripkes alternative Theorie der Namensreferenz und Notwendigkeit und erläutert, wie sich diese auf die Interpretation von Identitätsaussagen auswirkt.
- Kripkes Kritik an der Kennzeichnungstheorie
- Kripkes Theorie der Namensreferenz
- Kripkes Vorstellung von Notwendigkeit
- Die Rolle von möglichen Welten in Kripkes Theorie
- Kripkes Standpunkt zu Identitätsaussagen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Saul Kripkes Werk „Naming and Necessity“ und dessen revolutionäre Bedeutung für die Philosophie vor. Sie skizziert die beiden zentralen Kritikpunkte Kripkes an den etablierten Theorien der Namensreferenz und Notwendigkeit.
Situation vor Kripke: Dieses Kapitel erläutert die Kennzeichnungstheorie von Frege und Russell, die die Namensreferenz als eine Abkürzung für Kennzeichnungen des Referenten versteht. Zudem wird die vor-Kripkesche Sicht auf Notwendigkeit und ihre Unterscheidung zwischen „a priori“ und „a posteriori“ sowie „notwendig“ und „kontingent“ behandelt.
Kripkes kritischer Standpunkt: Dieses Kapitel analysiert Kripkes Kritik an der Notwendigkeitstheorie und seiner Einführung des Konzepts möglicher Welten. Es beleuchtet Kripkes Kritik an der Kennzeichnungstheorie und seiner alternativen Theorie der Namensreferenz. Abschließend werden Kripkes Überlegungen zu Identitätsaussagen im Kontext seiner Theorie der Notwendigkeit behandelt.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Philosophie von Saul Kripke, insbesondere mit seiner Kritik an der Kennzeichnungstheorie und der Notwendigkeitstheorie. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Namensreferenz, Kennzeichnungstheorie, Notwendigkeit, mögliche Welten, Identitätsaussagen, starre Bezeichnungsausdrücke, a priori, a posteriori, de dicto, de re.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein "starrer Bezeichnungsausdruck" nach Kripke?
Ein Ausdruck (wie ein Eigenname), der in jeder möglichen Welt, in der das Objekt existiert, dasselbe Objekt bezeichnet.
Wie kritisiert Kripke die Kennzeichnungstheorie?
Kripke argumentiert, dass Namen keine Abkürzungen für Beschreibungen sind, da ein Name seine Referenz auch dann behält, wenn die Beschreibungen falsch wären.
Was ist eine a posteriorische Notwendigkeit?
Es handelt sich um Aussagen (wie "Wasser ist H2O"), die notwendig wahr sind, deren Wahrheit aber nur durch Erfahrung (empirisch) entdeckt werden kann.
Welche Rolle spielen "mögliche Welten"?
Sie dienen als Gedankenexperimente, um zu prüfen, ob Eigenschaften eines Objekts essenziell (notwendig) oder zufällig (kontingent) sind.
Wer war Saul Aaron Kripke?
Ein US-amerikanischer Philosoph, dessen Vorlesungen "Naming and Necessity" (1970) eine Revolution in der Sprachphilosophie und Metaphysik auslösten.
- Quote paper
- Mona Schlachtenrodt (Author), 2015, Starre Bezeichnungsausdrücke und a posteriorische Notwendigkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343226