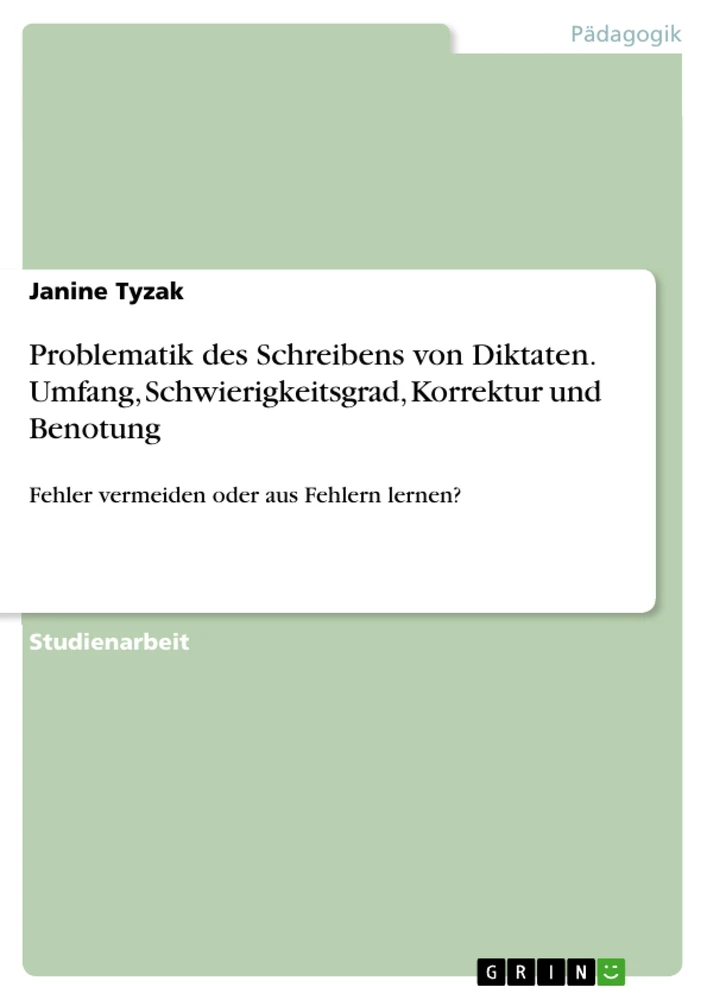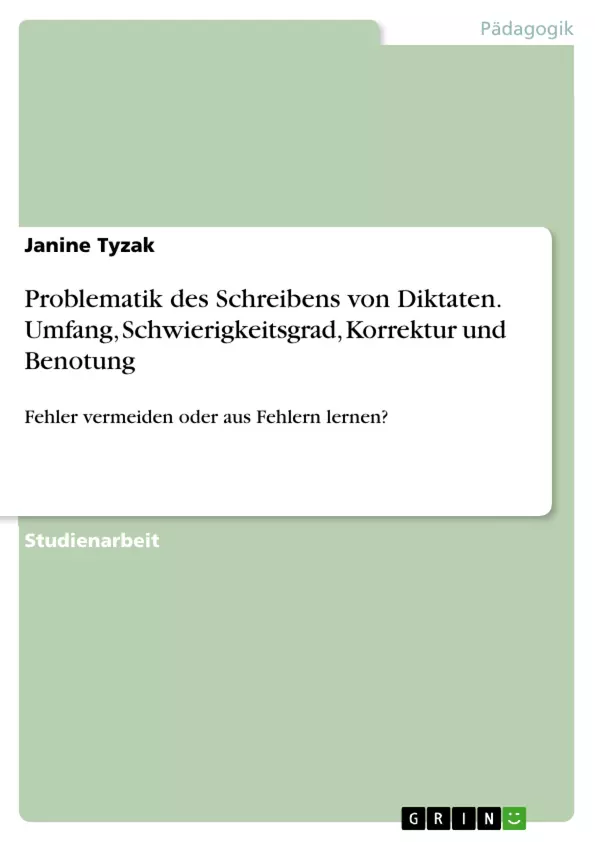„Fördert das Rechtschreiblernen - schafft die Klassendiktate ab!“ (Grundschulverband zit. nach Bartnitzky 2000, S.124). Mit dieser Forderung sorgte der Grundschulverband im Jahr 1998 für großes Aufsehen. Die Diskussion um die Methode des klassischen Diktats besteht bereits seit über 170 Jahren und ist bis heute aktuell. Dieser Diskurs ist Teil vieler gesellschaftlicher Bereiche geworden, von der Lernpsychologie über die Pädagogik, die Fachdidaktik bis hin zu moralischen Fragen. Trotzdem ist das Diktat bis heute noch fester Bestandteil der Schulpraxis einiger Bundesländer. Daraus ergibt sich die Frage welche Chancen und Risiken das Diktat für den Unterricht und für individuelle Lernprozesse birgt. Diesbezüglich wird auch die grundsätzliche Frage aufgeworfen, ob Schüler/innen überhaupt aus Diktatfehlern lernen können. Um diese Fragen beantworten zu können, werden in der folgenden Ausarbeitung zunächst Definitionen bezüglich des Diktats und seiner Regelung für das Bundesland Niedersachen gegeben, die als Grundlage für weiterführende Gedankengänge dienen.
Im Anschluss daran wird ein Einblick in die allgemeine Diktatkritik gegeben. Diese wird als Anlass genommen, das Diktat in seinen Einzelheiten kritisch zu reflektieren. Zu diesen Einzelheiten gehören unter anderem die Faktoren: Umfang, Schwierigkeitsgrad, Korrektur und Benotung. Auf diese umfangreiche Analyse folgend, wird der Blick auf die Frage gelenkt, ob Schüler/innen aus ihren Fehlern lernen können oder wie diesbezüglich die allgemeine Korrektur eines Diktats aussehen muss. Ausgehend von den Erkenntnissen dieses Kapitels werden differenzierte Handlungsmöglichkeiten und Varianten des klassischen Diktats auf der Grundlage lernpsychologischer Ansätze vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Curriculare Beschlüsse zu Diktaten in Niedersachsen
- Diktate sind (k)ein Unsinn
- Allgemeine Diktatkritik
- Allgemeiner Ablauf eines Diktats
- Äußere Einflussfaktoren auf den Diktiervorgang
- Auswahl der Diktate
- Umfang
- Schwierigkeitsgrad von Diktaten
- Korrektur durch die Lehrkraft
- Benotung
- Lernen aus Fehlern?
- Lernpsychologische Grundlagen
- Die Korrektur durch die SuS
- Differenzierter Umgang mit Diktaten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Problematik des klassischen Diktats im Rechtschreibunterricht. Im Fokus stehen dabei die Chancen und Risiken dieser Unterrichtsmethode für den Lernerfolg von Schülern/innen. Dabei wird insbesondere die Frage erörtert, inwiefern Schüler/innen aus Fehlern im Diktat lernen können.
- Definition und Abgrenzung des klassischen Diktats
- Curriculare Vorgaben zu Diktaten in Niedersachsen
- Kritik am Diktat als Unterrichtsmethode
- Lernpsychologische Aspekte des Fehlerlernens
- Differenzierte Ansätze im Umgang mit Diktaten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung nach den Chancen und Risiken des Diktats im Rechtschreibunterricht dar. Kapitel 2 widmet sich der Definition des klassischen Diktats und seiner Entstehung. Im dritten Kapitel werden die curricularen Vorgaben zu Diktaten in Niedersachsen beleuchtet. Kapitel 4 befasst sich mit der allgemeinen Diktatkritik sowie einer detaillierten Analyse des Diktats in Bezug auf Umfang, Schwierigkeitsgrad, Korrektur und Benotung. Weiterhin wird die Frage nach dem Lernen aus Fehlern und die Bedeutung der Korrektur durch Schüler/innen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Klassisches Diktat, Rechtschreibunterricht, Lernpsychologie, Fehlerlernen, Korrektur, Benotung, Curriculare Vorgaben, Niedersachsen, Unterricht, Schulpraxis.
Häufig gestellte Fragen
Warum stehen Diktate in der Kritik?
Kritiker bemängeln, dass Diktate eher den Status quo prüfen als den Lernprozess zu fördern und oft Frustration erzeugen.
Können Schüler aus Diktatfehlern lernen?
Die Arbeit untersucht, unter welchen Bedingungen (z.B. durch gezielte Korrekturstrategien) Fehler zur Verbesserung der Rechtschreibung beitragen können.
Welche Rolle spielt der Schwierigkeitsgrad bei Diktaten?
Umfang und Schwierigkeit müssen an den Lernstand angepasst sein, um weder Unter- noch Überforderung zu provozieren.
Welche Alternativen zum klassischen Diktat gibt es?
Vorgestellt werden differenzierte Formen wie Partnerdiktate, Laufdiktate oder Dosendiktate, die stärker auf individuelle Lernprozesse eingehen.
Wie sind Diktate in Niedersachsen geregelt?
Die Hausarbeit beleuchtet die curricularen Beschlüsse und Vorgaben für Diktate im Bundesland Niedersachsen.
- Quote paper
- Janine Tyzak (Author), 2015, Problematik des Schreibens von Diktaten. Umfang, Schwierigkeitsgrad, Korrektur und Benotung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343345