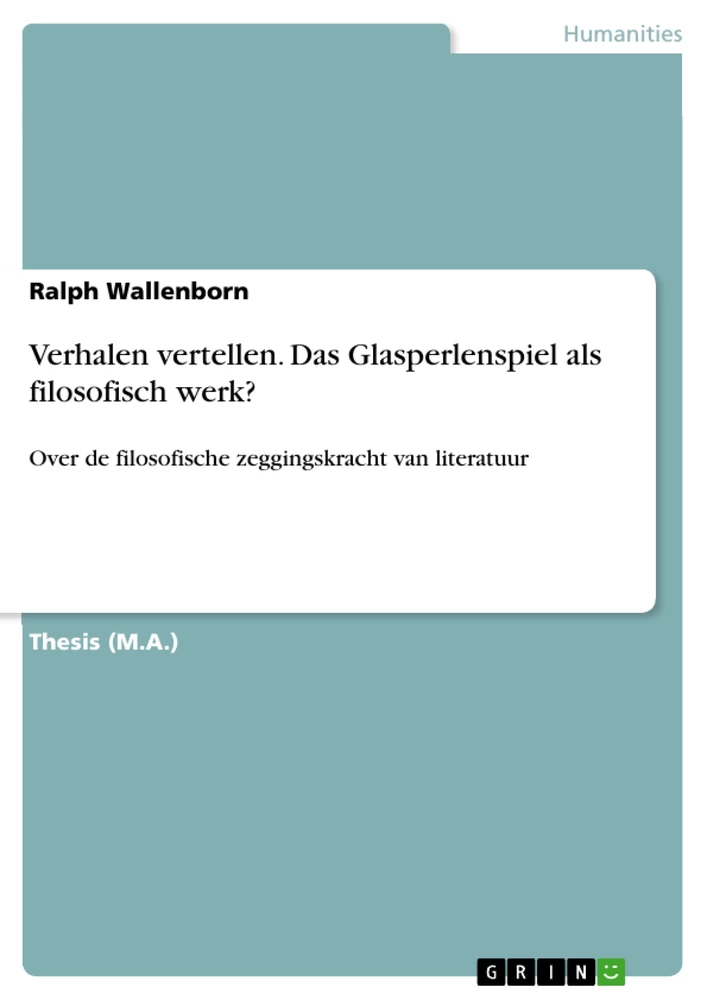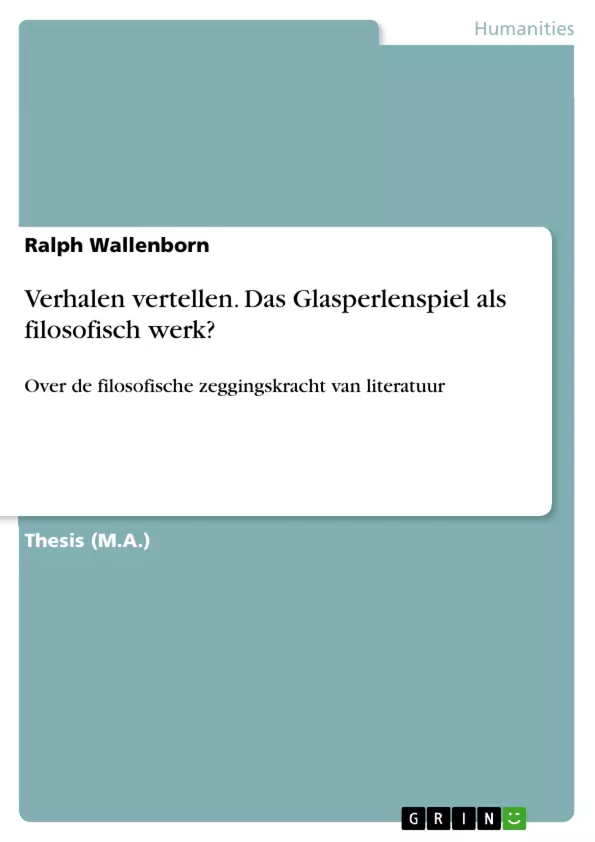Al sinds mensenheugenis vertellen mensen verhalen aan elkaar. Maar die verhalen vertellen in zekere zin ook zichzelf. De titel van deze thesis kan daarom op twee manieren worden begrepen:
Ten eerste kan men ervan uitgaan dat er altijd een verteller is die een verhaal vertelt aan een ander. In dien verstande is de setting van een verhaal in de wereld altijd dialogisch van aard – ongeacht de vorm waarin een verhaal zijn beslag krijgt, als fictief verhaal of als wetenschappelijk traktaat.
Maar verhalen scheppen ook hun eigen wereld en daarin heeft hun narratieve zeggingskracht zich losgekoppeld van hun schepper. Om het in filosofische termen uit te drukken: de geest van het verhaal heeft zich verzelfstandigd en tot op zekere hoogte gematerialiseerd. Hij bestaat uit letters en woorden die in een bepaalde volgorde zijn geplaatst. In die geobjectiveerde vorm is het éne verhaal vervolgens overgeleverd aan lezers die het, ieder op zijn eigen wijze, in een oneindige veelvoud van interpretaties en verwerkingen opnieuw tot leven wekken.
Zo komen de twee werelden, die van de verhalenverteller en die van de lezer of toehoorder, samen in een nieuw verhaal: een verhaal over een verhaal. Anders gezegd: het verhaal krijgt een geschiedenis, krijgt geschiedenissen. Dat kan op collectief vlak gebeuren in de traditie. Wanneer verhalen door de tijd heen worden overgeleverd van de ene generatie op de andere, van de ene plaats naar de andere, krijgen zij al naar gelang die tijd en plaats steeds weer een andere betekenis. Het verhaal blijft niet hetzelfde, maar wordt steeds weer iets anders. Dit geldt niet alleen voor de literatuur, vooral die van de zogenaamde canon, maar ook voor het ‘verhaal’ van de filosofie, dat steeds weer voeding geeft aan nieuwe filosofische vragen.
Maar het gebeurt ook op individueel vlak. De geest van het verhaal raakt onze identiteit en verandert deze. Of het nu filosofische, religieuze of literaire vertellingen zijn, de ‘geest’ van een verhaal genereert menselijke emoties en beweegt de menselijke ziel . We blijven onder het luisteren naar of lezen van verhalen niet alleen onberoerd, maar leren ook ons eigen leven als een verhaal zien. En ook daarin wordt duidelijk dat ons ‘ik’ niet is, maar wordt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Er war einmal...
- Das Glasperlenspiel: Einführung
- Erste Interpretation von Das Glasperlenspiel
- Paul Ricoeur: Literatur als Mittel zur Selbstreflexion
- Philosophie und Literatur: eine Demarkation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die philosophische Aussagekraft von Literatur am Beispiel von Hermann Hesses "Das Glasperlenspiel". Die zentrale Frage ist, wie philosophische Inhalte in literarischen Erzählungen dargestellt werden können und welche spezifischen Möglichkeiten und Grenzen das literarische im Vergleich zum philosophischen Diskurs bietet. Die Arbeit analysiert, wie philosophische Themen im Roman behandelt werden und welche Rolle das Erzählen selbst spielt.
- Darstellung philosophischer Inhalte in Literatur
- Vergleich literarischer und philosophischer Diskurse
- Die Rolle des Erzählens in der philosophischen Reflexion
- Das Verhältnis von Körper und Geist in Hesses Werk
- Der Begriff der "Phronesis" in Philosophie und Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Er war einmal...: Dieser einleitende Teil beleuchtet die dialogische Natur des Erzählens. Erstens wird der Akt des Erzählens selbst als Dialog zwischen Erzähler und Publikum beschrieben, unabhängig von der Form des Erzählens. Zweitens werden Geschichten als eigenständige Welten betrachtet, die sich von ihrem Schöpfer emanzipieren und eine eigene Geschichte, eigene Interpretationen und Verarbeitungen durch die Leser entwickeln. Dieser Prozess betrifft sowohl Literatur als auch die Philosophie, wobei Geschichten unsere Identität prägen und uns zu Selbstreflexion anregen können. Die Einleitung verweist auf die unterschiedlichen Arten des Erzählens (philosophisch, religiös, literarisch) und kündigt die zentrale Fragestellung der Arbeit an: die Untersuchung philosophischer Inhalte in literarischen Erzählungen.
Das Glasperlenspiel: Einführung: Dieser Abschnitt führt in Hermann Hesses "Das Glasperlenspiel" ein und begründet die Wahl dieses Romans als Untersuchungsgegenstand. Hesses Werk stellt zentrale philosophische Fragen, insbesondere das Dualismus von Körper und Geist. Der Roman wird als eine Synthese aus philosophischen und literarischen Elementen betrachtet, wobei die Lebensgeschichte der Hauptfigur, Josef Knecht, im Mittelpunkt steht. Die Einführung skizziert die Kernfragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden: die Darstellung philosophischer Inhalte in fiktionaler Literatur, die Möglichkeiten und Grenzen des narrativen Diskurses und die Relevanz des gewählten Diskurses für die Fragestellung.
Erste Interpretation von Das Glasperlenspiel: Diese Kapitel bietet eine erste Interpretation von Hesses Roman, beleuchtend die Durchbrechung der romantischen Utopie, eine Umdeutung des klassischen "Bildungs"-Ideals und die Betonung eines Humanismus ohne übergreifende Moral. Der Fokus liegt auf dem Wechsel von einer allegorischen zu einer existentiellen Lebenslehre. Die Untersuchung erörtert das "Spiel" als Metapher für menschliche Entscheidungsfreiheit, diskutiert jedoch gleichzeitig die Möglichkeit einer rein ästhetischen Interpretation des Romans und leitet zu weiteren Fragestellungen über.
Paul Ricoeur: Literatur als Mittel zur Selbstreflexion: Dieses Kapitel präsentiert Ricoeurs hermeneutische Theorie der Selbstreflexion und der narrativen Identität. Es wird der Unterschied zwischen positiver und negativer Freiheit (Ethik und Moral) im Kontext von Ricoeurs Denken erläutert und dessen Bedeutung für die Interpretation von "Das Glasperlenspiel" dargelegt. Insbesondere wird untersucht, wie das "Spiel" als narratives Metaniveau der Selbstbespiegelung verstanden werden kann und welche Rolle es in der Selbstfindung des Protagonisten spielt.
Philosophie und Literatur: eine Demarkation: In diesem Kapitel werden die Merkmale literarischer und philosophischer Diskurse verglichen und abgegrenzt. Die Arbeit argumentiert für den Stellenwert der "Phronesis" (praktische Weisheit) sowohl in Ricoeurs Philosophie als auch in Hesses "Das Glasperlenspiel". Der Vergleich der beiden Diskurse soll zeigen, wie die jeweilige Herangehensweise zu einem Verständnis von "Phronesis" beitragen kann und wo sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zeigen.
Schlüsselwörter
Das Glasperlenspiel, Hermann Hesse, Philosophie, Literatur, Narratologie, Hermeneutik, Selbstreflexion, Körper-Geist-Problematik, Phronesis, Bildung, Moral, Ästhetik, Dualismus.
Häufig gestellte Fragen zu Hermann Hesses "Das Glasperlenspiel"-Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die philosophische Aussagekraft von Hermann Hesses Roman "Das Glasperlenspiel". Sie untersucht, wie philosophische Inhalte in literarischen Erzählungen dargestellt werden und welche spezifischen Möglichkeiten und Grenzen der literarische Diskurs im Vergleich zum philosophischen bietet. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Rolle des Erzählens in der philosophischen Reflexion.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Themen, darunter die Darstellung philosophischer Inhalte in Literatur, den Vergleich literarischer und philosophischer Diskurse, die Rolle des Erzählens in der philosophischen Reflexion, das Verhältnis von Körper und Geist in Hesses Werk und den Begriff der "Phronesis" in Philosophie und Literatur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: "Er war einmal..." (Einführung in das Erzählen und die Fragestellung), "Das Glasperlenspiel: Einführung" (Einleitung in den Roman und Begründung der Themenwahl), "Erste Interpretation von Das Glasperlenspiel" (Interpretation des Romans mit Fokus auf die Durchbrechung romantischer Utopie und existentielle Lebenslehre), "Paul Ricoeur: Literatur als Mittel zur Selbstreflexion" (Anwendung der hermeneutischen Theorie Ricoeurs auf den Roman), und "Philosophie und Literatur: eine Demarkation" (Vergleich und Abgrenzung literarischer und philosophischer Diskurse im Hinblick auf "Phronesis").
Welche Rolle spielt Paul Ricoeur in dieser Arbeit?
Paul Ricoeurs hermeneutische Theorie der Selbstreflexion und narrativen Identität wird verwendet, um "Das Glasperlenspiel" zu interpretieren. Insbesondere der Unterschied zwischen positiver und negativer Freiheit und die Bedeutung des "Spiels" als narratives Metaniveau der Selbstbespiegelung werden im Kontext von Ricoeurs Denken untersucht.
Wie werden Philosophie und Literatur in dieser Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht und grenzt die Merkmale literarischer und philosophischer Diskurse ab. Dabei wird der Stellenwert der "Phronesis" (praktische Weisheit) sowohl in Ricoeurs Philosophie als auch in Hesses Roman untersucht, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Diskurse aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt dieser Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Das Glasperlenspiel, Hermann Hesse, Philosophie, Literatur, Narratologie, Hermeneutik, Selbstreflexion, Körper-Geist-Problematik, Phronesis, Bildung, Moral, Ästhetik, Dualismus.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Frage der Arbeit lautet: Wie können philosophische Inhalte in literarischen Erzählungen dargestellt werden, und welche spezifischen Möglichkeiten und Grenzen bietet der literarische im Vergleich zum philosophischen Diskurs?
- Quote paper
- Ralph Wallenborn (Author), 2015, Verhalen vertellen. Das Glasperlenspiel als filosofisch werk?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343405