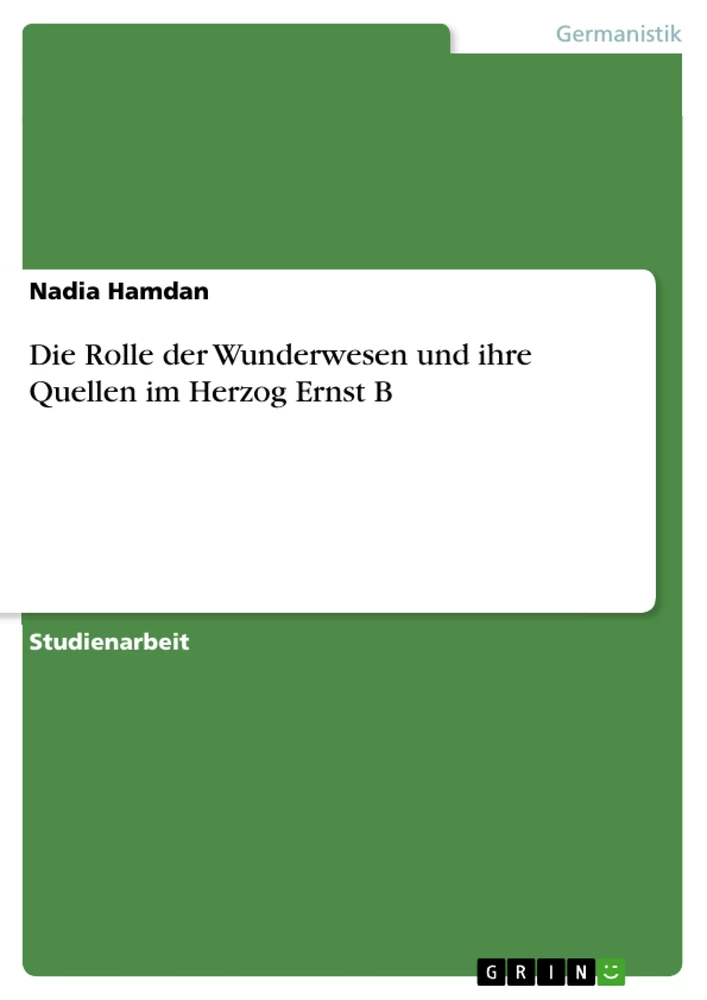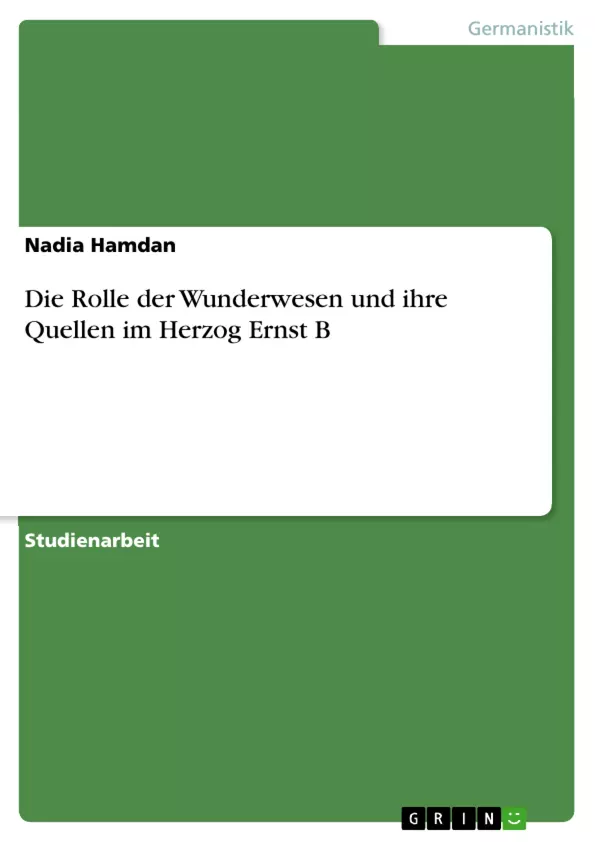Die Geschichte des aus der Heimat vertriebenen Herzog Ernst, der im fernen Orient zahlreiche Abenteuer erlebt, gehört zu den beliebtesten mittelalterlichen Prosastücken. Nur von wenigen mittelalterlichen Epen kann man sagen, dass sie bis in die Neuzeit hinein beliebt blieben. Ein Großteil der bekannten Dichtung, wie die Artusromane, erlangte erst mit der Romantik eine Wiederbelebung. Die Dichtung des Herzog Ernst jedoch wurde durch die Jahrhunderte immer wieder neu bearbeitet. Die Beliebtheit des Stoffes ist bis heute ungebrochen. Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf den Mittelpunkt der Dichtung, den Wunderwesen, denen Ernst im Orient begegnet; Die Forschung ist sich über deren Herkunft noch immer uneins. Unter Verwendung bislang noch nicht berücksichtigter Quellen stellt diese Arbeit den Versuch dar, die Wunderwesen einzuordnen und einen Bezug zum Horizont und dem Wissen des mittelalterlichen Dichters herzustellen.
Die Darstellung der Wunderwesen bietet Raum für weitere Interpretationsansätze. So wird es im Handlungsverlauf evident, dass der Dichter die Orientfahrt als Bußfahrt konzipierte, nachdem Herzog Ernst sich durch den Kampf gegen den Kaiser Schuld aufgeladen hat. Dies lässt sich sowohl durch die Darstellung der Wunderwesen, als auch Ernsts Verhalten ihnen gegenüber nachweisen. Besonders ausführlich möchte ich auf die Grippia Episode eingehen, da sich hier zum einen die unterschiedlichsten Quellenansätze herausgebildet haben, und sich zum anderen die Phantasie des Dichters und seine Eigenleistung in der Formulierung der wunderlichen Eigenschaften am deutlichsten zeigt. Der Autor des Textes ist unbekannt, ebenso seine genaue Entstehung. Die ältere Foschung ordnete „Herzog Ernst“ in die Gattung der Spielmannsdichtung ein, was neuere Forschungen jedoch widerlegen. Hans Naumann fand heraus, dass nicht die Spielleute, die die Lieder vortrugen die Verfasser der Stücke waren, sondern zumeist Geistliche. Dafür spricht nicht zuletzt, dass der Autor des Herzog Ernst über ein umfassendes kulturelles Wissen verfügt haben muss, was das Orientbild im Mittelalter, antike Dichtung und die deutsche Reichsgeschichte angeht. Zudem ist der Weg des Herzogs und seinem Gefolge in den Orient nach Art der historiographischen Romane sehr detailliert beschrieben und entspricht dem tatsächlichen Weg der Kreuzfahrer.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Aufbruch in den Orient
- Ernsts Vertreibung
- Über die Ritterpfichten
- Der Kreuzzungsweg
- Der Weg in den Orient
- Die Wunderwesen und ihre mutmaßlichen Quellen
- Zur Tradition der Wunderwesen
- Grippia
- Die Grippianer - Mischwesen aus der Phantasie des Dichters?
- Motive aus der mittelalterlichen, orientalischen und antiken Tradition
- Das Lebermeer und der Magnetberg
- Der Fund des Weisen
- Das Land der Arimaspi
- Die Pygmäen und ihr Kampf gegen die Kraniche
- Das Land Canaan
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Wunderwesen im mittelhochdeutschen Epos „Herzog Ernst“, insbesondere deren Herkunft und Bedeutung im Kontext der Orientfahrt. Die Untersuchung stellt den Versuch dar, die Wunderwesen in den Horizont des mittelalterlichen Wissens und der Quellenlage einzuordnen.
- Die Herkunft und Funktion der Wunderwesen im Epos
- Die Verbindung der Wunderwesen zu mittelalterlichen, orientalischen und antiken Traditionen
- Die Rolle der Grippia-Episode als Beispiel für die Phantasie des Dichters
- Die Interpretation der Orientfahrt als Bußfahrt
- Die Bedeutung der Quellenlage und Datierung des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Herzog Ernst-Epos ein und beleuchtet die Bedeutung und Popularität des Stoffes in der Literaturgeschichte. Zudem wird auf die Forschungsgeschichte und die verschiedenen Fassungen des Epos eingegangen.
Im zweiten Kapitel wird der Aufbruch des Herzog Ernst in den Orient beleuchtet. Die Vertreibung Ernsts aus seinem Land und die Motivation für seine Kreuzzugreise werden thematisiert. Dabei werden die Ritterpfichten, die Rolle des Kaisers und die Bedeutung der Religion als wichtige Motivationsfaktoren herausgestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Weg des Herzog Ernst in den Orient. Die Reise wird als typischer Kreuzzugsweg beschrieben, der jedoch durch einen Seesturm in einen fabulösen Orient führt.
Kapitel 4 behandelt die Wunderwesen, denen Ernst im Orient begegnet. Es wird die Tradition der Wunderwesen im Mittelalter beleuchtet und die Grippia-Episode als Beispiel für die Phantasie und Eigenleistung des Dichters untersucht.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Quellen der Wunderwesen. Es werden verschiedene Motive aus der mittelalterlichen, orientalischen und antiken Tradition untersucht, die als Inspiration für den Dichter gedient haben könnten.
Schlüsselwörter
Mittelhochdeutsches Epos, Herzog Ernst, Wunderwesen, Orientfahrt, Kreuzzug, Bußfahrt, Grippia, mittelalterliche Tradition, orientalische Tradition, antike Tradition, Quellenforschung, Datierung, Spielmannsdichtung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im mittelalterlichen Epos „Herzog Ernst“?
Es handelt von Herzog Ernst, der nach einem Konflikt mit dem Kaiser aus seiner Heimat vertrieben wird und im fernen Orient zahlreiche Abenteuer mit Wunderwesen erlebt.
Welche Bedeutung haben die Wunderwesen in der Dichtung?
Die Wunderwesen spiegeln das mittelalterliche Weltbild und Orientverständnis wider. Sie dienen oft als Symbole in Ernsts „Bußfahrt“, durch die er seine Schuld gegenüber dem Kaiser abträgt.
Was ist die Grippia-Episode?
Dies ist ein zentraler Teil der Erzählung, in dem die Phantasie des Dichters besonders deutlich wird. Die Herkunft der dort beschriebenen Wesen ist in der Forschung bis heute umstritten.
Welche Quellen nutzte der unbekannte Autor für das Werk?
Der Autor griff auf antike Dichtung, orientalische Traditionen, deutsche Reichsgeschichte und Berichte über tatsächliche Kreuzzugwege zurück.
Warum wird „Herzog Ernst“ nicht mehr als reine Spielmannsdichtung angesehen?
Neuere Forschungen legen nahe, dass der Verfasser vermutlich ein Geistlicher mit umfassendem kulturellem Wissen war, da die Reisebeschreibungen sehr detailliert und historiographisch geprägt sind.
- Citar trabajo
- Nadia Hamdan (Autor), 2003, Die Rolle der Wunderwesen und ihre Quellen im Herzog Ernst B, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34362