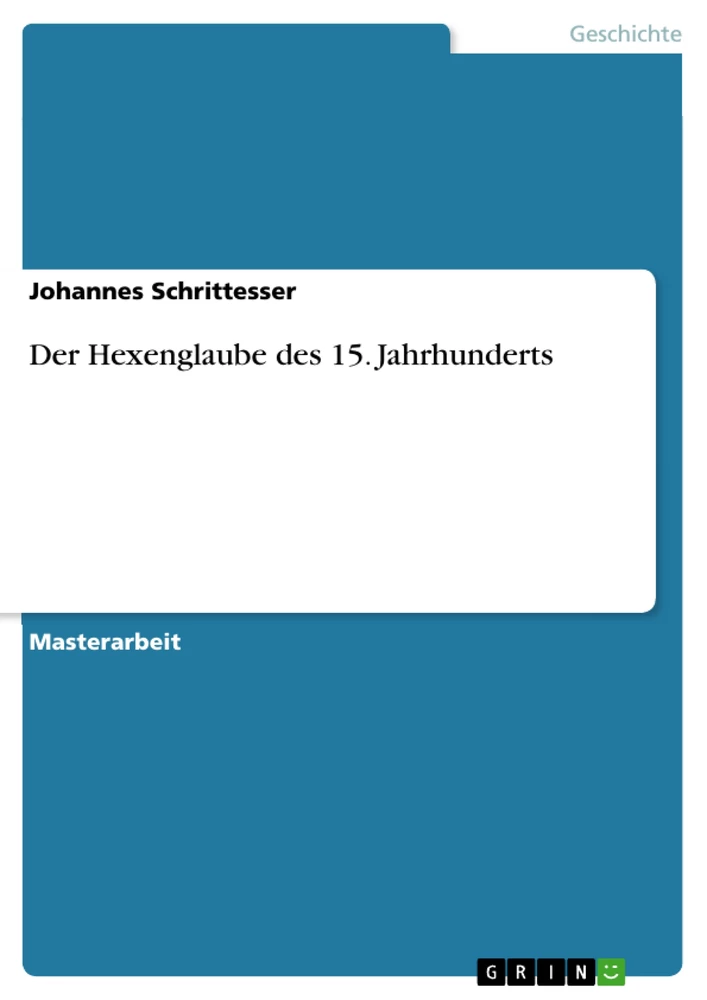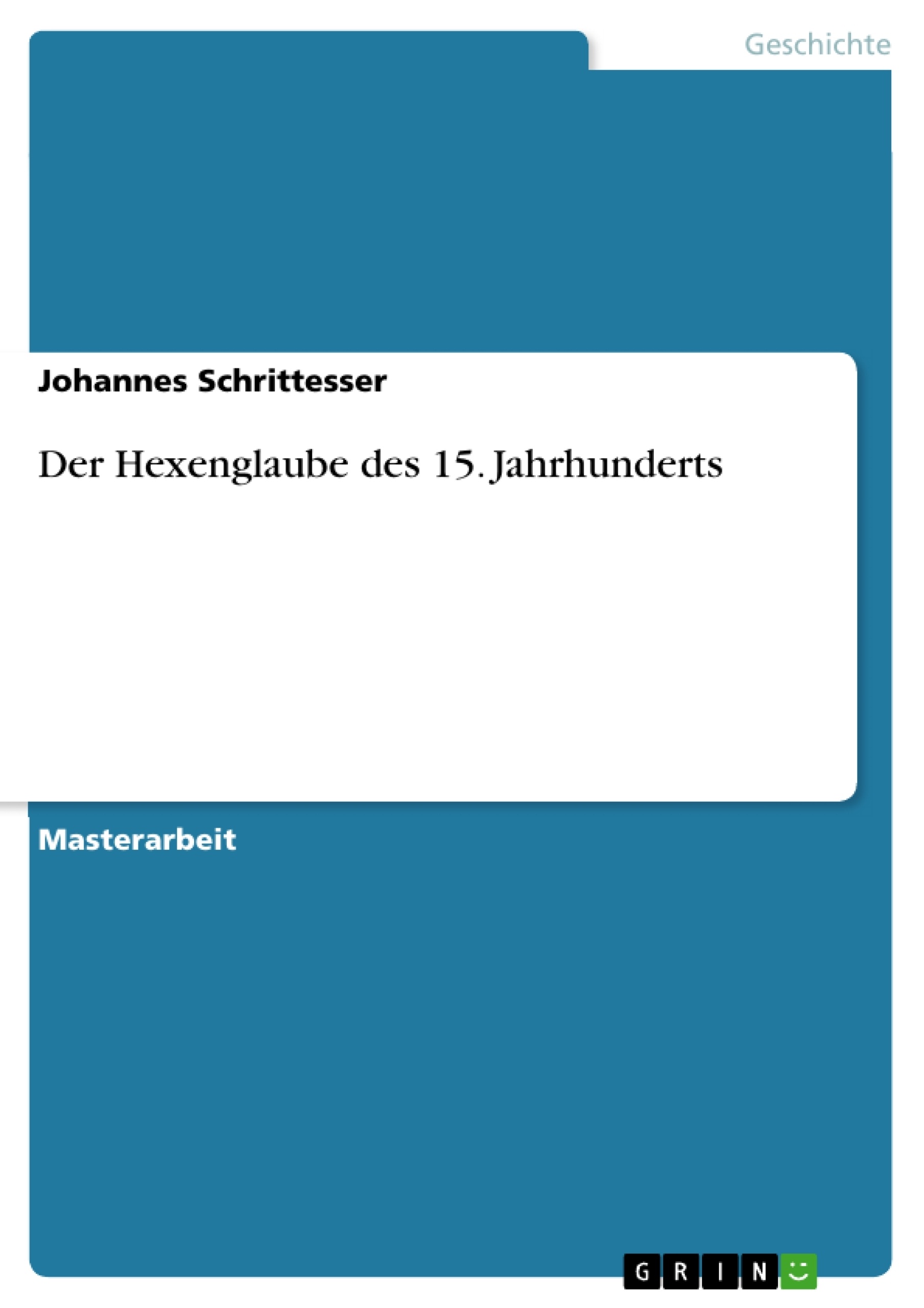Die geschichtswissenschaftliche Forschung, genauer gesagt die Hexenforschung der vergangenen Jahrzehnte, untersuchte in besonderem Maße die Hexenverfolgungen, welche der aktuellen Lehrmeinung zufolge als Massenphänomen erst seit dem 16. Jahrhundert auftraten. Um diese Verfolgungen angeblicher Hexen besser verstehen zu können, erscheint es ratsam sich mit den Hexenvorstellungen auseinanderzusetzen, die den Hexenverfolgungen zugrunde lagen bzw., mit deren Genese im Spätmittelalter.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Übersicht zur verwendeten Literatur
- 3. Definitionsversuche wichtiger Begriffe zum Verständnis des Hexenglaubens des 15. Jahrhunderts
- 3.1. MAGIE
- 3.2. ABERGLAUBE
- 3.3. VOLKSGLAUBE
- 3.4. DÄMONOLOGIE
- 3.5. TEUFELS- bzw. DÄMONENPAKT
- 3.6. KETZER
- 3.7. HEXEN und HEXER
- 3.8. HEXEREI
- 3.9. HEXENSEKTE
- 3.10. HEXENSABBAT
- 4. Die Deutungen von Hexerei, Zauberei und Dämonen bis zum Spätmittelalter
- 4.1. Altertum
- 4.2. Frühes Christentum
- 4.3. Früh- und Hochmittelalter
- 5. Die Entwicklung der Dämonologie im Spätmittelalter bis zum frühen 15. Jahrhundert
- 5.1. Die zunehmende Bedeutung des Dämonenpaktes als gedachte Basis der Zauberei und Hexerei
- 5.2. Die Rolle der europäischen Universitäten und ihrer theologischen Fakultäten für die Weiterentwicklung der Dämonologie im Spätmittelalter
- 6. Wichtige Informationen zum Hexenglauben des 15. Jahrhunderts
- 6.1. Eine fließende Grenze zwischen Vorteil- und Schadenzauber?
- 6.2. Die Hexenvorstellung der einfachen Bevölkerung und die der Gelehrtenwelt
- 6.3. Männern und Frauen zugeschriebene magische Wirkungsbereiche
- 6.4. Die Erörterung des Hexenglaubens in wichtigen gelehrten Traktaten des 15. Jahrhunderts
- 7. Der Formicarius des Johannes Nider
- 7.1. Die wichtigsten Informationen zum Leben des Dominikanergeistlichen
- 7.2. Allgemeine Informationen zum Formicarius
- 7.3. Die Inhalte des Formicarius (vor allem des fünften Buches)
- 7.3.1. Kräfte und Erscheinungsformen der Dämonen
- 7.3.2. Dämonen und Sexualität
- 7.3.3. Zauberei und Hexerei
- 7.3.4. Dämonische Besessenheit oder Geisteskrankheit?
- 8. Der Malleus Maleficarum des Heinrich Kramer
- 8.1. Allgemeine Informationen zum Hexenhammer und zu Heinrich Kramer
- 8.2. Inhaltsübersicht und beigelegte Dokumente des Hexenhammers
- 8.2.1. Die Bulle Summis desiderantes affectibus vom 5. Dezember 1484
- 8.2.2. Die Approbation / das Kölner Notariatsinstrument vom 19. Mai 1487
- 8.2.3. Die Apologia
- 8.3. Die wesentlichen Aussagen des Werkes nach Themen gegliedert
- 8.3.1. Hexerei im Allgemeinen
- 8.3.2. Die Einflussnahme der Hexen und Dämonen auf die Sexualität
- 8.3.3. Die (Schaden-)Zaubereien der Hexen
- 8.3.4. Mittel bzw. Schutz gegen/vor Hexerei
- 8.3.5. Kramers Empfehlungen für die rechtspraktische Umsetzung der Hexenverfolgungen
- 9. Die Beziehung des Formicarius des Johannes Nider zum Malleus Maleficarum des Heinrich Kramer
- 9.1. Liebestollheit und Liebeszauber
- 9.2. Frauenbild
- 9.3. Fruchtbarkeits- und potenzschädigender Zauber
- 9.4. Wetterzauber
- 9.5. Mittel gegen Hexen und Hexerei
- 9.6. Magischer Flug
- 9.7. Kannibalismus
- 9.8. Hexensekte
- 9.9. Besessenheit
- 10. Die Hexenverfolgungen des 15. Jahrhunderts
- 10.1. Mögliche Faktoren für das Aufkommen der Hexenverfolgungen
- 10.2. Rechtliche Grundlagen der Hexenverfolgungen
- 10.3. Die Verdächtigten und Opfer der Hexenverfolgungen
- 10.4. Die Ausbreitung der Hexenverfolgungen im 15. Jahrhundert anhand wichtiger Beispiele
- 10.5. (Frühe) Kritik an den Hexenverfolgungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht den Hexenglauben des 15. Jahrhunderts, insbesondere das Aufkommen neuer, gelehrter Vorstellungen von Hexerei und deren Einfluss auf die damalige Gesellschaft. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Ansichten gelehrter Theologen und Dämonologen mit dem Volksglauben. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Dämonologie im Spätmittelalter und die Rolle wichtiger Traktate wie des "Formicarius" und des "Malleus Maleficarum".
- Entwicklung der Dämonologie im Spätmittelalter
- Vergleich der Hexenvorstellungen von Gelehrten und einfacher Bevölkerung
- Analyse des "Formicarius" und des "Malleus Maleficarum"
- Untersuchung der Faktoren, die zum Aufkommen des neuartigen Hexenglaubens beitrugen
- Geschlechterspezifische Zuschreibungen magischer Fähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation der Arbeit, die sich aus einem Seminar über Außenseiter des Mittelalters entwickelte. Sie skizziert die Forschungsfrage nach der Genese des neuartigen gelehrten Hexenglaubens im 15. Jahrhundert und die methodische Vorgehensweise, die sich auf die Analyse gelehrter Traktate konzentriert, aber auch den Volksglauben berücksichtigt. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen gelehrten und volkstümlichen Hexenvorstellungen. Die Einleitung umreißt den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Fragestellungen.
3. Definitionsversuche wichtiger Begriffe zum Verständnis des Hexenglaubens des 15. Jahrhunderts: Dieses Kapitel legt die semantischen Grundlagen der Arbeit, indem es zentrale Begriffe wie Magie, Aberglaube, Volksglaube, Dämonologie, Teufelspakt, Ketzer, Hexen, Hexerei, Hexensekte und Hexensabbat definiert und abgrenzt. Diese Definitionen bilden die Basis für das Verständnis der nachfolgenden Analyse der historischen Quellen und ihrer Interpretationen des Hexenglaubens. Die genaue Definition dieser Termini ist entscheidend für eine präzise Analyse der Quellen.
4. Die Deutungen von Hexerei, Zauberei und Dämonen bis zum Spätmittelalter: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Konzepte von Hexerei, Zauberei und Dämonen vom Altertum bis ins Hochmittelalter. Es analysiert die Entwicklung dieser Konzepte und ihre Veränderungen im Laufe der Zeit, um einen Kontext für den Hexenglauben des 15. Jahrhunderts zu schaffen. Es vergleicht die antiken, frühchristlichen und mittelalterlichen Interpretationen und legt damit den Grundstein für das Verständnis der späteren Entwicklungen im Spätmittelalter. Die Bedeutung der unterschiedlichen theologischen und philosophischen Strömungen dieser Epochen für das Verständnis von Hexerei wird beleuchtet.
5. Die Entwicklung der Dämonologie im Spätmittelalter bis zum frühen 15. Jahrhundert: Das Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung der Dämonologie im Spätmittelalter, insbesondere auf die zunehmende Bedeutung des Dämonenpaktes als Grundlage für Zauberei und Hexerei. Die Rolle der europäischen Universitäten und ihrer theologischen Fakultäten bei der Weiterentwicklung der Dämonologie wird untersucht. Hier wird der Einfluss der Scholastik, besonders von Thomas von Aquin, auf die spätere Entwicklung des Hexenglaubens deutlich. Die zunehmende Systematisierung der Dämonologie wird als wichtiger Schritt für die spätere Entwicklung des Hexenglaubens analysiert.
6. Wichtige Informationen zum Hexenglauben des 15. Jahrhunderts: Dieses Kapitel befasst sich mit zentralen Aspekten des Hexenglaubens im 15. Jahrhundert. Es untersucht die fließende Grenze zwischen Vorteil- und Schadenzauber, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Hexenvorstellungen der einfachen Bevölkerung und der Gelehrtenwelt, und die geschlechtsspezifischen Zuschreibungen magischer Fähigkeiten. Es analysiert relevante gelehrte Traktate und deren Interpretationen von Hexerei. Der Fokus liegt auf der Interaktion von Volksglauben und Gelehrtenmeinungen, und dem sich herausbildenden Bild der Hexe.
7. Der Formicarius des Johannes Nider: Dieses Kapitel analysiert den "Formicarius" von Johannes Nider, ein wichtiges Werk des 15. Jahrhunderts zum Thema Hexerei. Es betrachtet das Leben Niders, den Inhalt des "Formicarius", insbesondere das fünfte Buch, und dessen Darstellung der Kräfte und Erscheinungsformen der Dämonen, der Beziehung zwischen Dämonen und Sexualität, sowie die Abgrenzung zwischen dämonischer Besessenheit und Geisteskrankheit. Die Bedeutung des "Formicarius" als Quelle für das Verständnis des damaligen Hexenglaubens wird im Detail beleuchtet.
8. Der Malleus Maleficarum des Heinrich Kramer: Dieses Kapitel behandelt den "Malleus Maleficarum" von Heinrich Kramer, einen weiteren einflussreichen Text zur Hexerei. Es analysiert das Leben Kramers, den Inhalt des "Hexenhammers", inklusive der Bulle, der Approbation und der Apologia. Es untersucht die zentralen Aussagen des Werkes bezüglich Hexerei im Allgemeinen, die Einflussnahme auf die Sexualität, die Schadenzauber, Schutzmittel und Kramers Empfehlungen zur Rechtspraxis. Die Bedeutung des "Malleus Maleficarum" als Schlüsselwerk für die Hexenverfolgungen wird eingehend diskutiert.
9. Die Beziehung des Formicarius des Johannes Nider zum Malleus Maleficarum des Heinrich Kramer: Dieses Kapitel vergleicht den "Formicarius" und den "Malleus Maleficarum", um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansichten zu Hexerei aufzuzeigen. Es untersucht Themen wie Liebestollheit, Frauenbild, Fruchtbarkeitszauber, Wetterzauber, Schutzmittel, magischer Flug, Kannibalismus, Hexensekten und Besessenheit. Der Vergleich dieser beiden Werke bietet Einblicke in die Vielfalt und Entwicklung der Hexentheorien im 15. Jahrhundert.
Schlüsselwörter
Hexenglaube, 15. Jahrhundert, Dämonologie, Hexenverfolgung, Formicarius, Malleus Maleficarum, Johannes Nider, Heinrich Kramer, Volksglaube, Gelehrtenmeinung, Magie, Zauberei, Schadenzauber, Sexualität, Besessenheit.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Analyse des Hexenglaubens im 15. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Masterarbeit untersucht den Hexenglauben des 15. Jahrhunderts, insbesondere das Aufkommen neuer, gelehrter Vorstellungen von Hexerei und deren Einfluss auf die damalige Gesellschaft. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Ansichten gelehrter Theologen und Dämonologen mit dem Volksglauben. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Dämonologie im Spätmittelalter und die Rolle wichtiger Traktate wie des "Formicarius" und des "Malleus Maleficarum".
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Dämonologie im Spätmittelalter, einen Vergleich der Hexenvorstellungen von Gelehrten und einfacher Bevölkerung, eine Analyse des "Formicarius" und des "Malleus Maleficarum", die Untersuchung der Faktoren, die zum Aufkommen des neuartigen Hexenglaubens beitrugen, und geschlechterspezifische Zuschreibungen magischer Fähigkeiten.
Welche Quellen werden analysiert?
Die Hauptquellen der Arbeit sind der "Formicarius" von Johannes Nider und der "Malleus Maleficarum" von Heinrich Kramer. Die Arbeit analysiert deren Inhalte im Detail und vergleicht die Ansichten beider Autoren. Zusätzlich werden weitere gelehrte Traktate des 15. Jahrhunderts und Aspekte des Volksglaubens berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise beschreibt. Es folgt eine Definition zentraler Begriffe. Die Arbeit behandelt dann die Entwicklung der Dämonologie bis zum 15. Jahrhundert, bevor sie sich eingehend mit dem Hexenglauben des 15. Jahrhunderts, dem "Formicarius", dem "Malleus Maleficarum" und dem Vergleich beider Werke beschäftigt. Abschließend werden die Hexenverfolgungen des 15. Jahrhunderts betrachtet.
Welche Schlüsselfragen werden beantwortet?
Die Arbeit sucht nach Antworten auf Fragen nach der Genese des neuartigen gelehrten Hexenglaubens im 15. Jahrhundert, den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen gelehrten und volkstümlichen Hexenvorstellungen, der Rolle des "Formicarius" und des "Malleus Maleficarum" in der Entwicklung des Hexenglaubens und den Faktoren, die zum Aufkommen der Hexenverfolgungen beitrugen.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert wichtige Begriffe wie Magie, Aberglaube, Volksglaube, Dämonologie, Teufelspakt, Ketzer, Hexen, Hexerei, Hexensekte und Hexensabbat. Diese Definitionen bilden die Grundlage für die Analyse der historischen Quellen.
Wie werden die "Formicarius" und der "Malleus Maleficarum" verglichen?
Der Vergleich der beiden Werke konzentriert sich auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansichten zu Themen wie Liebestollheit, Frauenbild, Fruchtbarkeitszauber, Wetterzauber, Schutzmittel, magischer Flug, Kannibalismus, Hexensekten und Besessenheit.
Welche Faktoren werden für das Aufkommen der Hexenverfolgungen genannt?
Die Arbeit untersucht mögliche Faktoren, die zum Aufkommen der Hexenverfolgungen beitrugen (dies wird im Kapitel 10.1 genauer erläutert). Die genauen Faktoren werden in der Arbeit selbst detailliert dargestellt.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit ist nicht im gegebenen Auszug enthalten. Es würde die zusammenfassenden Schlussfolgerungen aus den Analysen der "Formicarius", des "Malleus Maleficarum" und der Entwicklung des Hexenglaubens im 15. Jahrhundert enthalten.
- Citar trabajo
- Johannes Schrittesser (Autor), 2016, Der Hexenglaube des 15. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343700