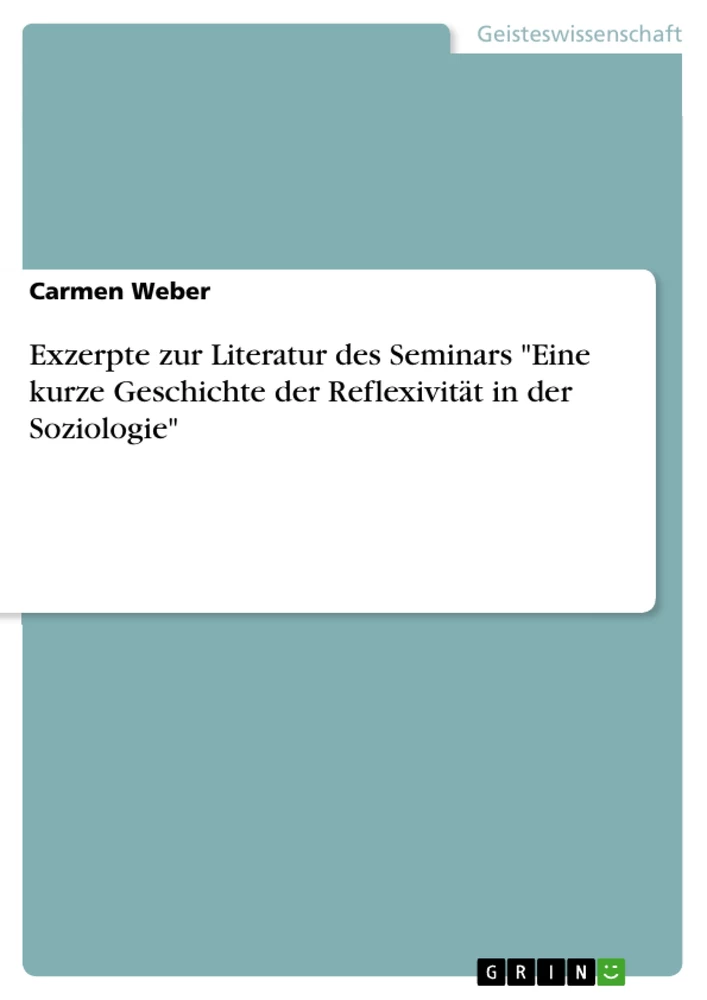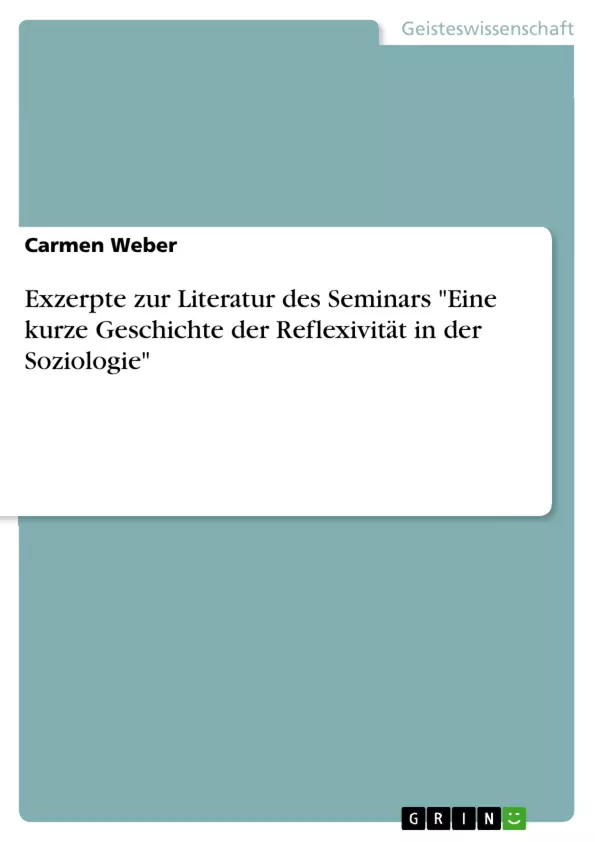Der Begriff der Reflexivität besitzt in der Soziologie weit mehr Bedeutungen, als eines von vielen Postulaten qualitativer Sozialforschung zu sein. Wobei das methodologische Verständnis von Reflexivität wiederum mehrere Facetten hat. Die verschiedenen Bedeutungen wie Verwendungen oder auch Verständnisse von Reflexivität waren Gegenstand des Seminars „Eine kurze Geschichte der Reflexivität in der Soziologie“ sowie der Faden, der sich durch die im Folgenden besprochene Literatur zieht.
Niklas Luhmann integrierte den Begriff der Reflexivität in sein Theoriegebäude der Systemtheorie. Ausgehend davon, dass soziale Systeme als selbstreferenzielle Objekte beobachtbar sind, weil deren Operationen unter anderem auf jene selbst bezogen sind, bezeichnet Luhmann Reflexivität als eine Form der Selbstreferenz. Reflexivität in diesem Sinne ist erforderlich, um im zeitlichen Ablauf von Prozessen dessen Elementarereignisse in einen umfassenderen Sinnzusammenhang zu setzen. Und um diese Reflexivität erreichen zu können, muss nach Luhmann beispielsweise in einem Kommunikationsprozess mit Kommunikation wieder in den Prozess eingetreten werden.
Aus Luhmanns Systemtheorie stammt auch die Idee der doppelten Kontingenz, die Offenheit der Situationsentwicklung, welche Individuen in eine Kommunikation einsteigen ließe, um jene Kontingenz zu reduzieren. Diese Offenheit von Situationen, wie auch eine unbestimmte Zukunft, wird zumeist negativ beschrieben. Elena Esposito kritisiert die Fixierung auf Vermeidungsstrategien der Kontingenzerfahrung und fordert eine weitere Ebene der Beobachtung, in der die Beobachtung von Kontingenzen selbst beobachtet werden kann. Von diesem Schritt erwartet sie nämlich eine neue Betrachtung der Kontingenz als Ressource.
Mit dem Begriff der Kontingenzkultur möchte Dirk Baecker sein Verständnis des modernen Kulturbegriffs als Vergleichsbegriff darstellen, wodurch die Kultur eine reflektierende Eigenschaft erhält, bzw. Ergebnis eines reflektierenden Prozesses ist. Reflexivität könnte hier als Kulturkritik innerhalb des kulturellen System verstanden werden, wofür Baecker den Begriff der Kulturreflexion bevorzugt, um bewusst zu machen, dass eine kulturelle Beschreibung nur im Rahmen von Kulturen stattfinden kann.
Gunter Falk und Heinz Steinert beschäftigen sich mit der Reflexivität als methodologisches Konzept und formulieren eine „reflexive Soziologie“, die im wesentlichen von Forschenden fordert, die erlernte soziale Kompetenz zu reflektiere
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reflexivität als Theoriekomponente
- Elena Esposito über die Chancen von Reflexionsproblemen in der modernen Gesellschaft
- Dirk Baecker über einen Kulturbegriff des Vergleichens
- Reflexivität als methodologische Herausforderung
- Gunter Falk und Heinz Steinert: Konzept einer reflexiven Soziologie
- Bruno Latour: Eine Kritik bzw. Alternative zur Distanzierung von Erklärung und Realität
- Pierre Bourdieu und Loic Wacquant über Reflexivität wissenschaftlicher Vorverständnisse
- Heidrun Friese und Peter Wagner zu Reflexionen auf der Ebene von Relationen intellektueller Theorien
- Reflexivität in der Zeitdiagnose
- James Clifford über Reflexivität in ethnographischen Texten
- Frances E. Mascia Lees, Patricia Sharpe und Colleen Ballerino Cohen: Argumentationen für einen Bezug zur Feministischen Theorie als Wegweiser zu einer reflexiven Anthropologie
- Anthony Giddens, Ulrich Beck und Christoph Lau über Reflexivität in der modernen Gesellschaft
- Weiterentwicklungen und Überlegungen zu Bourdieus Konzept der Reflexivität von Johan Heilbron und Tim May
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Seminar „Eine kurze Geschichte der Reflexivität in der Soziologie“ befasst sich mit der Entwicklung des Reflexivitätsbegriffs in der Soziologie. Es werden verschiedene Facetten und Verwendungen von Reflexivität beleuchtet, die sich durch die analysierte Literatur ziehen. Die Schwerpunkte liegen auf der Analyse der Reflexivität als Theoriekomponente, methodologische Herausforderung und in der Zeitdiagnose.
- Die Rolle von Reflexivität in der Systemtheorie und ihre Implikationen für die Beobachtung von sozialen Prozessen.
- Die Bedeutung von Reflexivität für die wissenschaftliche Praxis und die Kritik an unhinterfragten Annahmen in der Forschung.
- Die Bedeutung von Reflexivität in der modernen Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf soziale und kulturelle Entwicklungen.
- Die Verbindung von Reflexivität mit feministischer Theorie und ihre Bedeutung für die Anthropologie.
- Die Analyse der Reflexivität in verschiedenen theoretischen Ansätzen, wie beispielsweise der Systemtheorie, der postmodernen Theorie und der feministischen Theorie.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil des Seminars befasst sich mit der Reflexivität als Theoriekomponente. Elena Esposito analysiert die Chancen von Reflexionsproblemen in der modernen Gesellschaft und fordert eine neue Ebene der Beobachtung, die die Kontingenz als Ressource begreift. Dirk Baecker stellt den Kulturbegriff als Vergleichsbegriff dar und argumentiert, dass Kultur eine reflektierende Eigenschaft erhält durch den Vergleich von Lebensweisen.
Der zweite Teil des Seminars untersucht die Reflexivität als methodologische Herausforderung. Gunter Falk und Heinz Steinert fordern eine „reflexive Soziologie“, die die erlernte soziale Kompetenz in die Forschung einbezieht. Bruno Latour kritisiert die gängige Form wissenschaftlicher Erklärungen und plädiert für einen unkomplizierten und glaubwürdigen Stil. Pierre Bourdieu und Loic Wacquant betonen die Eingebundenheit von Forschenden in gesellschaftliche Relationen und die Notwendigkeit, Vorverständnisse als verzerrende Faktoren zu reflektieren. Heidrun Friese und Peter Wagner reflektieren die Relationen intellektueller Theorien zueinander und betonen die Unvermeidlichkeit von Überschneidungen.
Der dritte Teil des Seminars beschäftigt sich mit der Reflexivität in der Zeitdiagnose. James Clifford konstatiert eine Entwicklung zu Reflexivität in der Ethnographie, während Frances E. Mascia Lees, Patricia Sharpe und Colleen Ballerino Cohen die postmoderne Theorie kritisch betrachten und die feministische Theorie als geeigneteren Ansatz für eine reflexive Anthropologie sehen. Anthony Giddens, Ulrich Beck und Christoph Lau analysieren die Reflexivität in der modernen Gesellschaft und sehen postmoderne Überlegungen als verstärkt auftretende Phänomene einer „reflexiven Moderne“. Johan Heilbron und Tim May gehen auf Bourdieus Konzept der Reflexivität ein und reflektieren das soziale Wandlungspotential von Reflexivität.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Seminars sind Reflexivität, Systemtheorie, Kultur, Methode, Forschung, Gesellschaft, Moderne, Postmoderne, Feministische Theorie, Anthropologie, Zeitdiagnose, Soziales Wandlungspotential.
- Citar trabajo
- Carmen Weber (Autor), 2009, Exzerpte zur Literatur des Seminars "Eine kurze Geschichte der Reflexivität in der Soziologie", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343820