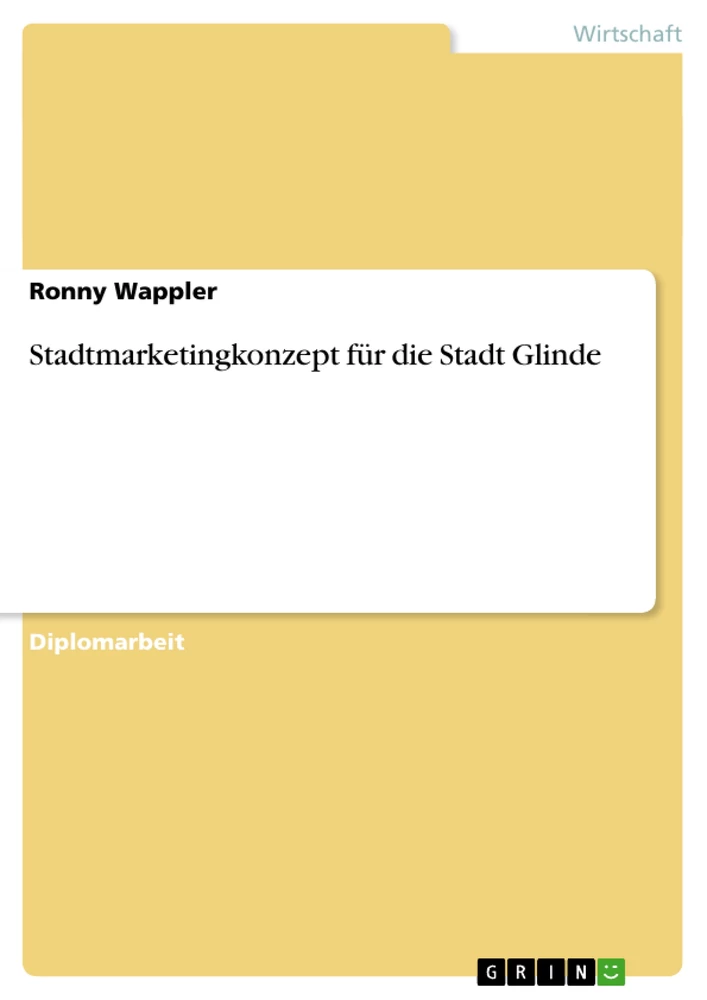„Die Planung, Koordination und Kontrolle aller auf die aktuellen und potenziellen Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivitäten“, lässt sich längst nicht mehr nur auf Produkte und Dienstleistungen der Privatwirtschaft begrenzen. Bund, Länder, Regionen, Städte und Gemeinden sehen sich zunehmend einem Wettbewerb als Arbeits-, Wohn-, Ausbildungs-, Einkaufs- und Freizeitstandort ausgesetzt, dem es durch geeignete Konzepte zu begegnen gilt. Wirft man einen Blick auf die Historie des Stadtmarketings, dann lassen sich schon seit etwa den 1980er Jahren erste Aktivitäten in der kommunalen Verwaltungspraxis Deutschlands ausfindig machen. Eine der frühen Initiativen entstand 1987 auf Anregung der Schweinfurter Oberbürgermeisterin Gudrun Grieser. Ein Jahr später entwickelten Experten aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft ein Marketingkonzept für die Stadt Wuppertal. 1989 förderte das Bayrische Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr Projekte in Kronach, Mindelheim und Schwandorf, denen eine Vielzahl von Konzepten und Initiativen bundesweit folgten.
Die Wiedervereinigung signalisierte neben dem Modernisierungsgedanken des Stadtmarketings einen weiteren Ansatzpunkt. Veraltete Strukturen sollten reformiert und flexible Handlungsnetzwerke geschaffen werden. Das führte nicht selten zu Erwartungen, die nicht bzw. kaum realisierbar waren. Das Spektrum der umschriebenen Aktivitäten reichte von Werbemaßnahmen und Tourismusförderung, der Bewirtschaftung kommunaler Einrichtungen und Dienstleistungen bis hin zur Beratung der Stadtverwaltung.
Aufbauend auf der Imageanalyse von Ralf Ackermann, welche die analytischen Grundlagen für diese Arbeit liefert, steht hier das Ziel im Vordergrund, ein Werbkonzept für die Stadt Glinde zu entwerfen. Erstmal ist aber wichtig, dass der Begriff Stadtmarketing klar definiert wird. Zudem ergibt sich daraus die Notwendigkeit der Abgrenzung gegenüber dem Regionalmarketing. Im nachfolgenden Abschnitt der theoretischen Grundlagenbestimmung werden dann die einzelnen Phasen einer ganzheitlichen Stadtmarketingkonzeption erörtert. Sie bilden den Bezugsrahmen zu der sich anschließenden praktischen Erstellung einer Werbekonzeption für die Stadt Glinde. Der Schwerpunkt der Arbeit soll sein, aus den Resultaten der Imageanalyse Leitbilder und Maßnahmen abzuleiten, sowie darauf aufbauend, eine Kommunikationsstrategie zu entwerfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Die Bedeutung von Stadtmarketing
- 2.2. Vom Regionalmarketing zum Stadtmarketing- Eine räumliche Abgrenzung
- 2.3. Zielsetzung und Handlungsfelder des Stadtmarketing
- 2.4. Die Phasen des Stadtmarketing-Prozesses
- 2.4.1. Die Anschubphase
- 2.4.2. Die Analysephase
- 2.4.3. Die Ziel- und Leitbildphase
- 2.4.4. Teilziele, Strategien und Maßnahmen
- 2.4.5. Umsetzung und Kontrolle
- 3. Praktischer Teil – Das Werbekonzept für die Stadt Glinde
- 3.1. Die Ausgangssituation
- 3.2. Fazit der Analyseergebnisse und Bestimmung der Arbeitsfelder
- 3.3. Die Vision: Glinde 2014
- 3.4. Entwicklung von Leitbildern und Maßnahmen
- 3.4.1. Kultur
- 3.4.2. Freizeit und Erholung
- 3.4.3. Einkauf
- 3.5. Kommunikationsstrategie für Glinde
- 3.5.1. Zielsetzung
- 3.5.2. Zielgruppen
- 3.5.3. Kommunikationsarten
- 3.6. Ansatz der Öffentlichkeitsarbeit
- 3.7. Eventmarketing
- 3.8. Entwurf einer Werbelinie für die Stadt Glinde
- 3.8.1. Der Slogan
- 3.8.2. Das Logo
- 3.8.3. Fortführung des Stadtmarketing in Glinde
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Werbekonzepts für die Stadt Glinde. Das Ziel ist es, die Stadt Glinde als attraktiven Wohn-, Arbeits- und Freizeitstandort zu positionieren. Dazu werden die theoretischen Grundlagen des Stadtmarketings beleuchtet und die einzelnen Phasen eines ganzheitlichen Stadtmarketing-Prozesses erörtert.
- Die Bedeutung von Stadtmarketing
- Die Phasen des Stadtmarketing-Prozesses
- Entwicklung von Leitbildern und Maßnahmen
- Kommunikationsstrategie
- Entwurf einer Werbelinie
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Bedeutung des Stadtmarketings im Kontext des zunehmenden Wettbewerbs um Arbeits-, Wohn- und Freizeitstandorte erläutert. Es werden die Anfänge des Stadtmarketings in Deutschland und die verschiedenen Ansätze und Ziele beleuchtet.
Das zweite Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen des Stadtmarketings. Es wird die Abgrenzung zum Regionalmarketing sowie die einzelnen Phasen des Stadtmarketing-Prozesses, inklusive der Anschubphase, der Analysephase, der Ziel- und Leitbildphase, der Planung von Teilzielen, Strategien und Maßnahmen sowie der Umsetzung und Kontrolle, dargestellt.
Der praktische Teil des Buches, beginnend im dritten Kapitel, fokussiert sich auf das Werbekonzept für die Stadt Glinde. Hier werden die Ausgangssituation der Stadt, die Analyseergebnisse und die Festlegung der Arbeitsfelder zusammengefasst. Es werden Leitbilder und Maßnahmen für verschiedene Bereiche wie Kultur, Freizeit und Erholung sowie Einkauf entwickelt.
Weiterhin wird eine Kommunikationsstrategie für Glinde erarbeitet, die Zielsetzung, Zielgruppen und Kommunikationsarten beinhaltet. Der Ansatz der Öffentlichkeitsarbeit sowie das Eventmarketing werden ebenfalls beleuchtet. Abschließend wird ein Entwurf einer Werbelinie für die Stadt Glinde mit Slogan, Logo und einer Vision für die Fortführung des Stadtmarketings vorgestellt.
Schlüsselwörter
Stadtmarketing, Regionalmarketing, Leitbildentwicklung, Kommunikationsstrategie, Werbelinie, Vision, Analyse, Zielgruppen, Eventmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Glinde.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel des Stadtmarketingkonzepts für Glinde?
Ziel ist es, ein Werbekonzept zu entwerfen, das Glinde als attraktiven Wohn-, Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitstandort positioniert.
Wie unterscheidet sich Stadtmarketing von Regionalmarketing?
Die Arbeit nimmt eine räumliche Abgrenzung vor, wobei Stadtmarketing sich spezifisch auf die Identität und Vermarktung einer einzelnen Kommune konzentriert.
Welche Phasen durchläuft der Stadtmarketing-Prozess?
Der Prozess gliedert sich in Anschub-, Analyse-, Ziel- und Leitbildphase sowie die Planung von Maßnahmen und deren Umsetzung und Kontrolle.
Welche Handlungsfelder werden für Glinde priorisiert?
Die zentralen Handlungsfelder sind Kultur, Freizeit und Erholung sowie die Stärkung des lokalen Einkaufsangebots.
Was beinhaltet die Kommunikationsstrategie?
Sie umfasst die Definition von Zielgruppen, die Auswahl von Kommunikationsarten, Ansätze zur Öffentlichkeitsarbeit und Eventmarketing.
Warum wurde für Glinde ein neuer Slogan und ein Logo entworfen?
Dies dient der Schaffung einer unverwechselbaren Werbelinie, um den Wiedererkennungswert der Stadt im Wettbewerb der Standorte zu steigern.
- Citation du texte
- Ronny Wappler (Auteur), 2003, Stadtmarketingkonzept für die Stadt Glinde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34418