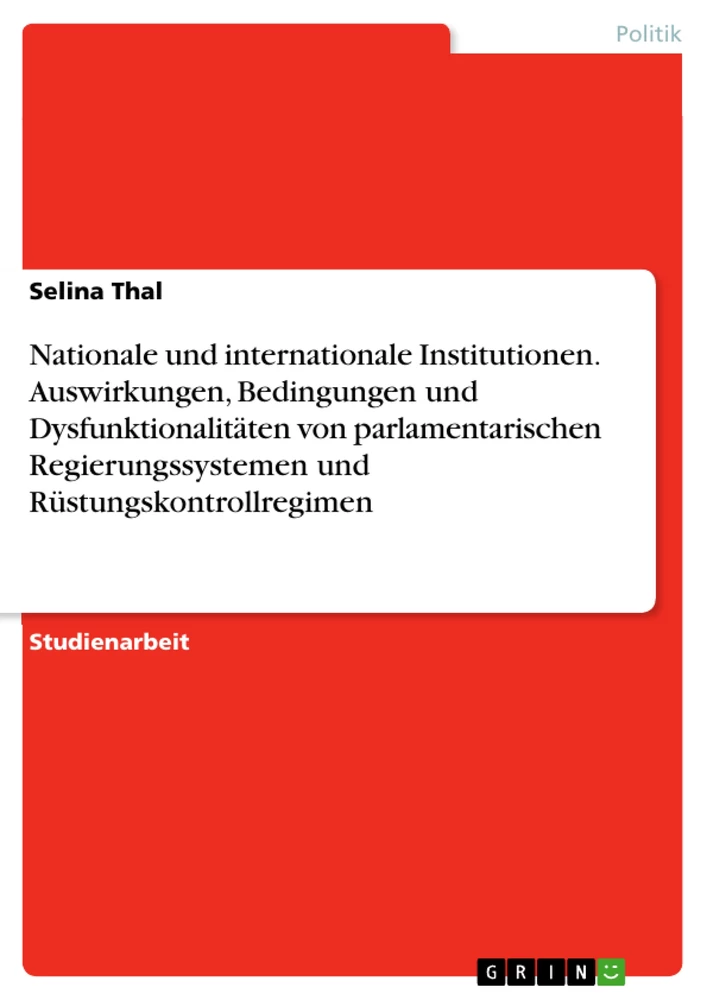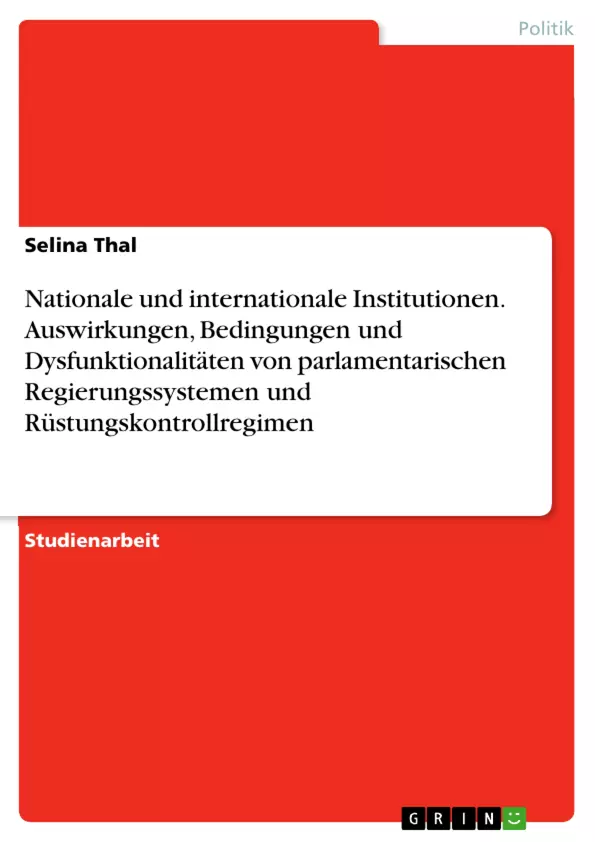Einen Schnittpunkt der Vergleichenden Regierungslehre und der Internationalen Beziehungen bildet die Untersuchung der Auswirkungen von Institutionen. Die Wahl des Gegenstandes, welcher von den Auswirkungen betroffen ist, setzt daher immer eine normative Grundannahme voraus. Die vorliegende Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, Institutionen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Frieden und die demokratische Stabilität zu untersuchen. In einem weiteren Schritt werden die Bedingungen für das Funktionieren von Institutionen erörtert und Ausnahmefälle formuliert. Dabei muss zwischen nationalen und internationalen Institutionen unterschieden werden. Institutionen auf nationalstaatlicher Ebene gehören der polity-Dimension, als einer der drei Dimensionen von Politik, an (Lauth/ Wagner 2002: 17f.). Definiert werden können nationale Institutionen als „Manifestationen der zentralen Verfassungsnormen (…), die sich entlang der Exekutive, der Legislative und der Judikative ausbildeten“ und deren „formale[n] Regeln und Normen tatsächlich das Verhalten der Beteiligten maßgeblich prägen“ (Lauth/ Wagner 2002: 25). Aus dieser Definition ergibt sich auch der mögliche Untersuchungsgegenstand des Regierungssystems als eine der Institutionen die einen Einfluss auf die demokratische Stabilität ausübt (Lauth/ Wagner 2002: 22). Es wird von der These ausgegangen, dass das parlamentarische System durch mehr Flexibilität und bessere Anpassungsfähigkeit einen höheren Beitrag zur Demokratiestabilisierung leisten kann als der Präsidentialismus. Die wesentlichen Voraussetzungen für das Funktionieren des Parlamentarismus sind dabei auf der polity- und politics-Ebene zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Demokratische Stabilität
- Die Flexibilität und das Anpassungsvermögen des Parlamentarismus
- Die politische Kultur als Garant für demokratische Stabilität
- Frieden
- Die Rüstungskontrollregime- eine dauerhafte internationale Kooperation?
- Der ökonomische Nutzen und Sicherheitsvorteil von Rüstungskontrollregimen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen von Institutionen auf den Frieden und die demokratische Stabilität. Dabei werden sowohl nationale als auch internationale Institutionen betrachtet. Der Fokus liegt auf dem Einfluss des parlamentarischen Regierungssystems auf die demokratische Stabilität und auf die Auswirkungen von Rüstungskontrollregimen auf den internationalen Frieden. Die Arbeit analysiert die Bedingungen für das Funktionieren von Institutionen und formuliert mögliche Ausnahmefälle.
- Die Auswirkungen des parlamentarischen Regierungssystems auf die demokratische Stabilität
- Die Bedingungen für das Funktionieren des Parlamentarismus
- Die Auswirkungen von Rüstungskontrollregimen auf den internationalen Frieden
- Die Bedingungen für das Funktionieren von Rüstungskontrollregimen
- Die Rolle von Institutionen in der internationalen Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung von Institutionen für die politische Stabilität und den internationalen Frieden. Sie definiert die Begriffe „nationale Institutionen" und „internationale Regime" und stellt die These auf, dass das parlamentarische System durch mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit einen größeren Beitrag zur demokratischen Stabilität leisten kann als der Präsidentialismus. Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile: den ersten Teil, der sich mit der demokratischen Stabilität befasst, und den zweiten Teil, der sich mit dem internationalen Frieden auseinandersetzt.
Demokratische Stabilität
Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des Parlamentarismus auf die demokratische Stabilität. Es wird argumentiert, dass das parlamentarische System durch seine institutionelle Struktur ein höheres Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit besitzt als das präsidentielle System. Der Vorteil des Parlamentarismus liegt in der Interdependenz zwischen der exekutiven und legislativen Gewalt, die es ermöglicht, die Regierung durch eine Mehrheit im Parlament abzusetzen und zu ersetzen. Das Kapitel beleuchtet die empirische Evidenz für die Stabilität parlamentarischer Systeme und analysiert die Faktoren, die zur demokratischen Stabilisierung beitragen.
Frieden
Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen von Rüstungskontrollregimen auf den internationalen Frieden. Es wird argumentiert, dass internationale Regime durch die Senkung von Transaktionskosten dauerhafte zwischenstaatliche Kooperationen und somit auch Frieden ermöglichen können. Die Arbeit analysiert die Bedingungen für die Regimebildung und -aufrechterhaltung und die Bedeutung der Kosten-Nutzen-Kalkulation für die Entscheidung von Staaten, an Rüstungskontrollregimen teilzunehmen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Vergleichenden Politikwissenschaft und der Internationalen Beziehungen. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Institutionen, Parlamentarismus, Präsidentialismus, demokratische Stabilität, Frieden, Rüstungskontrollregime, internationale Kooperation, Transaktionskosten, Kosten-Nutzen-Kalkulation.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Institutionen die demokratische Stabilität?
Die Arbeit untersucht, wie nationale Institutionen, insbesondere das Regierungssystem, zur Stabilisierung oder Destabilisierung einer Demokratie beitragen.
Warum gilt der Parlamentarismus als anpassungsfähiger als der Präsidentialismus?
Durch die Interdependenz von Exekutive und Legislative bietet das parlamentarische System mehr Flexibilität, um auf politische Krisen zu reagieren.
Welchen Einfluss haben Rüstungskontrollregime auf den Frieden?
Internationale Regime senken Transaktionskosten und ermöglichen dauerhafte Kooperationen, was zur Sicherung des internationalen Friedens beiträgt.
Was sind die Bedingungen für das Funktionieren von Institutionen?
Das Funktionieren hängt maßgeblich von Faktoren auf der Polity- und Politics-Ebene ab, wie etwa der politischen Kultur eines Landes.
Was versteht man unter der Polity-Dimension in diesem Kontext?
Nationale Institutionen werden als Manifestationen zentraler Verfassungsnormen definiert, die das Verhalten der politischen Akteure prägen.
- Quote paper
- Selina Thal (Author), 2008, Nationale und internationale Institutionen. Auswirkungen, Bedingungen und Dysfunktionalitäten von parlamentarischen Regierungssystemen und Rüstungskontrollregimen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344350