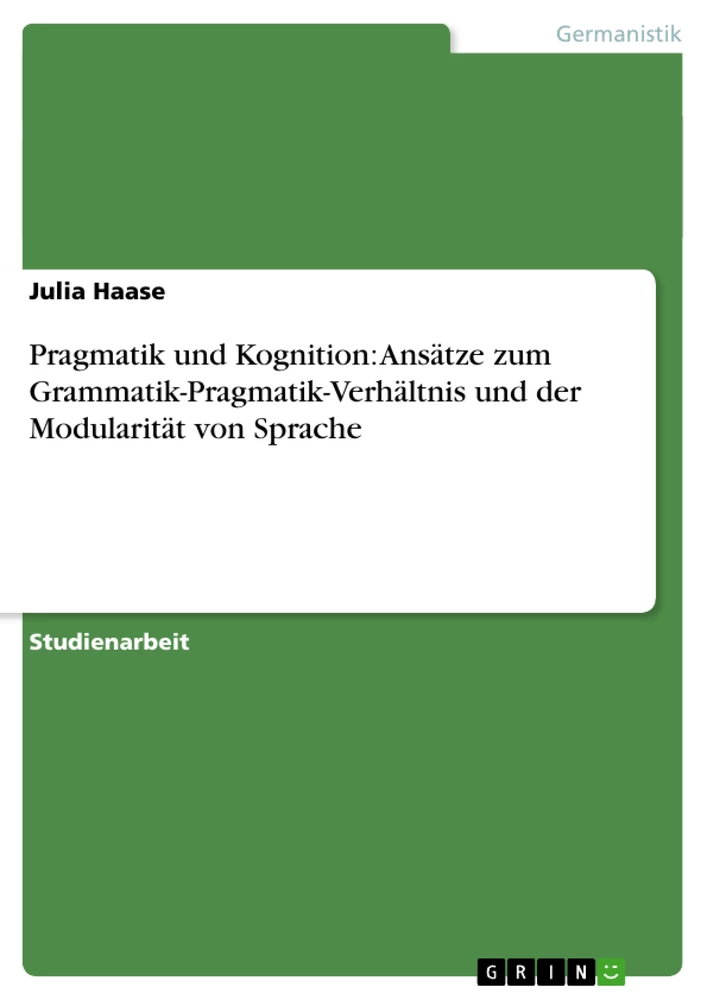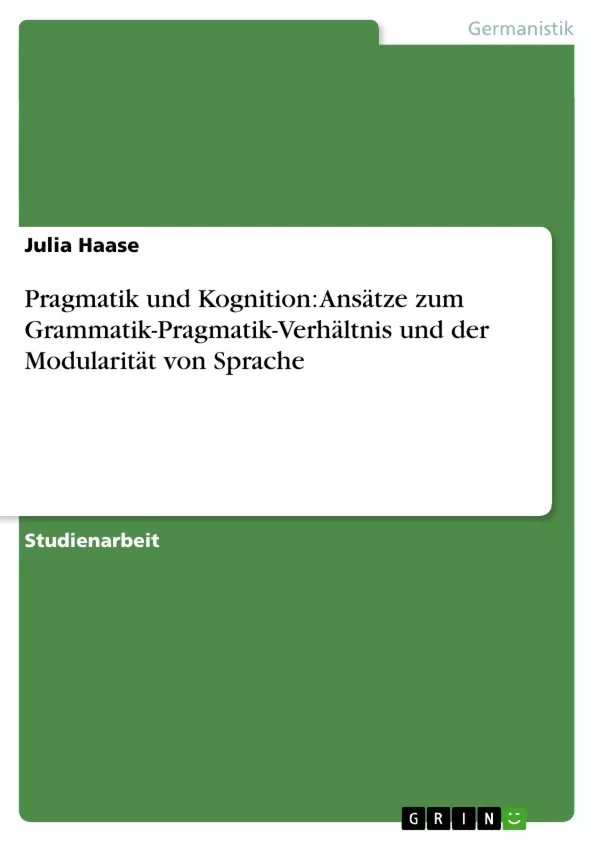„Sprache setzt sich aus Grammatik und Pragmatik zusammen. Die Grammatik ist ein abstraktes, formales System, das zur Produktion und Interpretation von Aussagen dient. Die allgemeine Pragmatik ist eine Sammlung von Strategien und Grundsätzen zum Erreichen erfolgreicher Kommunikation mithilfe des Gebrauchs von Grammatik. Die Grammatik ist insofern angepasst, als dass sie Eigenschaften besitzt, welche die Benutzung pragmatischer Grundsätze erleichtern.“
Nicht alle Studien zum Grammatik-Pragmatik-Verhältnis gehen von einem solch engen Zusammenwirken von Grammatik und Pragmatik aus, wie Leech es in seinem Zitat deutlich werden lässt. Dennoch ist diese Problematik ein viel diskutiertes Thema der theoretischen Linguistik. In zahlreichen Ansätzen wird zu entdecken versucht, welche bzw. inwieweit Zusammenhänge zwischen diesen Teilgebieten der Sprache, der Grammatik und der Pragmatik, bestehen.
Noch vor wenigen Jahren fand sich in der linguistischen Forschung die Dichotomie zweier Ansichten über Sprache an sich. Der eine Ansatz sah Sprache als primär kognitives, grammatisch geprägtes Phänomen. Der funktionale, pragmatische Anteil wurde als nachrangig eingestuft. Sprache wird demnach hier als Teil der Kognition verstanden. Die andere Denkweise verhielt sich der erstgenannten genau gegensetzlich. Denn hier gilt Sprache als grundsätzlich sozial determiniert und pragmatisch geprägt. Sprache wird nach dieser zweiten Ansicht als Teil der Interaktion angesehen.
Nun wird nach einer Überbrückung dieser antagonistischen Sprachauffassungen gesucht. So ist die Hypothese entstanden, gemäß der Sprachkenntnis als kognitive Erscheinung begriffen wird, welche jedoch die Behauptung einer sozialen Determination nicht ausschließt. Der Ausgangspunkt dieser Hypothese ist die Annahme einer prinzipiellen Integrierbarkeit von grammatischen und pragmatischen Prägungen der Sprachkenntnis und –verwendung sowie die Frage, zu welchem Anteil beide Arten von Faktoren an sprachlichen Phänomenen beteiligt sind. Welches Verhältnis besteht nun also zwischen Grammatik und Pragmatik? Eine dominante Auffassung zu dieser Fragestellung besagt, dass Sprachkenntnis auf interagierenden Modulen begründet sei. Somit würde es sich bei Grammatik und Pragmatik um zwei eigenständige, aber miteinander interagierende Teilsysteme handeln.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Grammatik als mentales Phänomen – Pragmatik als soziales Phänomen
- Pragmatik als Submodul der Grammatik?
- Pragmatik und Kognition
- Ein interdisziplinärer Forschungsansatz zur Modularität von Sprache
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Grammatik und Pragmatik in der Linguistik. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze, die Sprache entweder als primär kognitives oder soziales Phänomen betrachten, und sucht nach einer Integration beider Perspektiven. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Konzept der Modularität von Sprache und der Frage, ob Grammatik und Pragmatik als eigenständige Module oder als interagierende Teilsysteme zu verstehen sind.
- Das Grammatik-Pragmatik-Verhältnis in der Linguistik
- Konträre Auffassungen von Sprache als kognitives vs. soziales Phänomen
- Das Konzept der Modularität in der Sprachwissenschaft
- Interaktion von Grammatik und Pragmatik als interagierende Module
- Interdisziplinäre Forschungsansätze zur Modularität von Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik des Grammatik-Pragmatik-Verhältnisses ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zusammenhang und der Interaktion beider Bereiche dar. Es skizziert die bestehenden gegensätzlichen Ansichten in der Linguistik und kündigt den Versuch einer Integration dieser Perspektiven an. Der einleitende Auszug von Leech verdeutlicht die enge Verzahnung von Grammatik und Pragmatik für erfolgreiche Kommunikation, ein Ansatz, der im weiteren Verlauf der Arbeit diskutiert und kritisch beleuchtet wird.
Grammatik als mentales Phänomen – Pragmatik als soziales Phänomen: Dieses Kapitel präsentiert die traditionellen, gegensätzlichen Positionen von Formalisten (z.B. Chomsky) und Funktionalisten zur Natur von Sprache. Formalisten betrachten Sprache als primär kognitives, grammatisch geprägtes Phänomen, das auf einer angeborenen Fähigkeit basiert. Funktionalisten hingegen betonen den pragmatischen Aspekt und sehen Sprache als soziales Phänomen, das sich aus kommunikativen Bedürfnissen entwickelt. Das Kapitel stellt diese gegensätzlichen Standpunkte dar und bereitet den Weg für die Suche nach einer Synthese dieser Perspektiven.
Pragmatik als Submodul der Grammatik?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage der Modularität von Sprache und der Abgrenzung von Grammatik und Pragmatik. Es definiert den Begriff der Modularität und untersucht verschiedene Interpretationen dieses Konzepts. Die zentrale Frage ist, ob Pragmatik ein Submodul der Grammatik ist oder ein eigenständiges Modul darstellt. Die Diskussion beinhaltet die Abgrenzung von Kompetenz und Performanz und argumentiert gegen eine strikte Trennung von Grammatik und Pragmatik aufgrund ihrer Interdependenz in der Kommunikation, wie es in dem Zitat von Harnish/Farmer hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Grammatik, Pragmatik, Modularität, Sprache, Kognition, Interaktion, Formalismus, Funktionalismus, Sprachkompetenz, Sprachperformanz, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Grammatik und Pragmatik – Ein interdisziplinärer Forschungsansatz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das komplexe Verhältnis zwischen Grammatik und Pragmatik in der Linguistik. Sie analysiert verschiedene Ansätze, die Sprache entweder als kognitives oder soziales Phänomen betrachten, und sucht nach einer integrierten Perspektive, die beide Sichtweisen berücksichtigt. Ein zentraler Fokus liegt auf dem Konzept der Modularität der Sprache und der Frage, ob Grammatik und Pragmatik als separate Module oder interagierende Teilsysteme zu verstehen sind.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die folgenden Schwerpunktthemen: das Grammatik-Pragmatik-Verhältnis in der Linguistik, gegensätzliche Auffassungen von Sprache als kognitives versus soziales Phänomen, das Konzept der Modularität in der Sprachwissenschaft, die Interaktion von Grammatik und Pragmatik als interagierende Module und interdisziplinäre Forschungsansätze zur Modularität von Sprache.
Welche gegensätzlichen Positionen werden dargestellt?
Die Arbeit stellt die traditionellen, gegensätzlichen Positionen von Formalisten (z.B. Chomsky) und Funktionalisten dar. Formalisten betrachten Sprache primär als kognitives, grammatisch geprägtes Phänomen, während Funktionalisten den pragmatischen Aspekt betonen und Sprache als soziales Phänomen sehen, das sich aus kommunikativen Bedürfnissen entwickelt. Die Arbeit versucht, diese gegensätzlichen Standpunkte zu synthetisieren.
Wie wird das Konzept der Modularität behandelt?
Das Kapitel zur Modularität untersucht verschiedene Interpretationen dieses Konzepts und befasst sich mit der Frage, ob Pragmatik ein Submodul der Grammatik oder ein eigenständiges Modul darstellt. Es diskutiert die Abgrenzung von Kompetenz und Performanz und argumentiert gegen eine strikte Trennung von Grammatik und Pragmatik aufgrund ihrer Interdependenz in der Kommunikation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält ein Vorwort, Kapitel zu Grammatik als mentales und Pragmatik als soziales Phänomen, Pragmatik als mögliches Submodul der Grammatik, Pragmatik und Kognition, einen interdisziplinären Forschungsansatz zur Modularität von Sprache und eine Schlussbetrachtung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grammatik, Pragmatik, Modularität, Sprache, Kognition, Interaktion, Formalismus, Funktionalismus, Sprachkompetenz, Sprachperformanz, Kommunikation.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie Grammatik und Pragmatik zusammenhängen und miteinander interagieren. Die Arbeit sucht nach einer Erklärung für den Zusammenhang und die Interaktion beider Bereiche.
- Citation du texte
- Julia Haase (Auteur), 2003, Pragmatik und Kognition: Ansätze zum Grammatik-Pragmatik-Verhältnis und der Modularität von Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34444