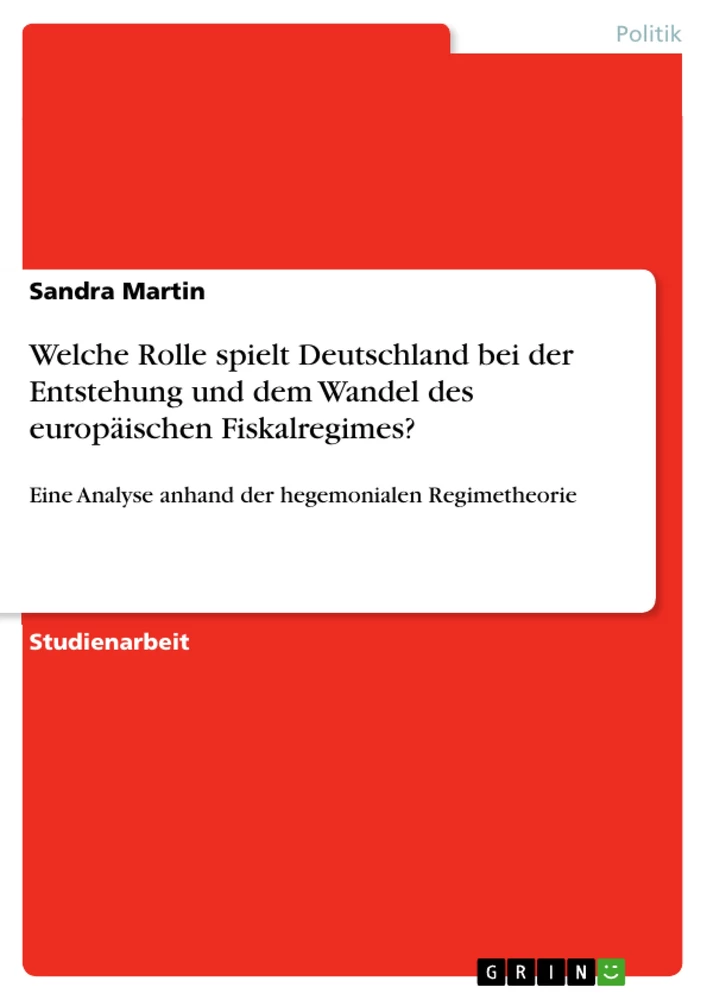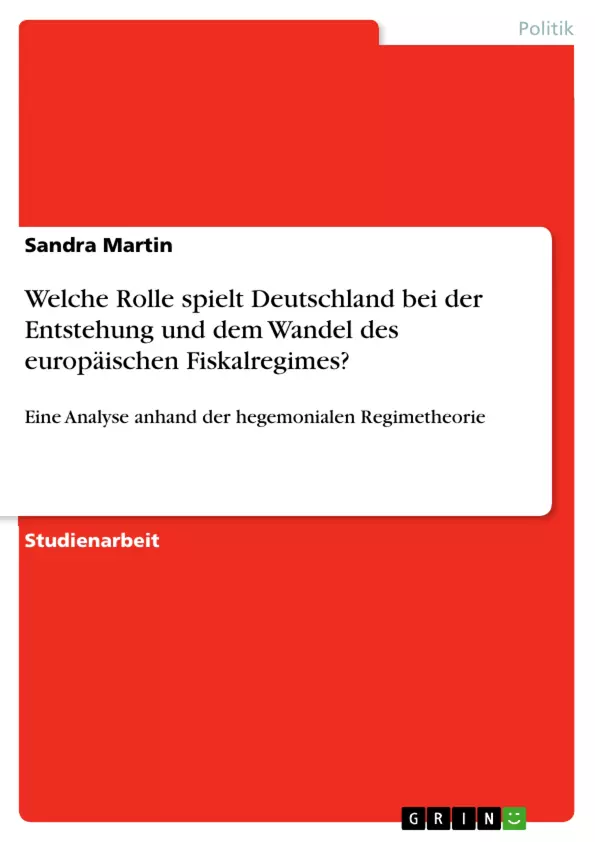„Die Eurokrise ist zur chronischen Krankheit geworden“ (Münchau, 18.08.2014). Seit dem Beginn der Eurokrise 2009 ist die europäische Gemeinschaftswährung in dauerhafter Kritik. Die Befürchtungen, die vor der Einführung des Euros bestanden, haben sich heutzutage zum großen Teil bewahrheitet. Die europäische Gemeinschaftswährung ist von Instabilität gekennzeichnet, eine Vielzahl von Euroländern weisen eine hohe Staatsverschuldung auf. Diese negative Entwicklung des Euros konnte auch durch den eigens dafür geschaffenen Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht verhindert werden. Entstanden ist der Stabilitätspakt im Jahr 1997 mit dem Ziel die Budgetdisziplin der Mitgliedstaaten der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion zu sichern und so die Stabilität der Gemeinschaftswährung zu garantieren. Diesem Anspruch konnte der Pakt offensichtlich nicht gerecht werden. Blickt man zurück in die Vergangenheit, so zeigt sich, dass der Stabilitätspakt einen sehr wechselhaften Verlauf aufweist. Seine Wirkungslosigkeit bewies der Pakt erstmalig im Jahr 2003. Zwei Jahre später wurde der Pakt durch eine Reform zusätzlich geschwächt. Erst mit der zweiten Reform im Jahr 2011 veränderte sich der Stabilitätspakt wieder dahingehend, sodass eine fiskalische Disziplinierung der Eurostaaten wieder realisierbar erschien. Wie ist diese wechselhafte Entwicklung des Stabilitäts- und Wachstumspakte zu erklären?
Im Zusammenhang mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt kommt Deutschland eine besondere Rolle zu. Grund hierfür ist ihre dominante Position die die Bundesrepublik innerhalb der Europäischen Union (EU) einnimmt.
Eine politikwissenschaftliche Erklärung für den Zusammenhang zwischen der Herausbildung internationaler Kooperation und Hegemonie liefert die hegemoniale Regimetheorie. Diese erklärt die Entstehung und Veränderung internationaler Regime anhand der relativen Machtverteilung im internationalen System. Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen ob die Entwicklung des europäischen Stabilitätspaktes - von seiner Entstehung, über das Scheitern, bis zur Reform 2011 - anhand der hegemonialen Regimetheorie erklärt werden kann. Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet daher: Ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt ein hegemoniales Regime, dessen Entstehung von Deutschland, als wirtschaftliche Hegemonialmacht Europas gefördert und dessen anschließende Entwicklung von deutschem Interesse determiniert wurde?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie der Hegemonialen Stabilität
- Deutschlands Hegemoniale Stellung innerhalb der Wirtschafts- und Währungsunion
- Das Europäische Fiskalregimes
- Der Stabilitäts- und Wachstumspakt als europäisches Fiskalregime
- Die Entstehung des europäischen Fiskalregimes
- Das Versagen des europäischen Fiskalregimes
- Die Schwächung des europäischen Fiskalregimes
- Die Härtung des europäischen Fiskalregimes
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, ob die Entwicklung des europäischen Stabilitätspaktes – von seiner Entstehung über das Scheitern bis zur Reform 2011 – anhand der hegemonialen Regimetheorie erklärt werden kann. Die Forschungsfrage lautet daher: Ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt ein hegemoniales Regime, dessen Entstehung von Deutschland, als wirtschaftliche Hegemonialmacht Europas, gefördert und dessen anschließende Entwicklung von deutschem Interesse determiniert wurde?
- Die Theorie der Hegemonialen Stabilität als Erklärungsansatz für die Entstehung und Veränderung internationaler Regime.
- Die Rolle Deutschlands als wirtschaftliche Hegemonialmacht innerhalb der Europäischen Union.
- Der Stabilitäts- und Wachstumspakt als europäisches Fiskalregime und seine Bedeutung für die europäische Wirtschafts- und Währungsunion.
- Die Entwicklung des Stabilitätspaktes: Entstehung, Scheitern und Reformen.
- Die Anwendung der hegemonialen Regimetheorie auf die Entwicklung des Stabilitätspaktes.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der europäischen Fiskalpolitik und die Rolle Deutschlands im Zusammenhang mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt ein. Kapitel 2 erläutert die Theorie der Hegemonialen Stabilität als theoretisches Fundament der Arbeit. Kapitel 3 analysiert Deutschlands wirtschaftliche Hegemonialstellung innerhalb der Europäischen Union. Kapitel 4 beleuchtet den Stabilitäts- und Wachstumspakt als europäisches Fiskalregime, seine Entstehung, sein Versagen, seine Schwächung und seine Härtung. Die Zusammenfassung und das Fazit fassen die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der europäischen Fiskalpolitik, dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, der hegemonialen Regimetheorie, Deutschlands wirtschaftlicher Hegemonialstellung innerhalb der Europäischen Union und der Eurokrise.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts?
Der Pakt wurde 1997 geschaffen, um die Budgetdisziplin der EU-Mitgliedstaaten zu sichern und die Stabilität der Gemeinschaftswährung Euro zu garantieren.
Welche Rolle spielt Deutschland im europäischen Fiskalregime?
Aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke nimmt Deutschland eine hegemoniale Stellung ein. Die Arbeit untersucht, ob Deutschland die Entwicklung des Paktes nach seinen eigenen Interessen determiniert hat.
Was besagt die Theorie der Hegemonialen Stabilität?
Diese Regimetheorie erklärt die Entstehung und Stabilität internationaler Kooperationen durch die Existenz einer Führungsmacht (Hegemon), die Regeln durchsetzt und das System stabilisiert.
Warum wird von einem „Versagen“ des Stabilitätspakts gesprochen?
Der Pakt erwies sich ab 2003 als wirkungslos, als Defizitverfahren gegen große Länder (wie Deutschland und Frankreich) ausgesetzt wurden, was die fiskalische Disziplin schwächte.
Wie wurde der Pakt im Jahr 2011 reformiert?
Durch die Reform (oft als „Six-Pack“ bekannt) wurde der Pakt „gehärtet“, um eine striktere Überwachung und automatischere Sanktionen bei Verstößen gegen die Defizitregeln zu ermöglichen.
- Quote paper
- Sandra Martin (Author), 2014, Welche Rolle spielt Deutschland bei der Entstehung und dem Wandel des europäischen Fiskalregimes?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344512