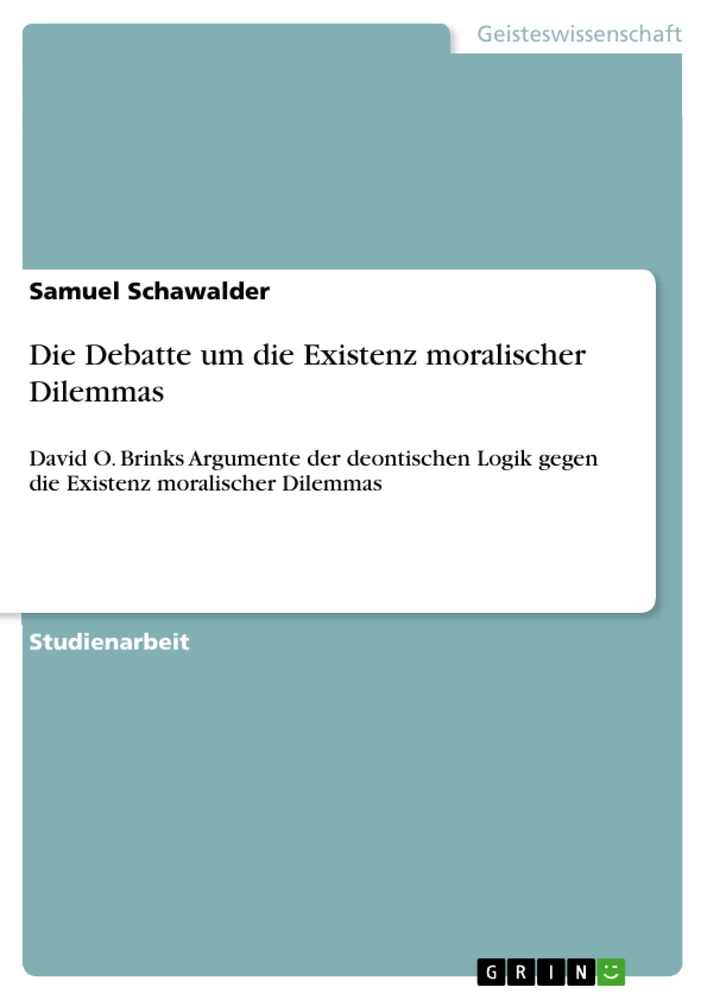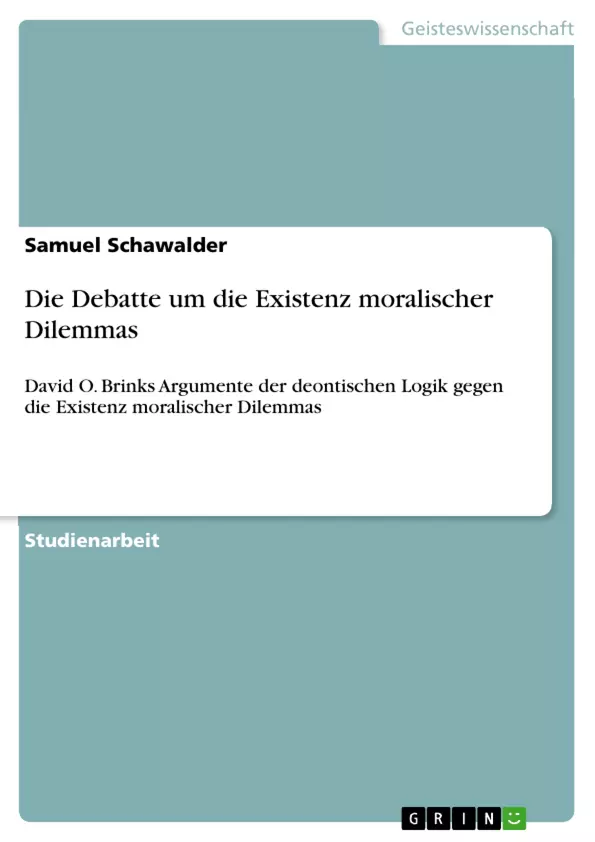Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob die den Argumenten der Dilemma-Gegner zugrundeliegenden Prinzipien deontischer Logik wirklich unkontrovers sind. Dabei werde ich aufzuzeigen versuchen, dass die betreffenden Prinzipien keinesfalls so unkontrovers sind, wie Dilemma-Gegner gerne behaupten.
November 1940: Seit knapp einem Jahr tobt der Zweite Weltkrieg über Europa. Bereits Anfang 1940 ist es den Briten gelungen, den deutschen Funkcode zu entschlüsseln. Winston Churchill erfährt dank der Entschlüsselung des deutschen Enigma-Codes von der Operation Mondscheinsonate. Unter diesem Decknamen plant die deutsche Luftwaffe am Abend des 14. Novembers einen Luftangriff auf die britische Industriestadt Coventry. Im Wissen des bevorstehenden deutschen Luftangriffs steht Winston Churchill vor einer schweren Entscheidung: Soll er Coventry evakuieren um so die Bewohner der Stadt zu retten? Wenn er dies täte, würden die Deutschen herausfinden, dass ihr Funkcode geknackt worden ist. In der Folge wären die Alliierten nicht mehr in der Lage die deutschen Funksprüche zu entschlüsseln und man gäbe damit ein wichtiges Mittel im Kampf für ein baldiges Kriegsende und die Rettung unzähliger weiterer Menschenleben aus der Hand. Doch sollte Churchill die Stadt nicht evakuieren, so würde er viele Einwohner von Coventry dem sicheren Tode überlassen. Was hätte Winston Churchill tun sollen?
Hinter all diesen Fragen verbirgt sich die Debatte um die Existenz moralischer Dilemmata. Wenn es – wie viele Philosophinnen und Philosophen denken – moralische Dilemmata gar nicht geben kann, so ist entweder die Rettung der Einwohner von Coventry oder die Nichtevakuierung der Einwohner von Coventry Churchills moralische Pflicht. Wenn es allerdings – wie einige andere Philosophinnen und Philosophen denken – moralische Dilemmata geben sollte, so ist sowohl die Rettung der Einwohner von Coventry als auch die Nichtevakuierung der Einwohner von Coventry Churchills moralische Pflicht. Doch kann es überhaupt sein, dass es Situationen geben soll, in welcher jemand moralisch verpflichtet ist, eine Handlung A zu tun und moralisch verpflichtet ist eine Handlung B zu tun, obwohl die- oder derjenige unmöglich sowohl A als auch B tun kann? Mit andern Worten, ist es möglich, dass es Situationen gibt, in welcher moralische Pflichten so miteinander in Widerspruch geraten, dass jemand sich letztlich dazu gezwungen sieht, eine ihrer bzw. seiner Pflichten zu verletzen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Debatte um die Existenz moralischer Dilemmas
- Was sind moralische Dilemmas?
- Argumente der deontischen Logik gegen die Existenz moralische Dilemmas
- Paradox 1
- Das Agglomerationsprinzip
- Ought implies Can
- Paradox 2 & 3
- Obligation Execution Principle
- Weak Obligation-, Weak Impermissibility- & Correlativity Principle
- Ausblick: Wie soll die Debatte weitergehen?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob die Existenz moralischer Dilemmas mit gängigen Prinzipien der deontischen Logik vereinbar ist. Im Fokus stehen die Argumente von David O. Brink, der drei Paradoxien aufzeigt, die angeblich einen Widerspruch zwischen der Existenz moralischer Dilemmas und der Gültigkeit dieser Prinzipien belegen.
- Die Definition und Charakterisierung moralischer Dilemmas
- Die Kritik der deontischen Logik an der Existenz moralischer Dilemmas
- Die Analyse der von David O. Brink vorgebrachten Paradoxien
- Die Frage nach der Kontroversität der in den Argumenten der Dilemma-Gegner verwendeten moralischen Prinzipien
- Die zukünftige Ausrichtung der Debatte um die Existenz moralischer Dilemmas
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Seminararbeit vor und führt mit dem Beispiel von Winston Churchill im Zweiten Weltkrieg das Konzept des moralischen Dilemmas ein.
Das Kapitel „Die Debatte um die Existenz moralischer Dilemmas“ definiert den Begriff des moralischen Dilemmas anhand verschiedener Definitionen und beleuchtet die Argumente der Dilemma-Gegner gegen deren Existenz.
Das Kapitel „Argumente der deontischen Logik gegen die Existenz moralische Dilemmas“ analysiert die von David O. Brink vorgebrachten Paradoxien, welche die Unvereinbarkeit von moralischen Dilemmas mit den Prinzipien der deontischen Logik belegen sollen. Die Analyse konzentriert sich auf die einzelnen Paradoxien und die zugrundeliegenden moralischen Prinzipien.
Das Kapitel „Ausblick: Wie soll die Debatte weitergehen?“ diskutiert die zukünftige Ausrichtung der Debatte um die Existenz moralischer Dilemmas und stellt den Ansatz von Terrence McConnell vor, der den Fokus auf die Kriterien für eine gute moralische Theorie lenkt.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Thema der moralischen Dilemmas, insbesondere mit den Argumenten der deontischen Logik gegen deren Existenz. Zentrale Konzepte sind die Paradoxien von David O. Brink, die Prinzipien der deontischen Logik, die Frage nach der Kontroversität dieser Prinzipien und die zukünftige Ausrichtung der Debatte um moralische Dilemmas.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein moralisches Dilemma?
Eine Situation, in der eine Person verpflichtet ist, Handlung A und Handlung B zu tun, es aber unmöglich ist, beide gleichzeitig auszuführen.
Welches historische Beispiel wird zur Veranschaulichung genutzt?
Winston Churchills Entscheidung im Zweiten Weltkrieg, ob er die Stadt Coventry evakuieren sollte (was den Enigma-Code verraten hätte) oder nicht.
Warum lehnen manche Philosophen die Existenz von Dilemmas ab?
Dilemma-Gegner argumentieren mit Prinzipien der deontischen Logik, wie „Sollen impliziert Können“, die logische Widersprüche in Dilemmas sehen.
Was sind die Paradoxien von David O. Brink?
Brink zeigt drei Paradoxien auf, die belegen sollen, dass moralische Dilemmas mit gängigen logischen Prinzipien (wie dem Agglomerationsprinzip) unvereinbar sind.
Ist die Debatte um moralische Dilemmas abgeschlossen?
Nein, die Arbeit zeigt auf, dass die zugrunde liegenden logischen Prinzipien keineswegs so unkontrovers sind, wie oft behauptet wird.
- Quote paper
- Samuel Schawalder (Author), 2012, Die Debatte um die Existenz moralischer Dilemmas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344514