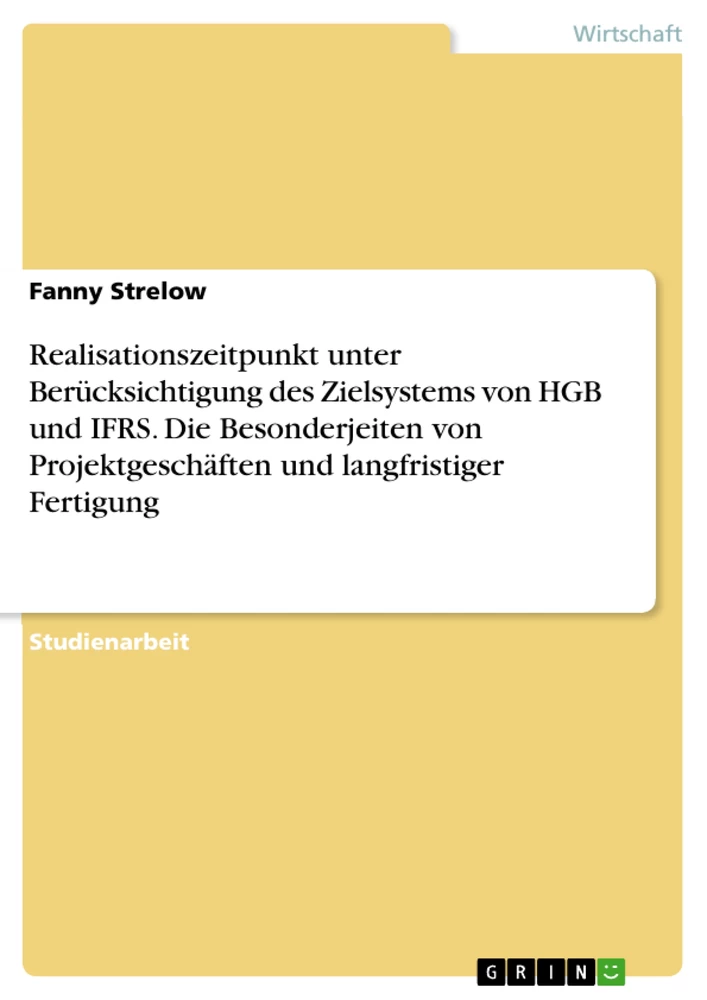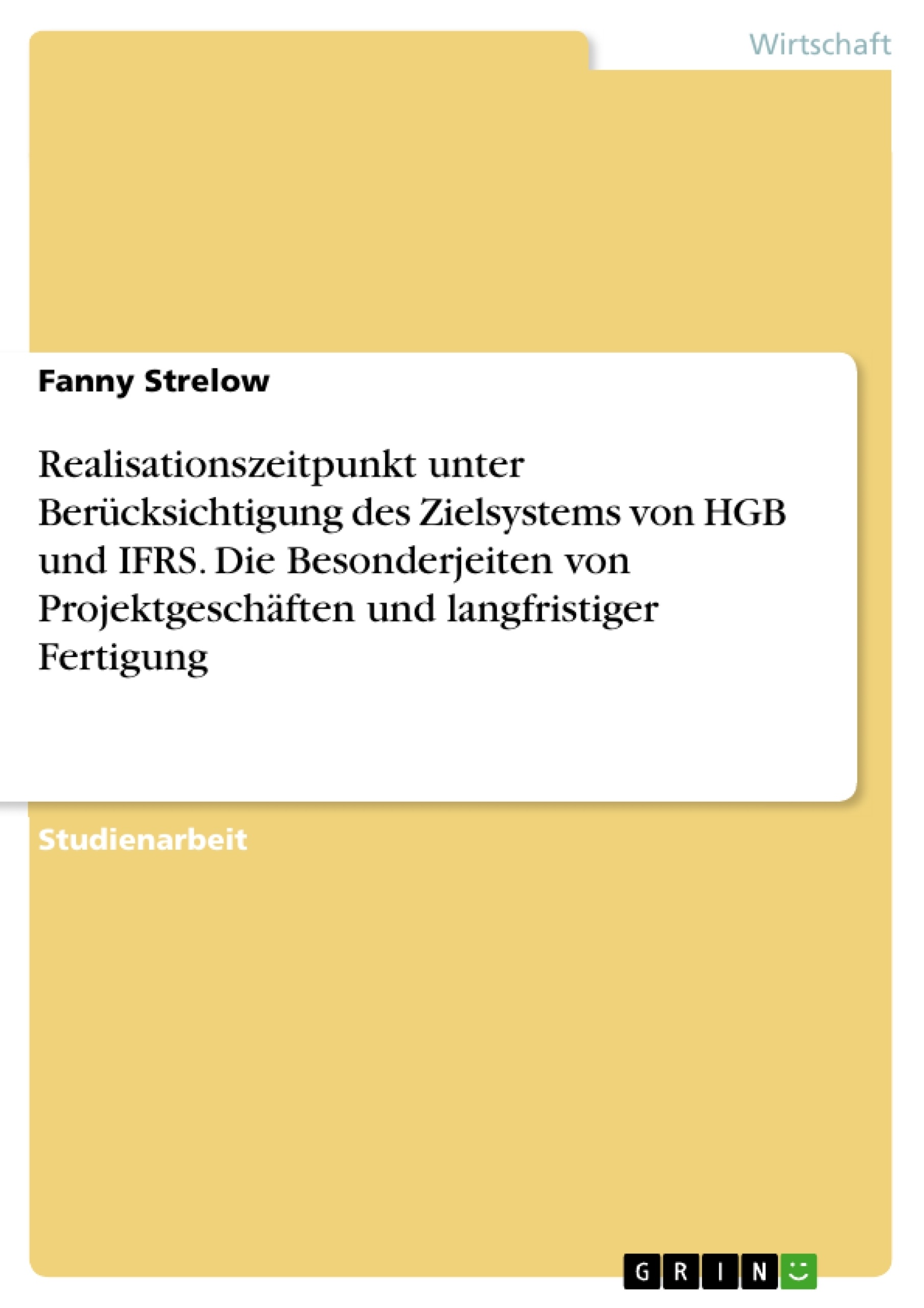Unabhängig vom betrachteten Rechnungslegungssystem kommt dem Realisationszeitpunkt von Umsätzen eine große Bedeutung zu, da dieser direkten Einfluss auf die Höhe der absoluten Kennzahl der Umsatzerlöse einer jeweiligen Periode hat. Mittelbar beeinflusst er damit auch die Ausprägung abgeleiteter Kennzahlen wie EBIT oder die Umsatzrentabilität. Somit prägt der bilanzielle Ausweis von Umsatzerlösen die Wahrnehmung des Unternehmenserfolgs bei seinen Stakeholdern. Es ergibt sich an dieser Stelle für die Unternehmensleitung der Anreiz, mögliche bilanzpolitische Spielräume auszunutzen und earnings management zu betreiben, da jede der Kennzahlen bedeutende Parameter der externen Bilanzanalyse darstellen.
HGB und IFRS leiten den maßgeblichen Zeitpunkt der Ertragsrealisation aus verschiedenen Grundsätzen ab: im deutschen Handelsrecht fußt er auf dem Vorsichtsprinzip des § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB. Demnach sind vorhersehbare nicht realisierte Verluste bereits in der Periode zu erfassen, in der sie bekannt werden (Imparitätsprinzip), Gewinne allerdings nur zu berücksichtigen, wenn sie zum Abschlussstichtag realisiert sind (Realisationsprinzip). Die IFRS stellen hingegen auf eine periodengerechte Erfassung von Erträgen und Aufwendungen ab (accrual accounting); einen mit dem handelsrechtlichen Grundsatz der vorsichtigen Bewertung vergleichbaren Ansatz gibt es nicht.
Die vorliegende Seminararbeit wird beide Ansätze vor dem Hintergrund der jeweiligen Zielsetzung des Rechnungslegungssystems methodisch erläutern und insbesondere vor dem Hintergrund der Besonderheiten von Projektgeschäften und langfristigen Fertigungen kritisch hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Zielstellung
- 2. Zwecke und Ziele der Rechnungslegung
- 2.1 HGB
- 2.2 IFRS
- 3. Grundsätze der Umsatzrealisation
- 3.1 Realisationsprinzip nach § 252 Abs. 1 Nr. 4 HS 2 HGB
- 3.2 Ertragsrealisation im Rahmen der IFRS - IAS 18
- 4. Methoden zur Bilanzierung von Projekten und langfristigen Fertigungsaufträgen
- 4.1 Completed Contract-Methode
- 4.2 Percentage of Completion-Methode
- 4.3 Erfolgsneutrale Ertragsrealisation
- 4.3.1 Zero Profit-Methode
- 4.3.2 Selbstkostenansatz
- 4.4 Teilgewinnrealisierung
- 5. Bilanzierung von Projektgeschäften und langfristigen Fertigungsaufträgen nach HGB
- 5.1 Anwendung des Realisationsprinzips
- 5.2 Begründeter Ausnahmefall gemäß § 252 Abs. 2 HGB
- 5.3 Kritische Würdigung
- 6. Bilanzierung von Projektgeschäften und langfristigen Fertigungsaufträgen nach IFRS
- 6.1 Fertigungsaufträge nach IAS 11
- 6.2 Kritische Würdigung
- 6.3 Ertragsrealisation nach IFRS 15 - ein Ausblick
- 6.3.1 Status quo
- 6.3.2 Anwendungsbereich des IFRS 15
- 6.3.3 Fünf Stufen-Modell der Umsatzrealisation
- 6.3.4 Auswirkungen auf die Bilanzierung von Fertigungsaufträgen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Realisationszeitpunkt von Umsätzen im Hinblick auf das deutsche Handelsgesetzbuch (HGB) und die International Financial Reporting Standards (IFRS). Im Fokus steht der Vergleich beider Systeme und deren Anwendung auf Projektgeschäfte und langfristige Fertigungsaufträge. Die Arbeit hinterfragt kritisch die jeweiligen methodischen Ansätze und deren Auswirkungen auf die Unternehmensberichterstattung.
- Vergleich des Realisationsprinzips nach HGB und IFRS
- Methoden zur Bilanzierung von Projekten und langfristigen Fertigungsaufträgen
- Auswirkungen unterschiedlicher Bilanzierungsmethoden auf Kennzahlen
- Kritische Würdigung der jeweiligen Ansätze
- Ausblick auf IFRS 15
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Zielstellung: Die Einleitung betont die Bedeutung des Realisationszeitpunkts von Umsätzen für die Erfolgsmessung von Unternehmen und die unterschiedlichen Grundsätze im HGB und IFRS. Die Arbeit zielt darauf ab, beide Ansätze zu erläutern und kritisch im Kontext von Projektgeschäften und langfristiger Fertigung zu hinterfragen. Die Auswirkungen auf Kennzahlen wie EBIT und die Umsatzrentabilität werden als zentrale Aspekte hervorgehoben.
2. Zwecke und Ziele der Rechnungslegung: Dieses Kapitel analysiert die Zielsetzungen der Rechnungslegung nach HGB und IFRS. Es hebt die fehlende übergeordnete Zielsetzung im HGB hervor und diskutiert die Vielzahl von Adressaten und deren unterschiedliche Informationsbedürfnisse. Die Bedeutung des Objektivierungsgrundsatzes und der Vergangenheitsorientierung im HGB wird erläutert, ebenso wie die Rolle des handelsrechtlichen Jahresabschlusses für die Gewinnverteilung und Steuerbemessung. Der starke Gläubigerschutzgedanke des HGB wird als ein wichtiger Aspekt hervorgehoben.
3. Grundsätze der Umsatzrealisation: Dieses Kapitel beschreibt die Grundsätze der Umsatzrealisation nach HGB (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HS 2 HGB) und IFRS (IAS 18). Es vergleicht das Realisationsprinzip des HGB mit dem accrual accounting der IFRS, wobei die unterschiedlichen Ansätze im Umgang mit Gewinnen und Verlusten deutlich werden. Der vorsichtige Ansatz des HGB im Gegensatz zum periodengerechten Ansatz der IFRS wird herausgestellt.
4. Methoden zur Bilanzierung von Projekten und langfristigen Fertigungsaufträgen: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Methoden zur Bilanzierung von Projekten und langfristigen Fertigungsaufträgen, wie die Completed Contract-Methode, die Percentage of Completion-Methode und die erfolgsneutrale Ertragsrealisierung (Zero Profit-Methode und Selbstkostenansatz). Es erklärt die jeweiligen Vor- und Nachteile der Methoden und ihre Anwendung in unterschiedlichen Kontexten. Die Teilgewinnrealisierung wird als zusätzliche Methode im Zusammenhang mit langfristigen Projekten vorgestellt.
5. Bilanzierung von Projektgeschäften und langfristigen Fertigungsaufträgen nach HGB: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Anwendung des Realisationsprinzips im HGB auf Projektgeschäfte und langfristige Fertigungsaufträge. Es erklärt die Anwendung der Prinzipien und betrachtet Ausnahmeregelungen gemäß § 252 Abs. 2 HGB. Eine kritische Würdigung der Anwendung im Kontext der betrachteten Methoden wird ebenfalls vorgestellt.
6. Bilanzierung von Projektgeschäften und langfristigen Fertigungsaufträgen nach IFRS: Dieses Kapitel behandelt die Bilanzierung nach IFRS, insbesondere die Anwendung von IAS 11 auf Fertigungsaufträge. Es beinhaltet eine kritische Würdigung des IFRS-Ansatzes und einen Ausblick auf IFRS 15, einschließlich des fünfstufigen Modells der Umsatzrealisierung und dessen Auswirkungen auf die Bilanzierung von Fertigungsaufträgen.
Schlüsselwörter
Realisationsprinzip, HGB, IFRS, Projektgeschäfte, langfristige Fertigung, Umsatzerlöse, Bilanzierung, Ertragsrealisation, Kennzahlen, Vorsichtsprinzip, accrual accounting, IAS 11, IFRS 15, Bilanzpolitik, Earnings Management.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Realisationszeitpunkt von Umsätzen nach HGB und IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Realisationszeitpunkt von Umsätzen im Vergleich des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) und der International Financial Reporting Standards (IFRS), insbesondere im Kontext von Projektgeschäften und langfristigen Fertigungsaufträgen. Sie analysiert die jeweiligen methodischen Ansätze, deren Auswirkungen auf die Unternehmensberichterstattung und kritisch deren Vor- und Nachteile.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Zwecke und Ziele der Rechnungslegung nach HGB und IFRS, die Grundsätze der Umsatzrealisation beider Systeme, verschiedene Bilanzierungsmethoden für Projekte und langfristige Fertigungsaufträge (Completed Contract-Methode, Percentage of Completion-Methode, erfolgsneutrale Ertragsrealisierung, Teilgewinnrealisierung), die praktische Anwendung dieser Methoden nach HGB und IFRS und einen Ausblick auf IFRS 15.
Welche Bilanzierungsmethoden für Projekte und langfristige Fertigungsaufträge werden verglichen?
Die Seminararbeit vergleicht die Completed Contract-Methode, die Percentage of Completion-Methode und die erfolgsneutrale Ertragsrealisierung (inklusive Zero Profit-Methode und Selbstkostenansatz). Zusätzlich wird die Teilgewinnrealisierung als weitere Methode behandelt.
Wie werden die Unterschiede zwischen HGB und IFRS in Bezug auf die Umsatzrealisation dargestellt?
Die Arbeit vergleicht das Realisationsprinzip des HGB mit dem accrual accounting der IFRS, wobei die unterschiedlichen Ansätze im Umgang mit Gewinnen und Verlusten und der Unterschied zwischen dem vorsichtigen Ansatz des HGB und dem periodengerechten Ansatz der IFRS deutlich herausgearbeitet werden.
Welche Rolle spielt IFRS 15 in der Seminararbeit?
IFRS 15 wird im Ausblick behandelt. Der Status quo, der Anwendungsbereich, das fünfstufige Modell der Umsatzrealisation und die Auswirkungen auf die Bilanzierung von Fertigungsaufträgen werden erläutert.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung und Zielstellung, Zwecke und Ziele der Rechnungslegung, Grundsätze der Umsatzrealisation, Methoden zur Bilanzierung von Projekten und langfristigen Fertigungsaufträgen, Bilanzierung nach HGB und Bilanzierung nach IFRS (inkl. Ausblick auf IFRS 15).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Realisationsprinzip, HGB, IFRS, Projektgeschäfte, langfristige Fertigung, Umsatzerlöse, Bilanzierung, Ertragsrealisation, Kennzahlen, Vorsichtsprinzip, accrual accounting, IAS 11, IFRS 15, Bilanzpolitik, Earnings Management.
Welche Auswirkungen der unterschiedlichen Bilanzierungsmethoden auf Kennzahlen werden betrachtet?
Die Arbeit hebt die Auswirkungen unterschiedlicher Bilanzierungsmethoden auf Kennzahlen wie EBIT und die Umsatzrentabilität hervor.
Gibt es eine kritische Würdigung der behandelten Ansätze?
Ja, die Arbeit enthält kritische Würdigungen der Anwendung der Prinzipien nach HGB und IFRS im Kontext der betrachteten Methoden.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Die Seminararbeit ist relevant für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere im Bereich Rechnungswesen und Finanzmanagement, sowie für alle, die sich mit den Unterschieden zwischen HGB und IFRS bei der Bilanzierung von langfristigen Projekten befassen.
- Arbeit zitieren
- Fanny Strelow (Autor:in), 2015, Realisationszeitpunkt unter Berücksichtigung des Zielsystems von HGB und IFRS. Die Besonderjeiten von Projektgeschäften und langfristiger Fertigung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344517