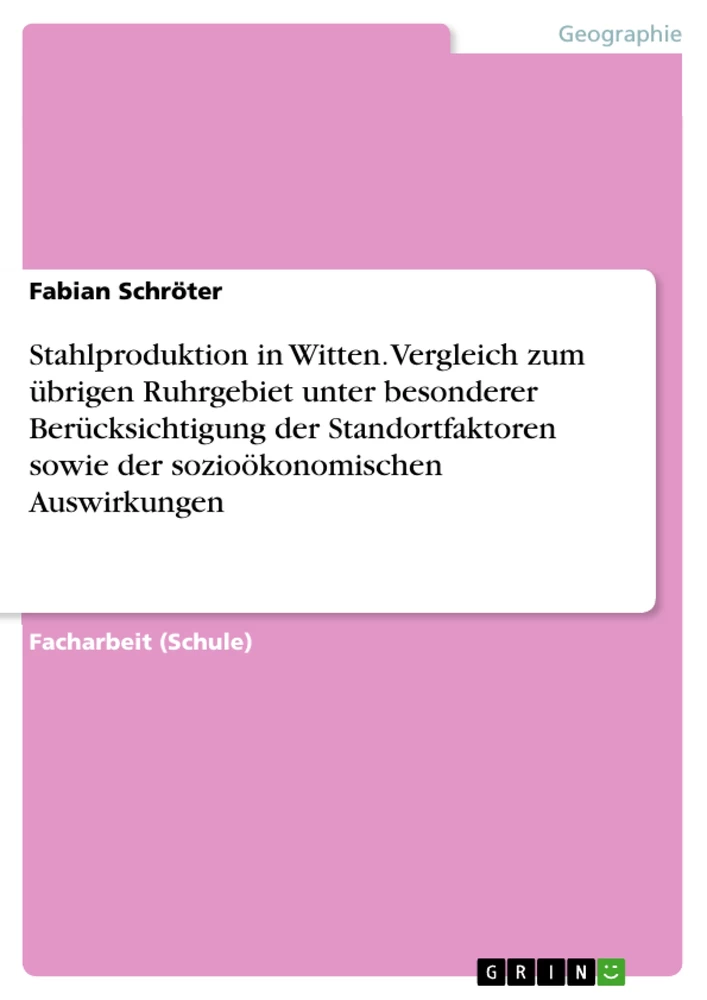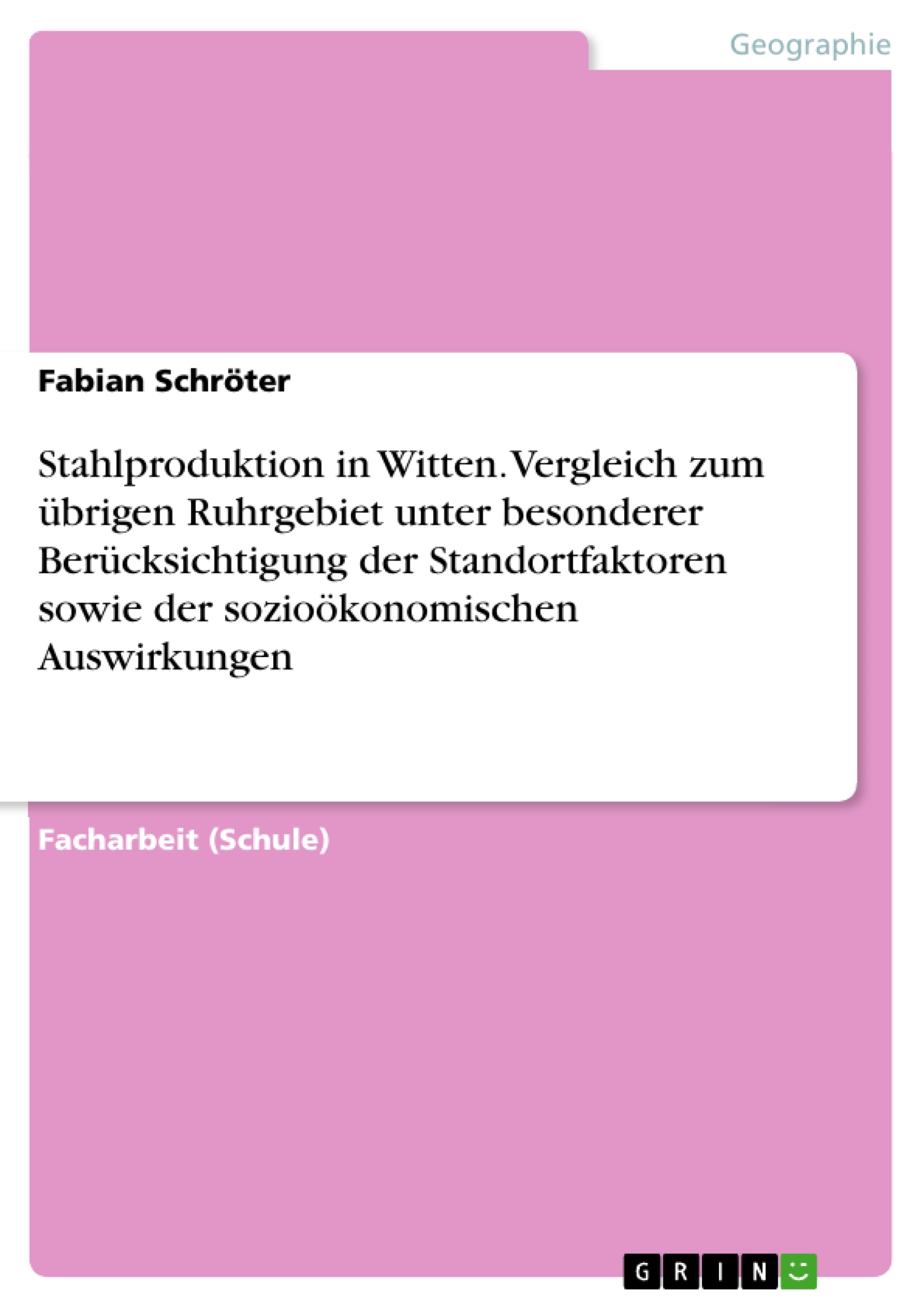Diese Facharbeit behandelt die Stahlproduktion in der Stadt Witten, einer mittelgroßen Industriestadt im östlichen Ruhrgebiet. Im Gegensatz zu umliegenden Städten wird in Witten noch immer Stahl gekocht. Bis auf Duisburg und Witten haben alle anderen Städte des Ruhrgebiets ihre Stahlwerke verloren. In dieser Arbeit soll die Frage beantwortet werden, welche Ursachen zur Erklärung dieses Phänomens herangezogen werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung im Ruhrgebiet
- Auswirkungen im Ruhrgebiet
- Entwicklung in Witten (Deutsche Edelstahlwerke)
- Werksgelände
- Verkehrsanbindung
- Produktionsverfahren
- Strom
- Rohstoffe
- Arbeitnehmer
- Produktpalette
- Auswirkungen in Witten
- Zusammenfassender Vergleich
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Stahlproduktion in Witten im Vergleich zum übrigen Ruhrgebiet. Der Fokus liegt auf der Deutschen Edelstahlwerke GmbH (DEW) und analysiert die Standortfaktoren sowie die sozioökonomischen Auswirkungen der Stahlindustrie auf die Region. Ziel ist es, die Entwicklung in Witten im Kontext der gesamtruhrgebietsweiten Veränderungen zu verstehen und zu erklären.
- Entwicklung der Stahlindustrie im Ruhrgebiet
- Standortfaktoren der Stahlproduktion in Witten
- Vergleich der Entwicklung in Witten mit dem übrigen Ruhrgebiet
- Sozioökonomische Auswirkungen der Stahlindustrie
- Zukunftsaussichten der Stahlproduktion in Witten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den krisenhaften Zustand der europäischen Stahlindustrie, insbesondere im Ruhrgebiet. Sie benennt Überkapazitäten und strengere Umweltschutzauflagen als Hauptgründe. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung der Stahlproduktion in Witten, speziell auf die Deutsche Edelstahlwerke (DEW), und vergleicht diese mit der Entwicklung im restlichen Ruhrgebiet, unter Berücksichtigung sozioökonomischer Auswirkungen.
Entwicklung im Ruhrgebiet: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Stahlindustrie im Ruhrgebiet vom Aufschwung im 19. Jahrhundert über die Bedeutung im Zweiten Weltkrieg bis zur Krise ab den 1970er Jahren. Es werden die Monostruktur der Ruhrgebietswirtschaft, die Nachkriegsentwicklung und das Wirtschaftswunder thematisiert. Der Konjunktureinbruch ab 1975 wird auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, darunter die Beendigung des Wiederaufbauzyklus, verschärfte internationale Konkurrenz und den Ersatz von Stahl durch andere Materialien. Das Kapitel beschreibt auch Rationalisierungsmaßnahmen, Standortverlagerungen und Werksschließungen, die die Struktur der Stahlindustrie tiefgreifend veränderten und zur Konzentration auf wenige, strategisch günstig gelegene Standorte führten. Die Vorteile „nasser Standorte“ (an schiffbaren Gewässern) werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Stahlproduktion, Ruhrgebiet, Witten, Deutsche Edelstahlwerke (DEW), Standortfaktoren, Sozioökonomie, Strukturwandel, Wirtschaftskrise, Industriemonostruktur, Konkurrenzfähigkeit, Umweltschutz.
FAQ: Entwicklung der Stahlproduktion in Witten und im Ruhrgebiet
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Stahlproduktion in Witten, insbesondere der Deutschen Edelstahlwerke (DEW), im Vergleich zum übrigen Ruhrgebiet. Der Fokus liegt auf den Standortfaktoren und den sozioökonomischen Auswirkungen der Stahlindustrie auf die Region.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Stahlindustrie im Ruhrgebiet vom Aufschwung bis zur Krise, die Standortfaktoren der Stahlproduktion in Witten, einen Vergleich der Entwicklung in Witten mit dem restlichen Ruhrgebiet, die sozioökonomischen Auswirkungen der Stahlindustrie und die Zukunftsaussichten der Stahlproduktion in Witten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Entwicklung im Ruhrgebiet, Auswirkungen im Ruhrgebiet, Entwicklung in Witten (Deutsche Edelstahlwerke) mit Unterkapiteln zu Werksgelände, Verkehrsanbindung, Produktionsverfahren, Strom, Rohstoffe, Arbeitnehmer, Produktpalette und Auswirkungen in Witten, sowie Zusammenfassender Vergleich und Ausblick.
Welche Gründe werden für die Krise der Stahlindustrie genannt?
Als Hauptgründe für die Krise der europäischen Stahlindustrie, insbesondere im Ruhrgebiet, werden Überkapazitäten und strengere Umweltschutzauflagen genannt. Zusätzlich werden im Kapitel zur Entwicklung im Ruhrgebiet Faktoren wie der Beendigung des Wiederaufbauzyklus, verschärfte internationale Konkurrenz und der Ersatz von Stahl durch andere Materialien genannt.
Welche Rolle spielt die Deutsche Edelstahlwerke (DEW) in dieser Arbeit?
Die Deutsche Edelstahlwerke GmbH (DEW) in Witten dient als Fallstudie, um die Entwicklung der Stahlproduktion in einer spezifischen Stadt im Kontext der gesamtruhrgebietsweiten Veränderungen zu analysieren.
Welche sozioökonomischen Auswirkungen werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die sozioökonomischen Auswirkungen der Stahlindustrie auf die Region Witten und das Ruhrgebiet. Dies umfasst unter anderem die Auswirkungen auf die Beschäftigung und die regionale Wirtschaft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stahlproduktion, Ruhrgebiet, Witten, Deutsche Edelstahlwerke (DEW), Standortfaktoren, Sozioökonomie, Strukturwandel, Wirtschaftskrise, Industriemonostruktur, Konkurrenzfähigkeit, Umweltschutz.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel ist es, die Entwicklung der Stahlproduktion in Witten im Kontext der gesamtruhrgebietsweiten Veränderungen zu verstehen und zu erklären.
Welche Bedeutung hat die geografische Lage (Standortfaktoren)?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Standortfaktoren für die Stahlproduktion, insbesondere in Witten. Die Vorteile „nasser Standorte“ (an schiffbaren Gewässern) werden hervorgehoben.
Gibt es einen Ausblick in die Zukunft?
Ja, die Arbeit enthält ein Kapitel mit einem Ausblick auf die Zukunftsaussichten der Stahlproduktion in Witten.
- Quote paper
- Fabian Schröter (Author), 2016, Stahlproduktion in Witten. Vergleich zum übrigen Ruhrgebiet unter besonderer Berücksichtigung der Standortfaktoren sowie der sozioökonomischen Auswirkungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344613