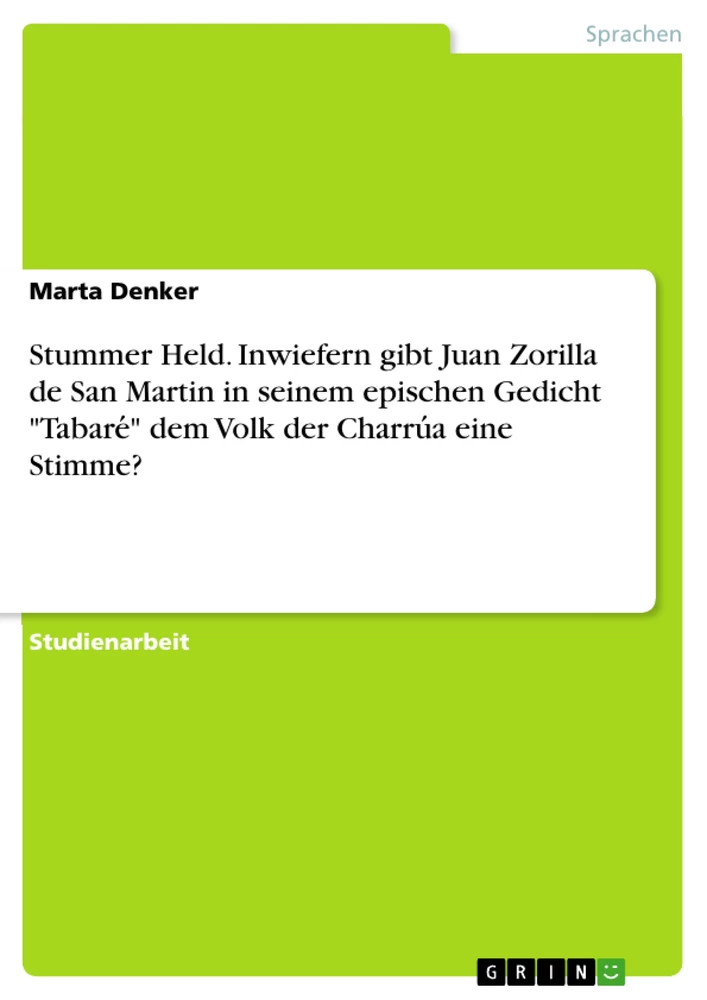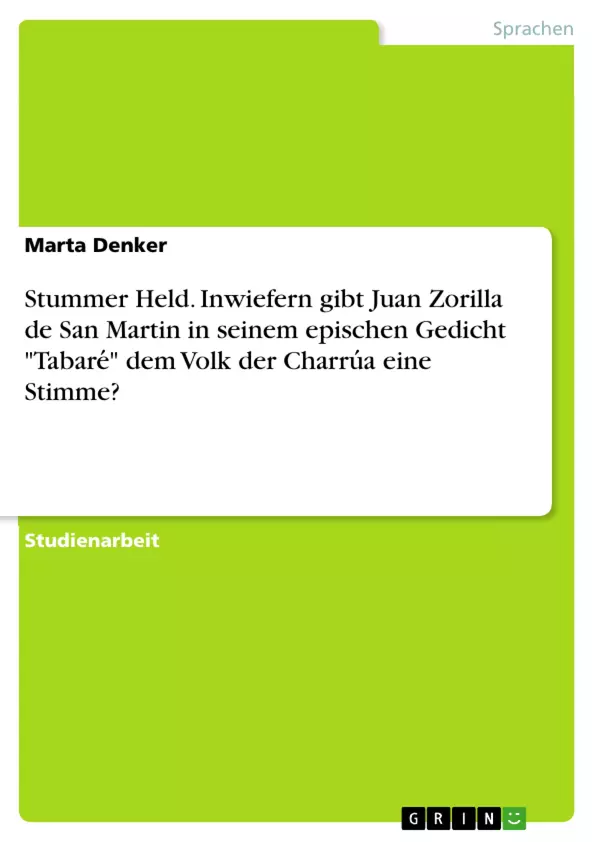Die Handlung des 1888 erschienenen epischen Gedichtes "Tabaré" des uruguayischen Schriftstellers Juan Zorilla de San Martín entwickelt sich zu Beginn der Kolonialisierung im 16. Jahrhundert im Gebiet des Río de la Plata. Dies ist die Zeit vor der Selbständigkeit Uruguays, als das Gebiet gerade von den Spaniern besiedelt, die indigene Bevölkerung vertrieben wurde und die Macht noch in den Händen der spanischen Krone lag.
Der blauäugige Mestize Tabaré, Sohn eines indigenen Häuptlings und einer Spanierin, wird zusammen mit anderen Charrúa von Don Gonzalo, dem Oberhaupt einer spanischen Ansiedlung, gefangen genommen. Tabaré fühlt sich weder den Charrúa noch den Spaniern richtig zugehörig, nur zu Blanca fühlt er sich hingezogen, da diese ihn ihm nicht den Wilden, sondern den Menschen sieht und sie ihn an seine verstorbene Mutter erinnert. Als Blanca bei einem Angriff der kriegerischen Charrúa vom Häuptling Yamandú geraubt wird, rettet Tabaré sie. Zurück im Dorf wird Tabaré, der Entführung beschuldigt und von Don Gonzalo getötet.
Mein Thema soll sich mit der Machtlosigkeit und der geringen Wertschätzung der unterdrückten indigenen Bevölkerung durch die ansiedelnden Spanier beschäftigen. In der Analyse des Gedichts werde ich auf seine metaphysische Bedeutung, die romantische Naturdarstellung und seine Musikalität eingehen, Metrik und Versmaß untersuchen und einige grundlegende Beobachtungen herausarbeiten, die das Gedicht als romantisches kennzeichnen. Schwerpunktmäßig soll das Verhalten und der Charakter Tabarés im Verhältnis zu Blanca untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einordnung in den literaturhistorischen Kontext
- 3. Biografische Einflüsse Zorillas in Tabaré
- 4. Analyse Tabaré
- 4.1 Aufbau
- 4.2 'Stummes' Volk der Charrúa/ Identitätsproblematik in Uruguay
- 4.3 Zur Musikalität/ Leitmotivik
- 4.4 Romantische Naturdarstellung und metaphysische Ebene
- 4.5 Darstellung der Charrúa/ Ausnahmen Yamandú und Tabaré
- 4.6 Tabaré als 'stummer' Held/ Blanca als 'starke' Stimme
- 5. Zusammenfassung/ Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Juan Zorilla de San Martíns episches Gedicht "Tabaré" und analysiert, inwiefern das Gedicht dem Volk der Charrúa eine Stimme verleiht. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Darstellung der Charrúa und ihrer Erfahrungen mit der Kolonisierung Uruguays. Die Arbeit beleuchtet die politische und soziale Situation der indigenen Bevölkerung, die Machtlosigkeit und die geringe Wertschätzung durch die spanischen Kolonialisten.
- Die Darstellung der Charrúa im Gedicht "Tabaré"
- Die Identitätsproblematik der Charrúa und ihre Beziehung zu den spanischen Kolonialisten
- Die Rolle von Tabaré als "stummer Held" und Blanca als "starke Stimme"
- Der Einfluss biografischer Elemente Zorillas auf das Gedicht
- Die Einordnung des Gedichts in den literaturhistorischen Kontext der Romantik in Hispanoamerika
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das epische Gedicht "Tabaré" von Juan Zorilla de San Martín vor und skizziert die historische und soziale Situation im 16. Jahrhundert im Gebiet des Río de la Plata während der frühen Kolonialisierung. Sie beschreibt kurz die Handlung um den Mestizen Tabaré und seine Beziehung zu Blanca, und betont die Thematik der Machtlosigkeit und Unterdrückung der indigenen Bevölkerung durch die spanischen Kolonialisten. Die zentrale Forschungsfrage wird formuliert: Inwiefern verleiht Zorilla dem Volk der Charrúa eine Stimme?
2. Einordnung in den literaturhistorischen Kontext: Dieses Kapitel ordnet Zorillas "Tabaré" in den Kontext der Romantik in Hispanoamerika ein. Es differenziert zwischen zwei Perioden der Romantik, wobei die Entstehungszeit von "Tabaré" in die erste Periode fällt, die von der Suche nach nationaler Identität und einem panhispanoamerikanischen Bewusstsein geprägt war. Das Kapitel diskutiert die Ambivalenz des Gedichts, welches sowohl nationale als auch panhispanoamerikanische Themen aufgreift und dabei laut Graciela Palau de Nemes bereits prä-modernistische Züge aufweist.
3. Biografische Einflüsse Zorillas in Tabaré: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Zorillas Biographie auf sein Werk "Tabaré". Es wird Zorillas Exil und die daraus resultierende Erfahrung der Ausgrenzung als zentraler Punkt hervorgehoben, der ihm ein tiefes Verständnis für die Situation der vertriebenen indigenen Bevölkerung vermittelt haben könnte und sich in dem Gedicht manifestiert. Die persönliche Erfahrung des Autors mit Unterdrückung und Vertreibung wird als wichtige Grundlage für die Darstellung der Charrúa-Perspektive im Gedicht interpretiert.
4. Analyse Tabaré: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse von "Tabaré", wobei die Schwerpunkte auf dem Aufbau des Werkes, der Darstellung des Charrúa-Volkes, der musikalischen Gestaltung, der romantischen Naturdarstellung, der metaphysischen Ebene und der Beziehung zwischen Tabaré und Blanca liegen. Die Rolle Tabarés als "stummer Held" und Blankas als "starke Stimme" wird eingehend untersucht, um die zentrale Frage der Vermittlung der Charrúa-Stimme zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Analyse der Charaktere und ihrer Interaktionen, um das Thema der Machtverhältnisse und des Einflusses aufeinander aufzuzeigen. Die Stimmlosigkeit Tabarés wird als Ausdruck der Stimmlosigkeit des gesamten Charrúa-Volkes interpretiert.
Schlüsselwörter
Tabaré, Juan Zorilla de San Martín, Romantik in Hispanoamerika, Charrúa, Kolonialisierung Uruguays, indigene Bevölkerung, Identitätsproblematik, "stummer Held", Stimme, Macht, Unterdrückung, nationale Identität, metaphysische Ebene, romantische Naturdarstellung.
Häufig gestellte Fragen zu Juan Zorilla de San Martíns "Tabaré"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Juan Zorilla de San Martíns episches Gedicht "Tabaré" und untersucht, wie das Gedicht dem Volk der Charrúa eine Stimme verleiht. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Charrúa und ihrer Erfahrungen mit der Kolonialisierung Uruguays, insbesondere auf ihrer Machtlosigkeit und geringen Wertschätzung durch die spanischen Kolonialisten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Darstellung der Charrúa in "Tabaré", die Identitätsproblematik der Charrúa und ihre Beziehung zu den spanischen Kolonialisten, die Rolle von Tabaré als "stummer Held" und Blanca als "starke Stimme", der Einfluss biografischer Elemente Zorillas auf das Gedicht und die Einordnung des Gedichts in den literaturhistorischen Kontext der Romantik in Hispanoamerika.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Einordnung in den literaturhistorischen Kontext, Biografische Einflüsse Zorillas in Tabaré, Analyse Tabaré (mit Unterkapiteln zu Aufbau, Identitätsproblematik, Musikalität, Naturdarstellung, Darstellung der Charrúa und der Rollen von Tabaré und Blanca) und Zusammenfassung/Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern verleiht Zorilla dem Volk der Charrúa eine Stimme?
Wie wird die Rolle der Charrúa dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Darstellung der Charrúa als ein Volk, das durch die Kolonialisierung seine Stimme und Identität verliert. Tabaré wird als "stummer Held" interpretiert, der die Stimmlosigkeit des gesamten Volkes repräsentiert, während Blanca als "starke Stimme" agiert.
Welche Bedeutung hat der literaturhistorische Kontext?
Das Gedicht wird im Kontext der Romantik in Hispanoamerika eingeordnet, insbesondere in Bezug auf die Suche nach nationaler Identität und panhispanoamerikanischem Bewusstsein. Die Ambivalenz des Gedichts zwischen nationalen und panhispanoamerikanischen Themen wird diskutiert.
Welche Rolle spielt Zorillas Biografie?
Zorillas Exil und die daraus resultierende Erfahrung der Ausgrenzung werden als zentraler Einfluss auf seine Darstellung der Charrúa interpretiert. Seine persönliche Erfahrung mit Unterdrückung und Vertreibung wird als Grundlage für das Verständnis der Charrúa-Perspektive gesehen.
Welche Aspekte werden in der Analyse von "Tabaré" besonders berücksichtigt?
Die Analyse von "Tabaré" konzentriert sich auf den Aufbau des Werkes, die Darstellung des Charrúa-Volkes, die musikalische Gestaltung, die romantische Naturdarstellung, die metaphysische Ebene und die Beziehung zwischen Tabaré und Blanca. Die Machtverhältnisse und der Einfluss der Charaktere aufeinander werden eingehend untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tabaré, Juan Zorilla de San Martín, Romantik in Hispanoamerika, Charrúa, Kolonialisierung Uruguays, indigene Bevölkerung, Identitätsproblematik, "stummer Held", Stimme, Macht, Unterdrückung, nationale Identität, metaphysische Ebene, romantische Naturdarstellung.
- Citation du texte
- Marta Denker (Auteur), 2014, Stummer Held. Inwiefern gibt Juan Zorilla de San Martin in seinem epischen Gedicht "Tabaré" dem Volk der Charrúa eine Stimme?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344698