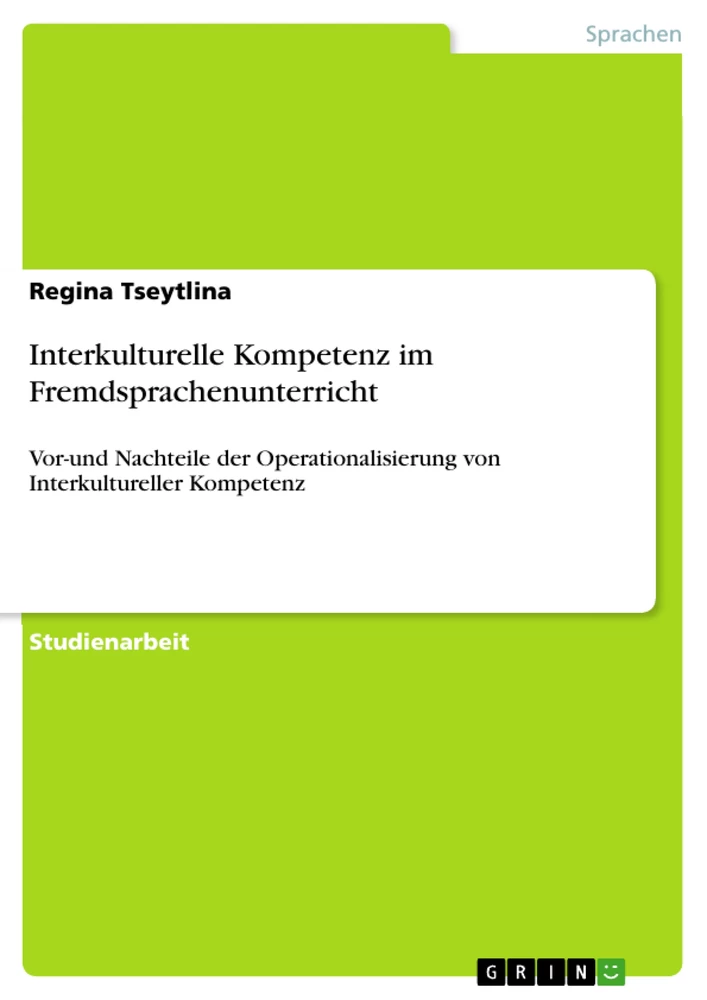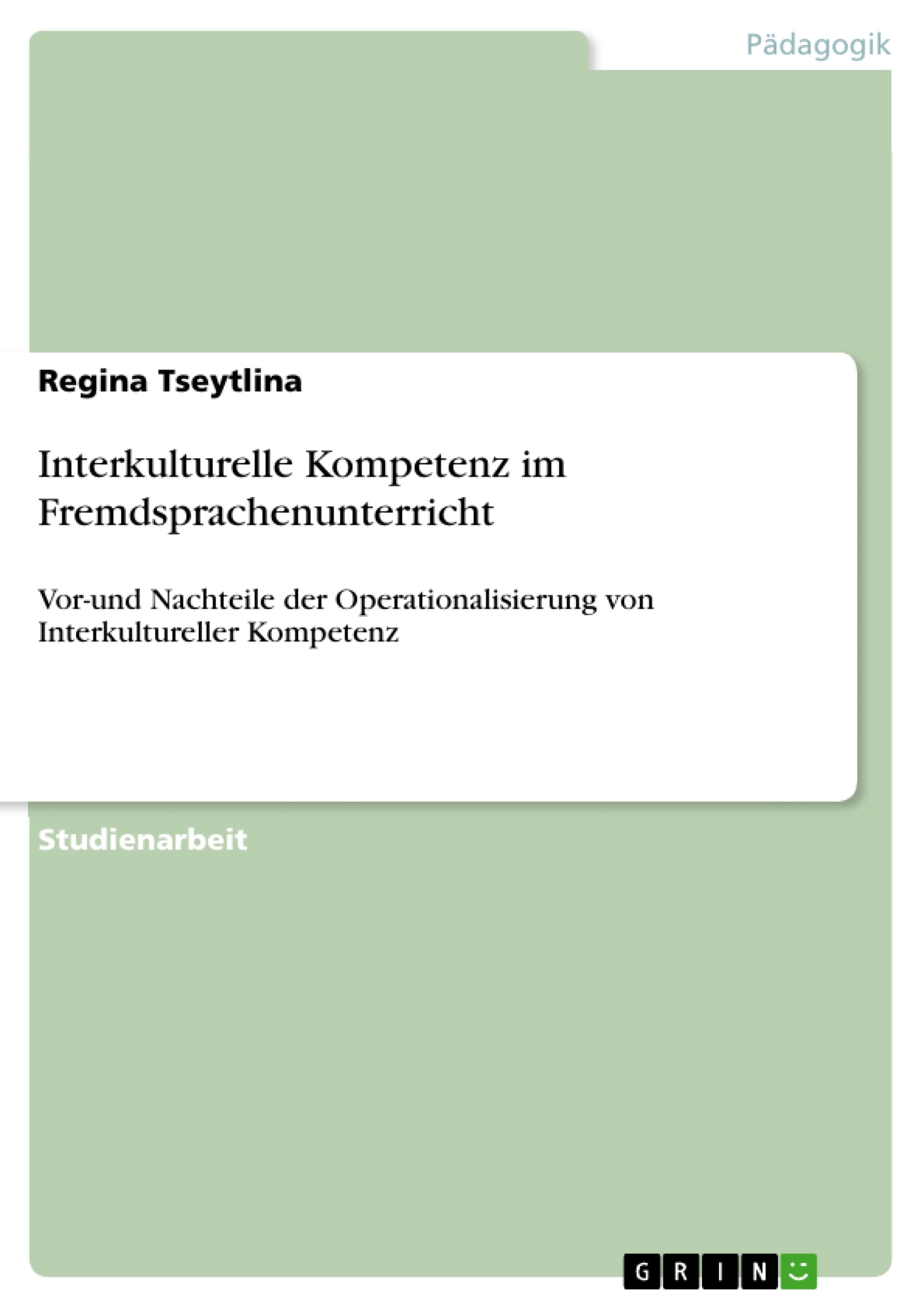In der Hausarbeit wurden Theorien zum Fremdsprachenunterricht in Bezug auf Interkulturelle Kompetenz besprochen. Vor allem die Theorien von Byram wurden in den Vordergrund gestellt und Vor-und Nachteile der Operationalisierung der Interkulturellen Kompetenz diskutiert.
Hu und Byram sagen hier, dass die interkulturelle Kompetenz eine wichtige Rolle in der Bildungspolitik spielt, doch das Konzept (das genaue Ziel) dieser Kompetenz ist noch sehr ungenau/ nicht messbar dargestellt. Es besteht die Gefahr, dass dieses Konzept im Unterricht nicht richtig umgesetzt wird. Deswegen wollen Hu und Byram, dass Schulen, Lehrer und Theoretiker so schnell wie möglich Operationalisierungsmethoden- und geeignete Modelle für den Unterricht finden. Man bezieht sich hier nicht nur auf die Vermittlung der interkulturellen Kompetenz in den Fremdsprachen, sondern auf den Unterricht allgemein.
Ein Lernziel ist operationalistiert, wenn messbare Kenntnisse/Fähigkeiten des Schülers nach dem Unterricht beschrieben werden können. Auch müssen Bedingungen genannt werden, unter denen das Verhalten des Schülers kontrolliert werden soll (Lernzeit, Hilfsmittel, kooperatives/ individuelles Lernen) und es muss auch ein Bewertungsmaßstab angegeben sein, der dabei behilflich sein soll zu entscheiden, ob und wie weit der Schüler das gewünschte Lernziel erreicht hat.
Bei der Erstellung der Lernziele sollte man darauf achten, dass diese sowohl eine Inhalts-und eine Verhaltenskomponente enthalten. Die inhaltliche gibt Auskunft über die konkreten Inhalte/Gegenstände benötigt werden, um eine Kompetenz zu erwerben. Bei der Verhaltenskomponente achtet man auf die sichtbaren Verhaltensweisen der Lerner, die zeigen, ob er die gewünschte Kompetenz erreicht hat oder nicht. Die Operationalisierung hat das Ziel, die Verhaltenskompenente durch konkrete und messbare Operatoren so genau wie möglich zu beschreiben. Operationalisierende Faktoren wie Neugier auf andere Menschen, Empathiefähigkeit, Selbstkenntnis,cultural awareness sind aber sehr schwer zu messen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von der Landeskunde zur Interkulturellen Kompetenz
- Vor und Nachteile der Operationalisierung der Interkulturellen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beschäftigt sich mit der Bedeutung und der Umsetzung interkultureller Kompetenz im Fremdsprachenunterricht. Der Autor beleuchtet die Entwicklung des Konzepts von der Landeskunde zur interkulturellen Kompetenz und analysiert die Herausforderungen, die mit der Operationalisierung dieses Konzepts im Unterricht verbunden sind.
- Entwicklung des Konzepts der Interkulturellen Kompetenz
- Herausforderungen der Operationalisierung interkultureller Kompetenz
- Bedeutung der Interkulturellen Kompetenz in der Bildungspolitik
- Kritik an der Operationalisierung von interkultureller Kompetenz im Fremdsprachenunterricht
- Modelle zur Förderung interkultureller Kompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text beginnt mit einer Diskussion über die Bedeutung der interkulturellen Kompetenz in der Bildungspolitik und den Herausforderungen, die mit der Operationalisierung dieses Konzepts im Unterricht verbunden sind.
- Von der Landeskunde zur Interkulturellen Kompetenz: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Konzepts der Landeskunde und seinen Wandel zur Interkulturellen Kompetenz. Es werden die verschiedenen Konzepte der Landeskunde vorgestellt und die Notwendigkeit einer interkulturellen Perspektive im Fremdsprachenunterricht hervorgehoben.
- Vor und Nachteile der Operationalisierung der Interkulturellen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht: Hier werden die Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Operationalisierung interkultureller Kompetenz im Unterricht diskutiert. Der Autor analysiert, warum die Messbarkeit von interkulturellen Kompetenzen problematisch ist und welche Schwierigkeiten sich bei der konkreten Umsetzung im Unterricht ergeben.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kompetenz, Fremdsprachenunterricht, Landeskunde, Operationalisierung, Bildungspolitik, kommunikative Kompetenz, Kultur, Perspektivwechsel, Toleranz, Stereotypen, Fremdsprachenlernen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Interkulturelle Kompetenz“ im Fremdsprachenunterricht?
Es geht über reine Landeskunde hinaus und beinhaltet die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, Empathie, kulturelle Bewusstheit (cultural awareness) und den Abbau von Stereotypen.
Was ist das Ziel der Operationalisierung von Lernzielen?
Operationalisierung bedeutet, Lernziele so präzise zu beschreiben, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler nach dem Unterricht messbar und kontrollierbar sind.
Warum ist die Messung interkultureller Kompetenz problematisch?
Faktoren wie Neugier, Empathie und Toleranz sind psychologische Einstellungen, die sich nur schwer in konkrete, messbare Operatoren übersetzen lassen.
Welche Rolle spielen die Theorien von Byram in der Arbeit?
Byrams Modelle stehen im Vordergrund, um Vor- und Nachteile der Operationalisierung zu diskutieren und geeignete Methoden für den Unterricht zu finden.
Was müssen Lernziele laut der Arbeit enthalten?
Sie sollten eine Inhaltskomponente (konkrete Gegenstände) und eine Verhaltenskomponente (sichtbare Reaktionen der Lerner) umfassen.
Gilt das Konzept nur für den Fremdsprachenunterricht?
Nein, Hu und Byram betonen, dass interkulturelle Kompetenz ein Ziel für den Unterricht im Allgemeinen und die gesamte Bildungspolitik sein sollte.
- Citar trabajo
- Regina Tseytlina (Autor), 2016, Interkulturelle Kompetenz im Fremdsprachenunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344712