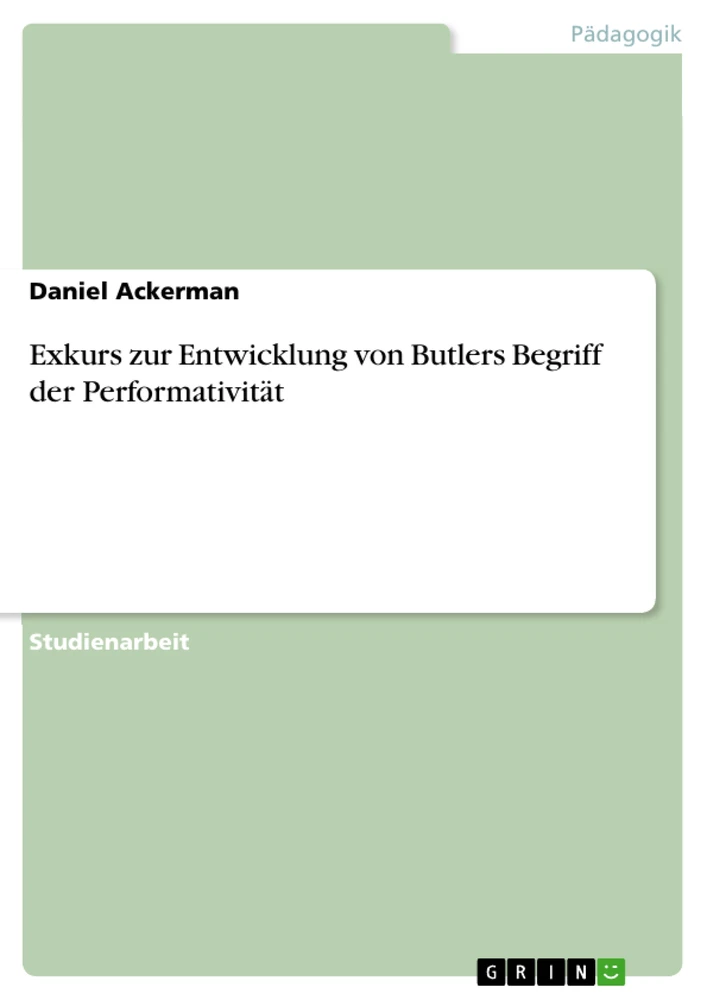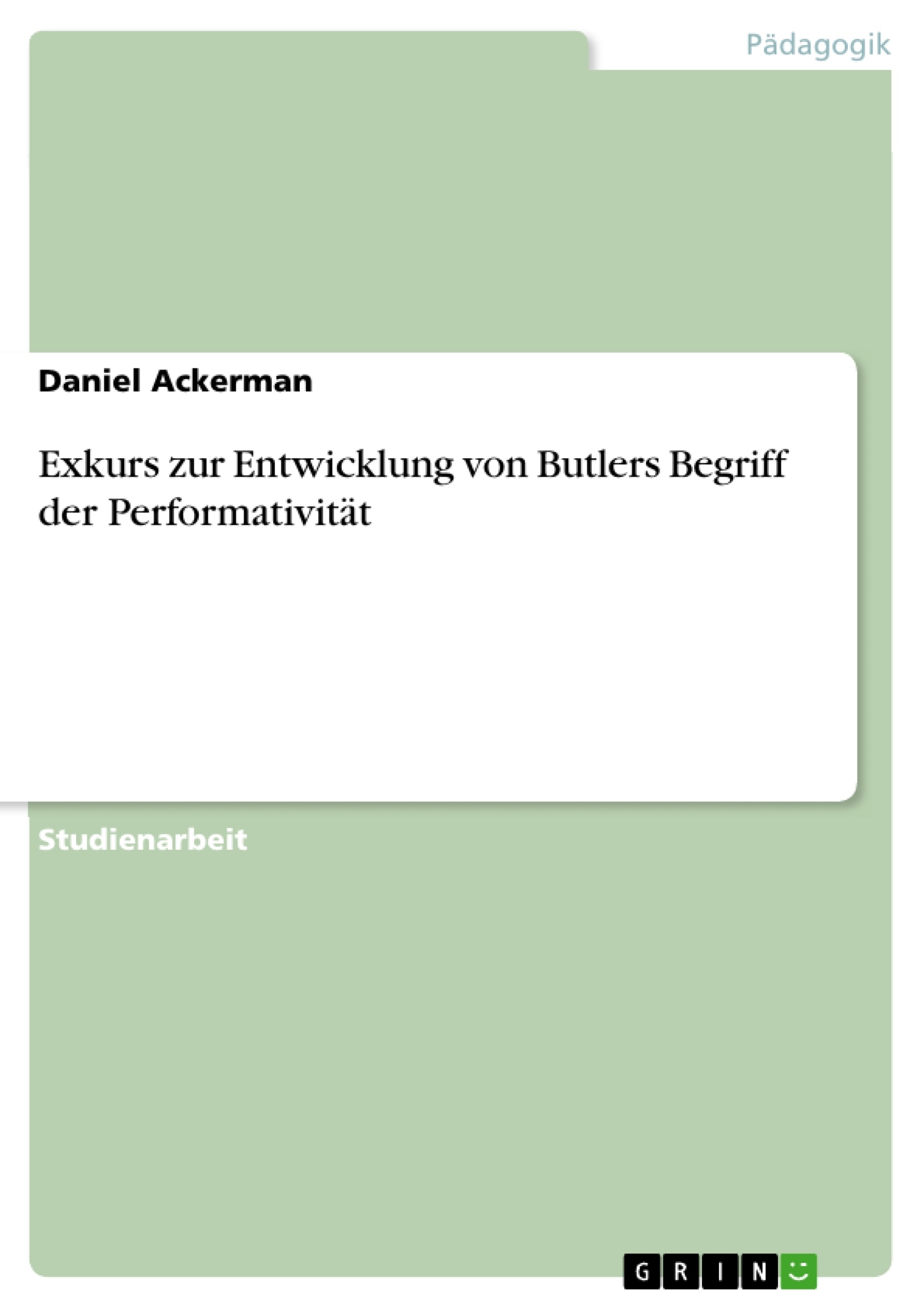Judith Butler wurde am 24 Februar 1956 in Cleveland (USA) geboren. Sie lehrt als Professorin an der University of California, Berkeley. Ihr Werk „Das Unbehagen der Geschlechter“ katapultierte sie in den Olymp der Akademiker. Einer ihrer signifikantesten Beiträge zur „Performativität der Geschlechter“ ist Gegenstand dieser Arbeit. Ihr philosophisches Konstrukt verlangt ein großes Grundlagenwissen über einige poststrukturalistische Denker und darüber hinaus. Diese Arbeit versucht Grundannahmen, an welchen sich Judith Butler orientiert, zu beleuchten und einen möglichen Erkenntnisweg zu beschreiben.
Eingangs steht eine Darstellung des Poststrukturalismus, da Judith Butler in diese philosophische Tradition eingeordnet wird. Es folgt eine Auseinandersetzung mit Michael Foucaults „Ordnung des Diskurses“, da sein Werk von zentraler Bedeutung für Butler ist, und im Anschluss mit Butlers Verständnis des Diskurses.
Um tiefer in die Materie einzudringen, befasst sich die Arbeit mit dem Begriff der Performativität bei Austin, an den Derrida weiterführend mit seiner Dekonstruktionsund Iterationstheorie anknüpft. Danach sind Butlers Zugänge zu Freud und Bourdieu Gegenstand der Betrachtung und abschließend wird ihre Theorie der Performativität erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Poststrukturalismus..
- 3. Foucaults Diskurs...........
- 4. Der Subjektbegriff bei Butler.
- 5. Butlers Diskursverständnis.
- 6. Der Performativitätsbegriff bei Austin
- 7. Jacques Derridas Dekonstruktion
- 8. Konzept der Iteratibilität.
- 9. Bourdieus Habitus, inkorporiertes kulturelles Kapital und Performativität .
- 10. Individualpsychologisches Konzept Butlers.......
- 11. Butlers Begriff der Performativität..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Judith Butlers Konzept der Performativität des Geschlechts, einem zentralen Element ihres Werks „Das Unbehagen der Geschlechter". Sie beleuchtet die philosophischen und theoretischen Grundlagen, auf denen Butlers Theorie basiert, und zeichnet einen möglichen Erkenntnisweg nach.
- Poststrukturalismus und die Kritik am Verhältnis von Sprache und sozialer Wirklichkeit
- Foucaults Diskursanalyse und die Bedeutung von Machtstrukturen in der Produktion von Wissen
- Butlers Verständnis von Diskurs und die performative Konstitution des Subjekts
- Performativität bei Austin, Derrida und die Konzepte der Dekonstruktion und Iteration
- Butlers Integration von Freud und Bourdieu in ihre Theorie der Performativität
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung stellt Judith Butler und ihr Werk vor, wobei insbesondere auf ihr Werk „Das Unbehagen der Geschlechter“ und ihr Konzept der Performativität des Geschlechts eingegangen wird. Die Arbeit strebt danach, die philosophischen Grundlagen von Butlers Theorie zu beleuchten und einen möglichen Erkenntnisweg zu beschreiben.
- Kapitel 2: Poststrukturalismus: Dieses Kapitel beleuchtet den Poststrukturalismus als eine sozial- und geisteswissenschaftliche Methode, die in den 1960er Jahren entstand. Es werden zentrale Merkmale und Vertreter des Poststrukturalismus vorgestellt, wobei der Fokus auf deren kritischer Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Sprache und sozialer Wirklichkeit liegt.
- Kapitel 3: Foucaults Diskurs: Dieses Kapitel widmet sich Foucaults Werk „Die Ordnung des Diskurses“ und beleuchtet dessen Relevanz für Butlers Theorie. Es werden Foucaults Konzepte des Diskurses und der Machtstrukturen in der Produktion von Wissen erläutert.
- Kapitel 4: Der Subjektbegriff bei Butler: Dieses Kapitel befasst sich mit Butlers Verständnis des Subjekts und wie dieses durch soziale und sprachliche Praktiken performativ konstituiert wird. Es wird auf die Relevanz von Foucault und Derrida für Butlers Subjektbegriff eingegangen.
- Kapitel 5: Butlers Diskursverständnis: Dieses Kapitel erörtert Butlers eigenes Verständnis von Diskurs, das sich auf Foucaults Werk stützt und die performative Kraft von Sprache hervorhebt. Es beleuchtet, wie Diskurs nicht nur Wissen produziert, sondern auch soziale Realitäten formt.
- Kapitel 6: Der Performativitätsbegriff bei Austin: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit John Austins Konzept der Performativität und dessen Einfluss auf Butlers Theorie. Es wird die Rolle von sprachlichen Handlungen in der Konstitution von Wirklichkeit erörtert.
- Kapitel 7: Jacques Derridas Dekonstruktion: Dieses Kapitel analysiert Jacques Derridas Dekonstruktionstheorie und deren Bedeutung für Butlers Verständnis von Sprache und Geschlecht. Es wird auf Derridas Konzepte der Dekonstruktion und Iteration eingegangen, die für Butlers Performativitätsbegriff relevant sind.
- Kapitel 8: Konzept der Iteratibilität: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Derridas Konzept der Iteratibilität und erklärt, wie Sprache durch Wiederholung und Variationen ihre Bedeutung erhält und gleichzeitig performativ wirkt.
- Kapitel 9: Bourdieus Habitus, inkorporiertes kulturelles Kapital und Performativität: Dieses Kapitel erläutert den Einfluss von Pierre Bourdieus Konzept des Habitus auf Butlers Theorie. Es untersucht, wie inkorporiertes kulturelles Kapital das Geschlecht performativ prägt.
- Kapitel 10: Individualpsychologisches Konzept Butlers: Dieses Kapitel befasst sich mit Butlers Integration von psychoanalytischen Konzepten, insbesondere Freuds, in ihre Performativitätstheorie. Es erklärt, wie die psychologische und soziale Entwicklung des Individuums die Performativität des Geschlechts beeinflusst.
- Kapitel 11: Butlers Begriff der Performativität: Dieses Kapitel stellt Butlers Theorie der Performativität des Geschlechts umfassend dar. Es wird erläutert, wie Geschlecht nicht als eine biologische Kategorie verstanden werden kann, sondern durch ständige, repetitive Handlungen und Praktiken performativ hergestellt wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Performativität, Geschlecht, Sprache, Diskurs, Poststrukturalismus, Foucault, Butler, Derrida, Austin, Bourdieu, Freud und inkorporiertes kulturelles Kapital.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Performativität der Geschlechter" bei Judith Butler?
Geschlecht ist keine biologische Gegebenheit, sondern wird durch ständige, repetitive Handlungen und sprachliche Praktiken erst hergestellt.
Welchen Einfluss hatte Michel Foucault auf Butler?
Butlers Theorie stützt sich auf Foucaults Diskursanalyse und die Idee, dass Machtstrukturen die Produktion von Wissen und Subjekten prägen.
Was ist das Konzept der "Iterabilität" nach Jacques Derrida?
Es beschreibt, wie Zeichen durch Wiederholung und Variation ihre Bedeutung erhalten, was Butler auf die soziale Konstruktion von Geschlecht überträgt.
Wie integriert Butler die Habitus-Theorie von Bourdieu?
Sie nutzt Bourdieus Konzept des inkorporierten kulturellen Kapitals, um zu erklären, wie soziale Normen im Körper manifestiert werden.
Worum geht es in Butlers Werk "Das Unbehagen der Geschlechter"?
Es ist ein zentrales Werk des Poststrukturalismus, das die binäre Geschlechterordnung radikal infrage stellt.
- Quote paper
- Daniel Ackerman (Author), 2016, Exkurs zur Entwicklung von Butlers Begriff der Performativität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344951