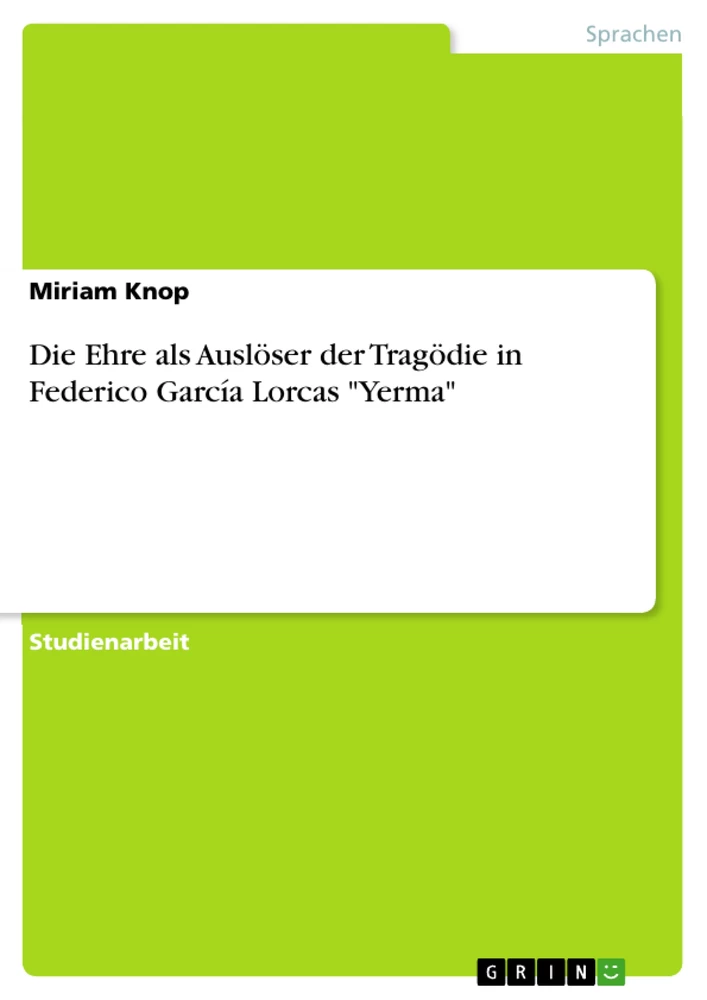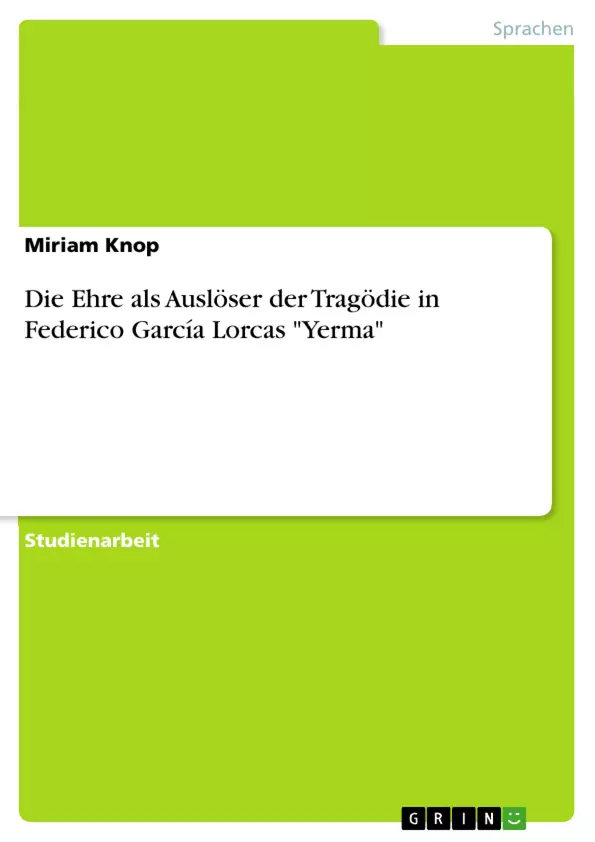"Yerma" von Federico García Lorca ist vor allem ein Stück über die unerfüllte Mutterschaft der gleichnamigen Hautperson, welche auch nach Jahren der Ehe kinderlos bleibt. Jegliche Bestrebungen schwanger zu werden scheitern und so gipfelt die Tragödie schließlich in einer Katastrophe, als Yerma ihren Ehemann Juan eigenhändig tötet. Dass der unerfüllte Kinderwunsch allein nicht tragisch sein kann liegt auf der Hand, vielmehr liegt es nahe, dass die Tragödie erst durch hinzutretende Faktoren ausgelöst wird. Denn Yerma ist neben dem zentralen Thema der (unerfüllten) Mutterschaft, vor allem ein Drama der andalusischen Provinz, in welcher Traditionen das Zusammenleben der Menschen bestimmen.
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, Federico García Lorcas Werk in Hinblick auf den Ehrbegriff zu untersuchen. Dabei soll zunächst eine Einführung in die Thematik der Ehre gegeben werden, Definition des Ehrbegriffs und seiner Dualität, und in der Folge auf die Bedeutung der Ehre in der spanischen Welt eingegangen werden.
Im weiteren Verlauf sollen die herausgearbeiteten Erkenntnisse an dem Stück selbst geprüft werden. Zunächst sollen Handlungsort des Dramas und die Gesellschaftsordnung beleuchtet, und in der Folge die Personen analysiert werden. Dabei wird sich beschränkt auf zwei der Hauptpersonen des Dramas, Yerma und Juan, welchen die öffentliche Meinung gegenübergestellt wird. Hinsichtlich der Eheleute soll die Frage beantwortet werden, was Ehre für diese bedeutet und inwiefern ihre Ehrbegriffe die Tragödie erst ermöglicht, Ehre also als ihr Auslöser fungiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Semantik der Ehre
- Der allgemeine Ehrbegriff
- Der dualistische Ehrbegriff
- Der Ehrbegriff im Spanischen
- Lorcas Yerma
- Handlungsort
- Gesellschaftsordnung
- Personen
- Juan
- Yerma
- Die öffentliche Meinung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Federico García Lorcas Drama „Yerma“ im Hinblick auf den Ehrbegriff. Die Untersuchung zielt darauf ab, die Rolle der Ehre als Auslöser der Tragödie in Yermas unerfüllter Mutterschaft zu beleuchten.
- Die Bedeutung des Ehrbegriffs in der andalusischen Provinz
- Die Rolle der öffentlichen Meinung und Traditionen im sozialen Gefüge
- Der Einfluss von Ehre auf die Beziehungen zwischen Yerma und Juan
- Die Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Ehre
- Die spezifische Bedeutung von Ehre im spanischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Yerma als ein Stück über die unerfüllte Mutterschaft vor und erläutert die Bedeutung des Ehrbegriffs für das Verständnis der Tragödie. Anschließend wird eine Einführung in den Ehrbegriff gegeben, mit Definitionen und der Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Ehre. Im weiteren Verlauf wird auf den Ehrbegriff im spanischen Kontext eingegangen, wobei insbesondere die Bedeutung der öffentlichen Meinung und die Geschlechterrollen hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Ehrbegriff im Kontext von Federico García Lorcas „Yerma“. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen zählen: Ehre, Traditionen, öffentliche Meinung, unerfüllte Mutterschaft, Geschlechterrollen, andalusische Provinz, spanische Kultur, Tragödie.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist "Yerma" eine Tragödie?
Die Tragödie ergibt sich nicht nur aus der unerfüllten Mutterschaft der Hauptfigur, sondern vor allem aus dem Konflikt mit den starren Traditionen und dem Ehrbegriff der andalusischen Provinz.
Welche Rolle spielt die Ehre in Lorcas Drama?
Die Ehre fungiert als Auslöser der Katastrophe, da sie Yerma und Juan in ein enges Korsett aus gesellschaftlichen Erwartungen zwängt, das letztlich zum Mord führt.
Was bedeutet Ehre für die Figur Juan?
Für Juan ist Ehre vor allem die öffentliche Meinung und der Schutz seines guten Namens vor den Gerüchten der Nachbarn, was ihn von Yermas emotionalem Leid entfremdet.
Wie unterscheidet sich innere von äußerer Ehre?
Innere Ehre bezieht sich auf die persönliche Integrität, während äußere Ehre (Reputation) davon abhängt, wie man von der Gesellschaft wahrgenommen wird.
Warum tötet Yerma ihren Ehemann am Ende?
Durch den Mord an Juan zerstört Yerma ihre einzige legitime Möglichkeit, Mutter zu werden, und befreit sich gleichzeitig gewaltsam von der Unterdrückung durch seinen Ehrbegriff.
Welchen Einfluss hat die öffentliche Meinung im Stück?
Die öffentliche Meinung wirkt wie ein unsichtbarer Richter, der das Verhalten der Eheleute ständig überwacht und den Druck auf Yerma unerträglich macht.
- Citar trabajo
- Miriam Knop (Autor), 2016, Die Ehre als Auslöser der Tragödie in Federico García Lorcas "Yerma", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345004