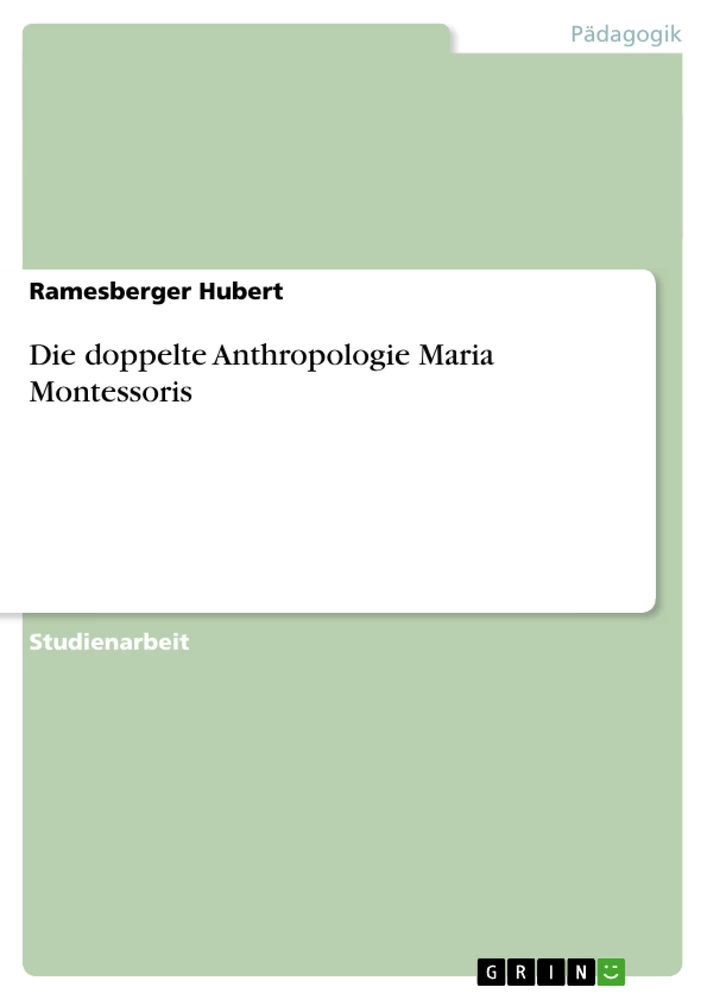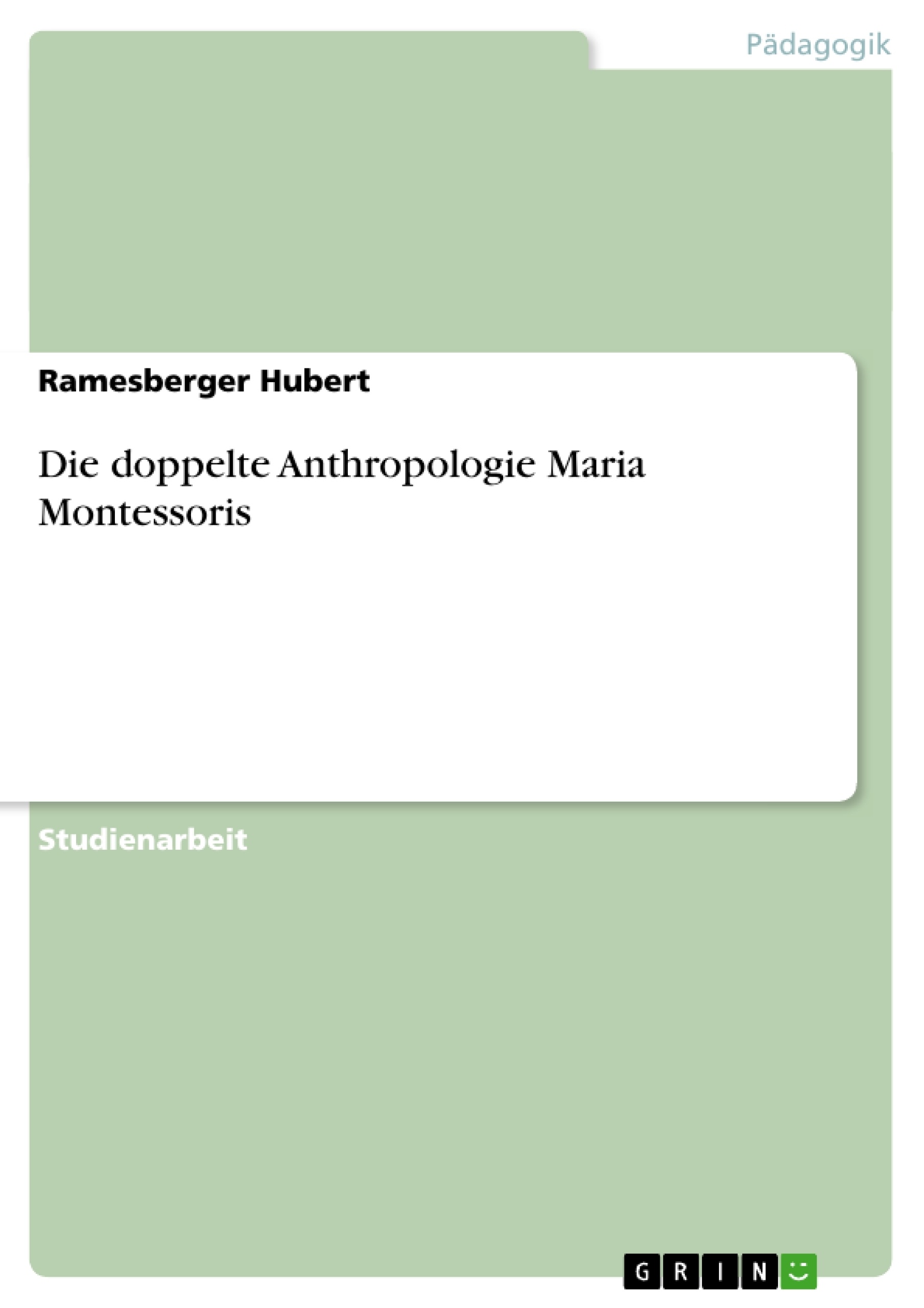Maria Montessori gilt als Reformpädagogin, die maßgeblich das Weltbild der Pädagogik beeinflusste und immer noch beeinflusst.
Die Reformpädagogik in der Zeit zwischen 1890 und 1933 bedeutete, vor allem vor dem Ersten Weltkrieg, die Anwendung pädagogischer Reflexion auf die historisch-gesellschaftliche Situation aus der eine Vielfalt unterschiedlicher Ansätze zur Erneuerung der Schule und der Erziehung hervorgingen. Anlässe in Deutschland waren damals der um 1900 abgeschlossene Aufbau eines verschulten, bürokratisierten, selektiven Schulsystems im wilhelminischen Obrigkeitsstaat und der mit der Industrialisierung, Verstädterung und Mobilität einhergehende gesellschaftliche, technische, ökonomische und kulturelle Umbruch. Mit der Modernität reformpädagogischen Denkens und Handelns verbanden sich Vorstellungen von einer entbürokratisierten Schule, von freiheitlich demokratischen Lebensverhältnissen und liberalen, kindorientierten Bildungsidealen.
Beschäftigt man sich näher mit der pädagogischen Anthropologie Maria Montessoris, wird man unweigerlich mit zwei unterschiedlichen Positionen ihrer Anthropologie konfrontiert. Die eine Position ist von einem individuellen Charakter geprägt. Sie behandelt die kindzentrierte Entwicklung des Kindes. Die Entwicklung hin zum Individuum. Die andere Position beschreibt die Entwicklung des Kindes hin zum mittleren Menschen. Hier steht nicht das Kind mit seinen individuellen Eigenschaften im Mittelpunkt sondern der von Adolphe Quetelet errechnette >> homme moyen <<. Es soll deutlich werden, dass Montessoris Fokus aufs Ganze gerichtet ist. Die Be-arbeitung dieser beiden Positionen innerhalb der pädagogischen Anthropologie von Maria Montessori stellt den Inhalt dieser Seminarbarbeit dar.
Dabei gehe ich zuerst näher auf die kindzentrierte Betrachtungsweise ein, bevor ich im Punkt zwei den >> homme moyen << näher bearbeite. Um verschiedene Annahmen und Aussagen zu be- bzw. zu entkräften, bediene ich mich zeitweilig Zitaten von der Protagonistin beziehungsweise von den im Literaturverzeichnis aufgeführten Autoren.
Dass diese Anthropologie jedoch nicht unreflektiert übernommen werden sollte und von zwei ganz unterschiedlichen Positionen dominiert wird, die wiederum mit einer Vielzahl von Problemen behaftet sind, versuche ich in dieser Seminararbeit darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kindzentrierte Entwicklung
- Immanenter Bauplan
- Sensible Phasen
- Der absorbierende Geist und die Mneme
- Intellektuelle Entwicklung
- Die Entwicklung der Sozialisation und Enkulturation
- Entwicklung der Denk- und Wertungsmuster
- Polarisation der Aufmerksamkeit
- Der Mensch als „Homme moyen“
- Orientierung an Adolphe Quetelet
- Maria Montessori und der mittlere Mensch
- Normalisation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die scheinbar widersprüchlichen anthropologischen Positionen in Maria Montessoris Pädagogik. Sie beleuchtet sowohl den kindzentrierten Ansatz mit Fokus auf individuelle Entwicklung als auch Montessoris Bezug auf den "homme moyen" nach Quetelet. Ziel ist es, die beiden Perspektiven in Montessoris Werk zu verstehen und deren Zusammenspiel aufzuzeigen.
- Kindzentrierte Entwicklung nach Montessori
- Der "homme moyen" in Montessoris Pädagogik
- Der absorbierende Geist und sensible Phasen
- Normalisierung als pädagogisches Ziel
- Das Spannungsfeld zwischen Individualität und kollektiver Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Maria Montessori als einflussreiche Reformpädagogin vor und kontextualisiert ihre Arbeit im Hinblick auf die gesellschaftlichen und pädagogischen Umbrüche um 1900. Sie führt die beiden zentralen Themen der Arbeit ein: die kindzentrierte Entwicklung und den Ansatz des "homme moyen", wobei sie auf den scheinbaren Widerspruch zwischen beiden hinweist und die Struktur der Arbeit skizziert.
Kindzentrierte Entwicklung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem individualisierten Ansatz in Montessoris Pädagogik. Es erläutert Konzepte wie den immanenten Bauplan, sensible Phasen und den absorbierenden Geist. Besondere Aufmerksamkeit wird der intellektuellen Entwicklung, der Sozialisation, der Entwicklung von Denk- und Wertungsmustern sowie der Polarisation der Aufmerksamkeit gewidmet. Der Fokus liegt auf der einzigartigen Entwicklung jedes Kindes und der Bedeutung der vorbereiteten Umgebung.
Der Mensch als „Homme moyen“: Dieses Kapitel analysiert Montessoris Bezug auf Adolphe Quetelets "homme moyen". Es untersucht, wie Montessoris pädagogischer Ansatz den durchschnittlichen Menschen berücksichtigt und wie die Idee der Normalisierung in ihrer Pädagogik umgesetzt wird. Es wird der scheinbare Widerspruch zwischen der Individualität des Kindes und dem Konzept des Durchschnittsmenschen aufgezeigt und diskutiert, wie beide Aspekte in Montessoris System zusammenspielen.
Schlüsselwörter
Maria Montessori, Reformpädagogik, kindzentrierte Entwicklung, homme moyen, Adolphe Quetelet, Normalisierung, sensible Phasen, absorbierender Geist, individuelle Entwicklung, kollektive Entwicklung, Pädagogische Anthropologie.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Anthropologischen Positionen in Maria Montessoris Pädagogik
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die scheinbar widersprüchlichen anthropologischen Positionen in Maria Montessoris Pädagogik. Sie beleuchtet den kindzentrierten Ansatz mit Fokus auf die individuelle Entwicklung und Montessoris Bezug auf den "homme moyen" nach Quetelet. Ziel ist es, das Zusammenspiel beider Perspektiven in Montessoris Werk zu verstehen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die kindzentrierte Entwicklung nach Montessori, den "homme moyen" in Montessoris Pädagogik, den absorbierenden Geist und sensible Phasen, die Normalisierung als pädagogisches Ziel und das Spannungsfeld zwischen Individualität und kollektiver Entwicklung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur kindzentrierten Entwicklung, einem Kapitel zum "homme moyen" und einem Fazit. Die Einleitung stellt Montessori vor und führt die zentralen Themen ein. Das Kapitel zur kindzentrierten Entwicklung erläutert Konzepte wie den immanenten Bauplan, sensible Phasen und den absorbierenden Geist. Das Kapitel zum "homme moyen" analysiert Montessoris Bezug auf Quetelets Konzept und die Rolle der Normalisierung in ihrer Pädagogik.
Was versteht man unter dem "kindzentrierten Ansatz" bei Montessori?
Der kindzentrierte Ansatz in Montessoris Pädagogik fokussiert auf die individuelle Entwicklung jedes Kindes. Konzepte wie der immanente Bauplan, sensible Phasen und der absorbierende Geist unterstreichen die einzigartige Entwicklung jedes Kindes und die Bedeutung der vorbereiteten Umgebung. Die Arbeit betrachtet die intellektuelle Entwicklung, die Sozialisation, die Entwicklung von Denk- und Wertungsmustern sowie die Polarisation der Aufmerksamkeit im Kontext dieser individuellen Entwicklung.
Welche Rolle spielt der "homme moyen" in Montessoris Pädagogik?
Die Arbeit untersucht Montessoris Bezug auf Adolphe Quetelets "homme moyen". Es wird analysiert, wie Montessoris pädagogischer Ansatz den durchschnittlichen Menschen berücksichtigt und wie die Idee der Normalisierung in ihrer Pädagogik umgesetzt wird. Ein zentraler Punkt ist die Diskussion des scheinbaren Widerspruchs zwischen der Individualität des Kindes und dem Konzept des Durchschnittsmenschen und wie beide Aspekte in Montessoris System zusammenspielen.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Maria Montessori, Reformpädagogik, kindzentrierte Entwicklung, homme moyen, Adolphe Quetelet, Normalisierung, sensible Phasen, absorbierender Geist, individuelle Entwicklung, kollektive Entwicklung, Pädagogische Anthropologie.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit im bereitgestellten HTML-Code enthalten. Es wird empfohlen, den vollständigen Text der Seminararbeit zu konsultieren, um das Fazit zu erfahren.)
- Citation du texte
- Ramesberger Hubert (Auteur), 2005, Die doppelte Anthropologie Maria Montessoris, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34501