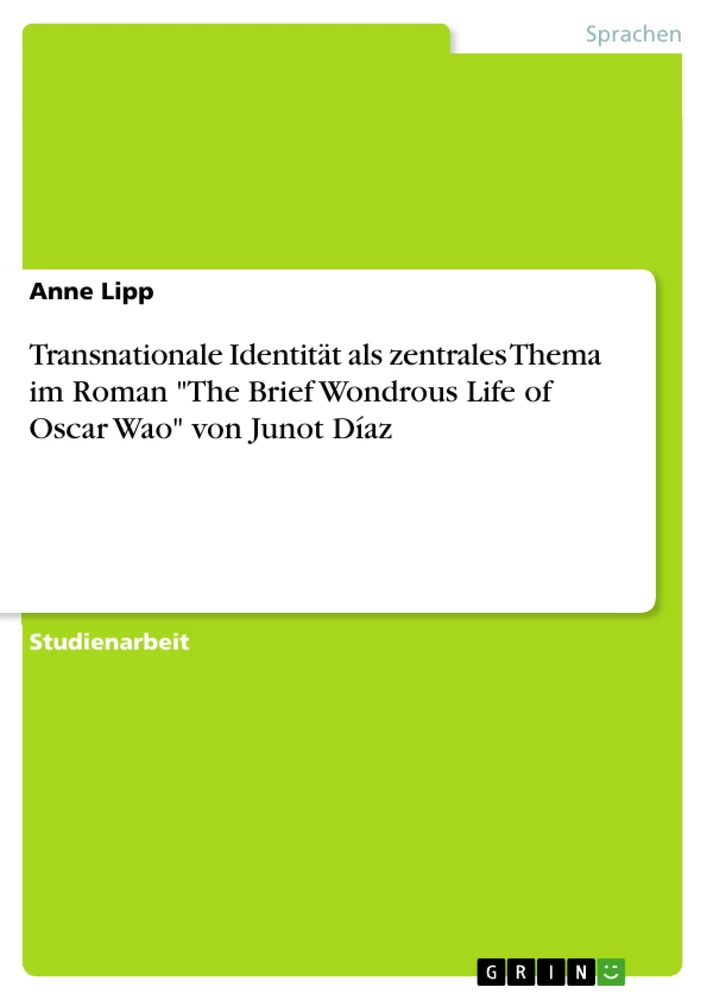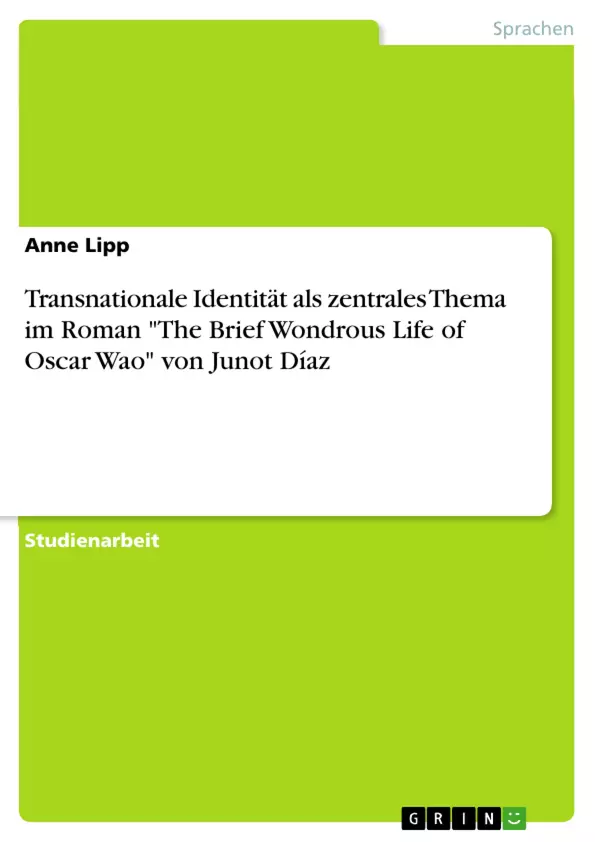Das dieser Arbeit zugrunde liegende Werk "The Brief Wondrous Life of Oscar Wao" wurde 2007 von Junot Díaz publiziert. Der Roman war so erfolgreich, dass Díaz mehrere Auszeichnungen wie beispielsweise den Pulitzer Preis gewann. Sein Werk lässt sich dem Genre des Diktatorenromans zuordnen. Anders als bei der üblichen Vorgehensweise, bei der die Gewalt und Autorität der Figur des Diktators das zentrale Thema darstellt, stehen in diesem Roman primär einzelne Individuen und deren Leben im Vordergrund. Damit trägt Junot Díaz, der selbst in der Dominikanischen Republik geboren wurde und heute in den USA lebt, zur Rezeption der Geschichte der westindischen Inselwelt aus karibischer Perspektive bei.
Die Rezeption der karibischen Geschichte in der Literatur und anderen Wissenschaften betrachtend, wird schnell deutlich, dass diese vorwiegend aus einem okzidental geprägten Verständnis heraus interpretiert wird. So beeinflusse, laut Torres-Saillant, die westliche Sichtweise, welche nur einen „centrifugal glance“ (1997: 61) erlaubt, die Darstellung der Sachverhalte und zeige dabei „little regard for the Caribbean except for the profit or conflict that outsiders may derive from it“ (Torres-Saillant 1997: 61). Dabei, so Torres-Saillant, kollaborieren die Wissenschaftler „in perpetuating a notion that assigns meaning to the Archipelago in terms of its past, present or future connections with Western societies“ (1997: 61).
An dieser Stelle wird deutlich, dass aufgrund der Annahme, die karibische Gesellschaft befände sich in einer Disposition gegenüber dem Abendland, das einzelne Individuum vernachlässigt wird. Flores-Rodríguez zufolge würden diese Aspekte zeigen, dass die okzidental geprägte Wissenschaft den karibischen Diskurs meist aus einem Machtverhältnis heraus betrachtet. Des Weiteren deklariert sie „[that] [s]uch a discourse of “Caribbeanness” fails because it does not take into account the moveable and transnational realities of the Caribbean region, nor does it help to raise awareness of these issues beyond the hierarchies imposed by the colonial past” (2008: 92).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Diktatorenroman als literarische Gattung
- Die dominikanische Diktaturgeschichte im 20. Jahrhundert
- Die dominikanische Diaspora in den USA
- Transnationale Identität
- Nuestra América – Identitätsbildung zu Zeiten von José Martí
- Transnationale Identität der Charaktere im Roman
- Spanglish als Ausdruck transnationaler Identität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Junot Díaz' Roman The Brief Wondrous Life of Oscar Wao und untersucht, wie die transnationale Identität der Charaktere im Roman ein zentrales Thema darstellt. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte, darunter die literarische Gattung des Diktatorenromans, die Geschichte der dominikanischen Diktatur und die damit verbundene Diaspora in den USA, den Begriff der transnationalen Identität und den Essay Nuestra América von José Martí.
- Die Rezeption der dominikanischen Geschichte aus einer transnationalen Perspektive
- Die Rolle des Diktatorenromans als literarisches Genre
- Die Entwicklung transnationaler Identitäten in der dominikanischen Diaspora
- Die Bedeutung von Nuestra América für die Identitätsbildung
- Spanglish als Ausdruck transnationaler Identität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Werk The Brief Wondrous Life of Oscar Wao von Junot Díaz vor und erklärt die Relevanz des Romans im Kontext der dominikanischen Diaspora und der trans nationalen Identität. Sie kritisiert die vorherrschende westliche Sichtweise auf die karibische Geschichte und betont die Notwendigkeit, die Rezeption dieser Geschichte aus karibischer Perspektive zu betrachten.
- Der Diktatorenroman als literarische Gattung: Dieses Kapitel analysiert die literarische Gattung des Diktatorenromans und untersucht dessen typische Merkmale. Es beleuchtet die Darstellung der Machtverhältnisse und die Rolle des Diktators als mystischer Patriarch. Die Arbeit stellt fest, dass Díaz' Roman, obwohl er sich dem Genre zuordnen lässt, einen anderen Schwerpunkt setzt: er fokussiert auf das individuelle Leben und die Geschichte der Figuren.
- Die dominikanische Diktaturgeschichte im 20. Jahrhundert: Dieses Kapitel behandelt die Geschichte der dominikanischen Diktatur unter Rafael Leónidas Trujillo Molina und die Auswirkungen auf die dominikanische Gesellschaft. Es beleuchtet die Flucht und Migration vieler Dominikaner in die USA und die Herausforderungen der Integration in die neue Gesellschaft.
- Die dominikanische Diaspora in den USA: Dieses Kapitel analysiert die Erfahrungen der dominikanischen Diaspora in den USA und untersucht die Herausforderungen und Chancen, die mit dem Leben in einer neuen Kultur verbunden sind. Es geht auf die sprachlichen Besonderheiten und die Entstehung von Spanglish ein.
- Transnationale Identität: Dieses Kapitel definiert den Begriff der transnationalen Identität und beleuchtet dessen Bedeutung im Kontext der Globalisierung und Migration. Es diskutiert die verschiedenen Aspekte der transnationalen Identität, wie die Erhaltung der kulturellen Identität, die Anpassung an die neue Kultur und die Bildung einer neuen, hybriden Identität.
- Nuestra América – Identitätsbildung zu Zeiten von José Martí: Dieses Kapitel analysiert José Martís Essay Nuestra América und untersucht dessen Bedeutung für die Identitätsbildung in Lateinamerika. Es beleuchtet die Idee einer gemeinsamen lateinamerikanischen Identität und die Notwendigkeit, sich von der kolonialen Vergangenheit zu emanzipieren.
- Transnationale Identität der Charaktere im Roman: Dieses Kapitel analysiert die transnationale Identität der Charaktere in The Brief Wondrous Life of Oscar Wao. Es untersucht, wie die Figuren mit ihrer dominikanischen Vergangenheit, der neuen Umgebung in den USA und ihren eigenen individuellen Identitäten umgehen.
- Spanglish als Ausdruck transnationaler Identität: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung von Spanglish im Roman und untersucht dessen Bedeutung als Ausdruck der transnationalen Identität. Es beleuchtet, wie Spanglish als Kommunikationsmittel und als Symbol der kulturellen Hybridität fungiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie transnationaler Identität, Diktatorenroman, dominikanischer Diaspora, Spanglish, Nuestra América und der Geschichte der dominikanischen Diktatur. Sie untersucht die Verbindung dieser Themen im Roman The Brief Wondrous Life of Oscar Wao von Junot Díaz und analysiert, wie die transnationale Identität der Charaktere durch diese Themen geprägt wird.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Junot Díaz' Diktatorenroman?
Im Gegensatz zu klassischen Diktatorenromanen steht in „The Brief Wondrous Life of Oscar Wao“ nicht die Figur des Diktators Trujillo im Zentrum, sondern das Leben einzelner Individuen in der Diaspora.
Was bedeutet transnationale Identität?
Es beschreibt eine Identität, die sich über nationale Grenzen hinweg entwickelt, wobei Menschen Merkmale ihrer Herkunftskultur und ihrer neuen Umgebung zu einer hybriden Identität verweben.
Welche Rolle spielt „Spanglish“ im Roman?
Spanglish dient als sprachlicher Ausdruck der transnationalen Identität. Es symbolisiert die kulturelle Hybridität der dominikanischen Diaspora in den USA.
Wer war Rafael Trujillo?
Trujillo war ein dominikanischer Diktator im 20. Jahrhundert, dessen brutale Herrschaft viele Menschen zur Flucht in die USA (Diaspora) zwang.
Welchen Einfluss hatte José Martí auf die Identitätsbildung?
Mit seinem Essay „Nuestra América“ forderte Martí eine eigenständige lateinamerikanische Identität, die sich von kolonialen Vorbildern emanzipiert – ein zentrales Motiv für transnationale Diskurse.
- Quote paper
- Anne Lipp (Author), 2013, Transnationale Identität als zentrales Thema im Roman "The Brief Wondrous Life of Oscar Wao" von Junot Díaz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345086