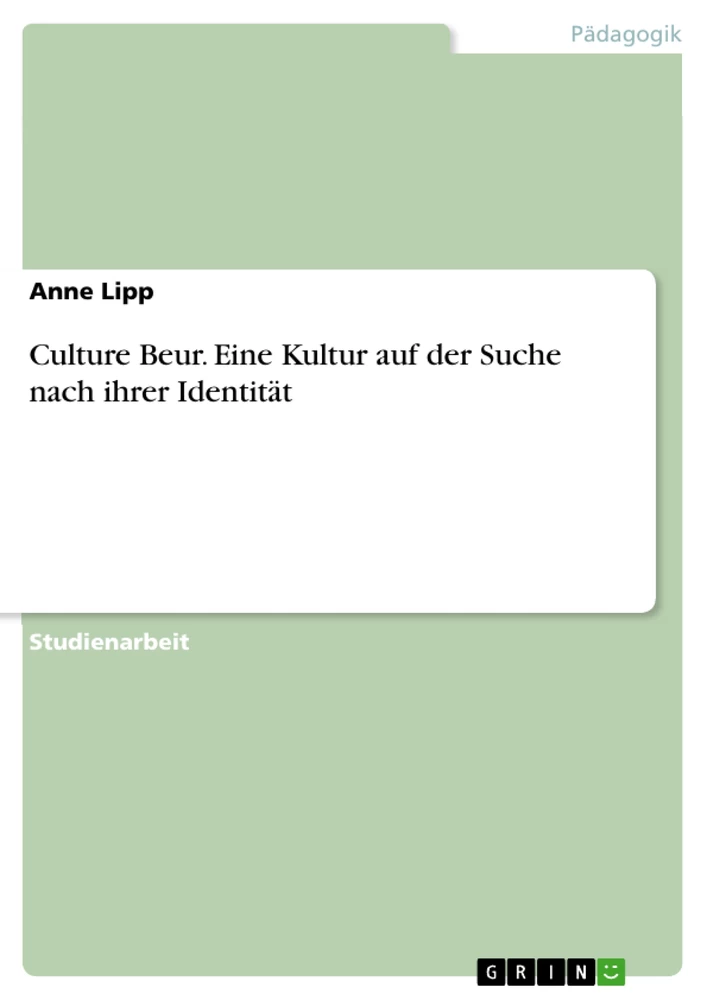Seit Anfang des neunzehnten Jahrhunderts immigrierten maghrebinische Einwanderer aus Algerien, Marokko und Tunesien nach Frankreich. Auf der Suche nach Arbeit ließen sie sich im neuen Land nieder und machen mittlerweile einen Großteil der Immigranten in Frankreich aus. Sie entwickelten eine eigene Kultur, die culture beur, welche sich als Genre in der Literatur, auf der Bühne und im Film etabliert hat.
Die erste Generation der Immigranten verließ ihr Heimatland auf Grund von wirtschaftlichen oder politischen Faktoren. Die zweite, in Frankreich geborene Generation, begann Anfang der 80er Jahre, angetrieben von einer ständigen Suche nach ihrer Identität, sich mit der eigenen und der französischen Kultur auseinander zu setzen. Aus diesem Konflikt heraus entstand die Bewegung der beur. Nicht selten führte diese Suche damals, und noch heute, zu Gefühlen wie Anziehung und Abneigung. Zum einen kommt es zur Abneigung gegenüber den traditionellen Werten der Familie, aber auch gegenüber den westlichen Werten. Zum anderen fühlen sie sich in der vertrauten maghrebinischen Kultur geborgen, sehen aber auch in der französischen Kultur ihre Vorteile.
Es kann auch zur totalen Entfremdung vom eigenen Elternhaus führen. Frankreich, als Symbol der Freiheit, Gleichheit und Modernität steht den traditionellen Werten der maghrebinischen Kultur gegenüber. Doch wie gehen die beurs mit der Situation um? So beschreibt sich Madjid, der jugendliche Protagonist in dem Roman ‘Le thé au harem d’Archi Ahmed’, verfasst von dem in Frankreich lebenden algerischen Autor Mehdi Charef, mit folgenden Worten:
„…ni arabe ni français (...), fils d’immigrés, paumé entre deux cultures, deux histoires, deux langues, deux couleurs de peau, ni blanc ni noir, à s’inventer ses propres racines.“
Die folgende Arbeit befasst sich mit der Fragestellung einer sog. beur-Identität. Dazu gehört die Analyse der culture beur, in der die Immigrationsgeschichte geklärt wird und die Auseinandersetzung mit der sozialen Situation, die von der Integration, der Rolle der Schule, die Stellung des Islams bis hin zu den politischen Aktivitäten der beurs reicht.
Diese Arbeit ist weder darauf ausgelegt eine Lösung des Problems zu geben, noch soll über eventuelle Perspektiven spekuliert werden. Sie soll lediglich zeigen, wie sich die Entwicklung der Identitätsfindung der maghrebinischen Einwanderer in Frankreich vollzog und welchen Einfluss die neue Umgebung auf sie hatte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel dieser Arbeit
- Ursprung der Bezeichnung beur
- Beginn der maghrebinischen Immigration nach Frankreich
- Hauptteil
- Wohnverhältnisse der Familien
- Schullaufbahn der beurs
- Schule Auslöser eines Generationskonflikts
- Leben zwischen Schule und Straße – Entstehung einer multikulturellen Subkultur
- Ausprägung des Islams
- Mouvement beur – Schaffung einer neuen beur-Identität
- Maghrebinische Schriftsteller auf der Suche nach ihrer Identität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der beur-Identität in Frankreich und analysiert die culture beur, die Entstehung und Entwicklung der Bewegung der beurs sowie die sozialen, kulturellen und politischen Aspekte, die diese Identität prägen. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen der Integration, die Rolle der Schule, die Stellung des Islams und die politischen Aktivitäten der beurs.
- Die Entstehung der beur-Identität in Frankreich
- Die culture beur und ihre Bedeutung für die Integration
- Die Rolle der Schule im Kontext der Integration und des Generationskonflikts
- Die Ausprägung des Islams in der beur-Kultur
- Die politischen Aktivitäten und die Suche nach einer neuen Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt das Ziel der Arbeit, klärt den Ursprung der Bezeichnung beur und beleuchtet die Geschichte der maghrebinischen Einwanderung nach Frankreich. Der Hauptteil beleuchtet die Wohnverhältnisse der Familien, die Schullaufbahn der beurs, die Entstehung eines Generationskonflikts und die Ausprägung einer multikulturellen Subkultur. Des Weiteren werden die Ausprägung des Islams, die Entstehung einer neuen beur-Identität und die Suche maghrebinischer Schriftsteller nach ihrer Identität betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen: beur-Identität, culture beur, maghrebinische Einwanderung, Integration, Schule, Generationskonflikt, multikulturelle Subkultur, Islam, Mouvement beur, maghrebinische Schriftsteller, Identität, Frankreich.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „culture beur“?
Er bezeichnet die Kultur der in Frankreich geborenen zweiten Generation maghrebinischer Einwanderer, die sich in Literatur, Film und Musik etabliert hat.
Welchen Identitätskonflikt erleben die „beurs“?
Sie fühlen sich oft „weder als Araber noch als Franzosen“ und stehen im Spannungsfeld zwischen den traditionellen Werten ihrer Familien und den westlichen Werten Frankreichs.
Welche Rolle spielt die Schule bei der Integration?
Die Schule wirkt oft als Auslöser für Generationskonflikte, da sie moderne westliche Werte vermittelt, die im Kontrast zum Elternhaus stehen können.
Was ist das „Mouvement beur“?
Es ist eine soziale und politische Bewegung, die Anfang der 80er Jahre entstand, um für die Rechte und die Anerkennung der Identität maghrebinischstämmiger Menschen zu kämpfen.
Wie wird der Islam in der beur-Kultur ausgeprägt?
Die Arbeit analysiert, wie die Religion im Kontext der Suche nach einer neuen, multikulturellen Identität in Frankreich gelebt und interpretiert wird.
- Quote paper
- Anne Lipp (Author), 2009, Culture Beur. Eine Kultur auf der Suche nach ihrer Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345102