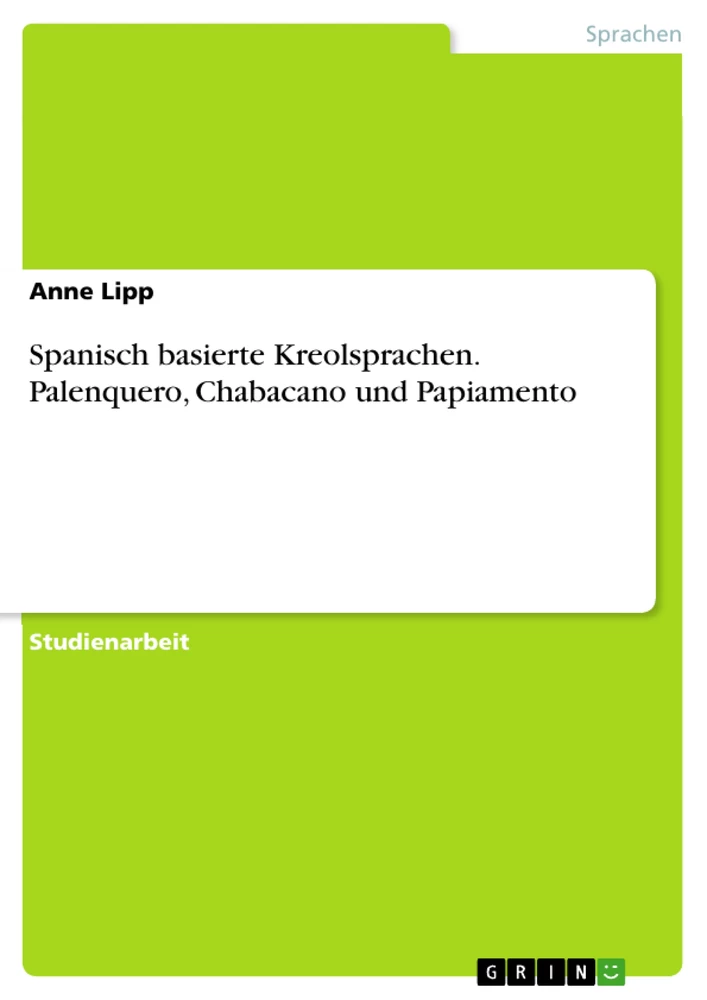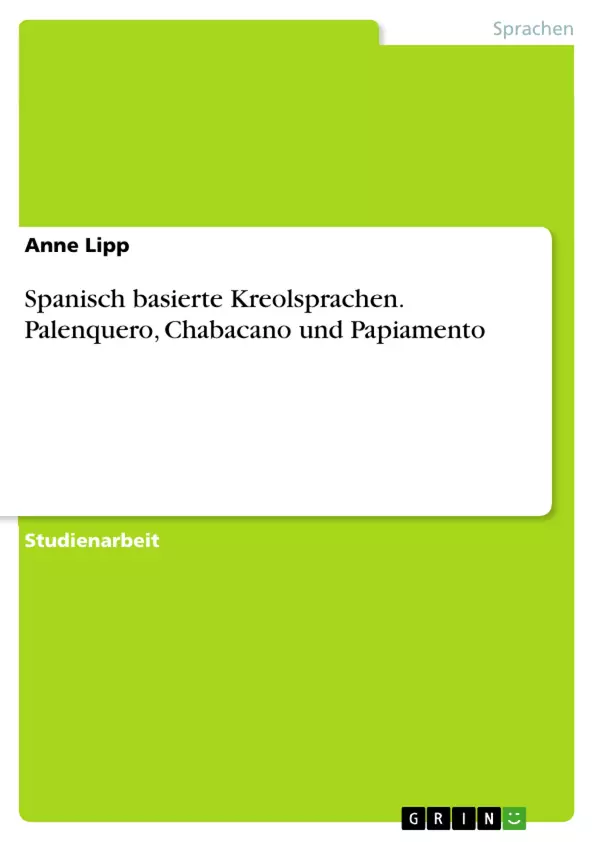Weltweit existieren drei spanisch basierte Kreolsprachen: das Palenquero, das eine Minderheitensprache in Kolumbien darstellt, das Chabacano, welches den Oberbegriff für die auf den Philippinen verwendeten Varietäten bildet, und das Papiamento, das auf den ABC-Inseln gesprochen wird. Die kleinste Sprachgemeinschaft der drei Kreolsprachen bildet das Palenquero mit seinen 4000 Sprechern, wohingegen die Varietäten des Chabacano ungefähr 500000 und die des Papiamento etwa 300000 Sprecher umfassen.
Angesichts dieser geringen Zahlen, gerade in Bezug auf das Palenquero, welches als besonders gefährdet gilt, muss „ihre Zukunft als unsicher angesehen werden“ (Pfleiderer 1998: 5). Aufgrund dieses Umstands existieren viele Revitalisierungsversuche, die von den Mitgliedern der Sprachgemeinschaft, Linguisten, Politikern und anderen Persönlichkeiten und Gruppierungen durchgeführt werden, um einem eventuellen Sprachtod entgegenzuwirken.
Im Folgenden soll nun eine Betrachtung der neueren Sprachgeschichte dieser drei spanisch basierten Kreolsprachen stattfinden. Dabei werden die Versuche und Umsetzung ihrer Normierung und die damit verbundene Sprachpolitik näher analysiert. Weitere wichtige Aspekte bilden diesbezüglich der Sprachkontakt, hier beispielsweise das Code-Switching, und dessen Einfluss auf die Minderheitensprachen und die Soziolinguistik.
Die Quellenlage zum Gegenstand dieser Arbeit ist sehr ergiebig. Eine Vielzahl der Bibliotheken Berlins und Brandenburgs, insbesondere das Iberoamerikanische Institut, bieten einen weit gefächerten Korpus an Literatur an.
Grundlegend für die Untersuchung der Lengua Palenquera ist die Magisterarbeit Sprachtod und Revitalisierung der spanisch basierten Kreolsprache Palenquero (Kolumbien) von Bettina Pfleiderer, da sie sich eingehend mit allen in dieser Arbeit zu analysierenden Parametern befasst. Die Verwendung der Magisterarbeit Das Chabacano als spanisch basierte Kreolsprache – Forschungsgeschichte und Stand der Forschung von Franziska Arndt und die Publikation Die Iberoromanische Kreolsprache Papiamento von Johannes Kramer begründet sich unter anderem darin, dass es sich hierbei um die neuesten und vollständigsten Werke zu den beiden Kreolsprachen handelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Palenquero
- 2.1 Neuere Sprachgeschichte
- 2.2 Normierung
- 2.3 Sprachpolitik
- 2.4 Sprachkontakt
- 2.5 Soziolinguistik
- 3. Chabacano
- 3.1 Neuere Sprachgeschichte und Sprachpolitik
- 3.2 Normierung
- 3.3 Sprachkontakt
- 3.4 Soziolinguistik
- 4. Papiamento
- 4.1 Neuere Sprachgeschichte und Sprachpolitik
- 4.2 Normierung
- 4.3 Sprachkontakt
- 4.4 Soziolinguistik
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die neueren Sprachgeschichten dreier spanisch-basierter Kreolsprachen: Palenquero, Chabacano und Papiamento. Die Zielsetzung besteht darin, die Versuche der Normierung dieser Sprachen, die damit verbundene Sprachpolitik, den Sprachkontakt und dessen soziolinguistische Auswirkungen zu analysieren. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Palenquero, einer besonders gefährdeten Sprache.
- Neuere Sprachgeschichte von Palenquero, Chabacano und Papiamento
- Normierungsversuche der drei Kreolsprachen
- Sprachpolitik in Bezug auf die drei Kreolsprachen
- Sprachkontakt und Code-Switching
- Soziolinguistische Aspekte der drei Kreolsprachen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die drei spanisch-basierten Kreolsprachen Palenquero, Chabacano und Papiamento vor und vergleicht ihre Sprecherzahlen. Sie hebt die Gefährdung des Palenquero hervor und betont die Notwendigkeit von Revitalisierungsversuchen. Die Arbeit kündigt die Analyse der neueren Sprachgeschichte, Normierung, Sprachpolitik, Sprachkontakt und soziolinguistische Aspekte dieser Sprachen an. Die Einleitung beschreibt auch die umfangreiche Quellenlage, insbesondere die Magisterarbeiten von Pfleiderer und Arndt, sowie die Publikation von Kramer, die als Grundlage der Untersuchung dienen.
2. Palenquero: Dieses Kapitel befasst sich mit der Lengua Palenquera, einer Kreolsprache mit spanischer lexikalischer Basis und morfosyntaktischen Merkmalen afrikanischer Bantusprachen. Es beschreibt die geringe Anzahl der Sprecher und den Rückgang der Sprachverwendung, der durch zunehmende Migration und den Anschluss an die kolumbianische Infrastruktur in den 1950er und 1970er Jahren verstärkt wurde. Ein zentraler Punkt ist die Darstellung des Versuchs einer Normierung durch Patiño Rosselli in Zusammenarbeit mit dem Programa de Etnoeducación, mit Fokus auf die Herausforderungen und den begrenzten Erfolg dieses Projekts, welches primär auf den Unterricht ausgerichtet war.
2.3 Sprachpolitik: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf das 1978 initiierte kolumbianische Programa de Etnoeducación, das ursprünglich für indigene Gemeinden gedacht war und später auf afrokolumbianische Gemeinden ausgeweitet wurde. Das Programm zielte auf die Stärkung der Identität und die Durchsetzung der Rechte dieser Bevölkerungsgruppen. Die Einführung des Palenquero als Unterrichtsfach 1989 und die neue Verfassung von 1991 mit Artikeln, die die sprachliche Vielfalt Kolumbiens anerkennen, werden als wichtige Meilensteine der Sprachpolitik für das Palenquero hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Palenquero, Chabacano, Papiamento, Kreolsprachen, spanisch-basierte Kreolsprachen, Sprachgeschichte, Normierung, Sprachpolitik, Sprachkontakt, Code-Switching, Soziolinguistik, Sprachtod, Revitalisierung, Minderheitensprachen, Kolumbien, Philippinen, ABC-Inseln, Programa de Etnoeducación.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse spanisch-basierter Kreolsprachen (Palenquero, Chabacano, Papiamento)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die neueren Sprachgeschichten dreier spanisch-basierter Kreolsprachen: Palenquero, Chabacano und Papiamento. Der Fokus liegt auf den Versuchen der Normierung dieser Sprachen, der damit verbundenen Sprachpolitik, dem Sprachkontakt und den soziolinguistischen Auswirkungen.
Welche Sprachen werden im Detail untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf Palenquero, Chabacano und Papiamento. Besonders ausführlich wird die gefährdete Sprache Palenquero behandelt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: neuere Sprachgeschichte, Normierungsversuche, Sprachpolitik, Sprachkontakt (inkl. Code-Switching) und soziolinguistische Aspekte der drei Kreolsprachen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Palenquero (inkl. Unterkapitel zu neuerer Sprachgeschichte, Normierung, Sprachpolitik, Sprachkontakt und Soziolinguistik), Chabacano (mit ähnlichen Unterkapiteln wie Palenquero), Papiamento (ebenfalls mit vergleichbaren Unterkapiteln) und Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung besteht in der Analyse der Normierungsversuche, der Sprachpolitik, des Sprachkontakts und der soziolinguistischen Auswirkungen auf die drei untersuchten Kreolsprachen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Palenquero aufgrund seiner Gefährdung.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert unter anderem auf den Magisterarbeiten von Pfleiderer und Arndt sowie der Publikation von Kramer.
Wie wird Palenquero in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel über Palenquero beschreibt die geringe Sprecherzahl und den Rückgang der Sprachverwendung. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Normierungsversuch von Patiño Rosselli im Rahmen des Programa de Etnoeducación und dessen Herausforderungen und begrenzten Erfolg.
Welche Rolle spielt die Sprachpolitik für Palenquero?
Der Abschnitt zur Sprachpolitik beleuchtet das kolumbianische Programa de Etnoeducación (ab 1978), die Einführung des Palenquero als Unterrichtsfach (1989) und die Anerkennung der sprachlichen Vielfalt in der kolumbianischen Verfassung von 1991 als wichtige Meilensteine.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Palenquero, Chabacano, Papiamento, Kreolsprachen, spanisch-basierte Kreolsprachen, Sprachgeschichte, Normierung, Sprachpolitik, Sprachkontakt, Code-Switching, Soziolinguistik, Sprachtod, Revitalisierung, Minderheitensprachen, Kolumbien, Philippinen, ABC-Inseln, Programa de Etnoeducación.
- Quote paper
- Anne Lipp (Author), 2014, Spanisch basierte Kreolsprachen. Palenquero, Chabacano und Papiamento, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345108