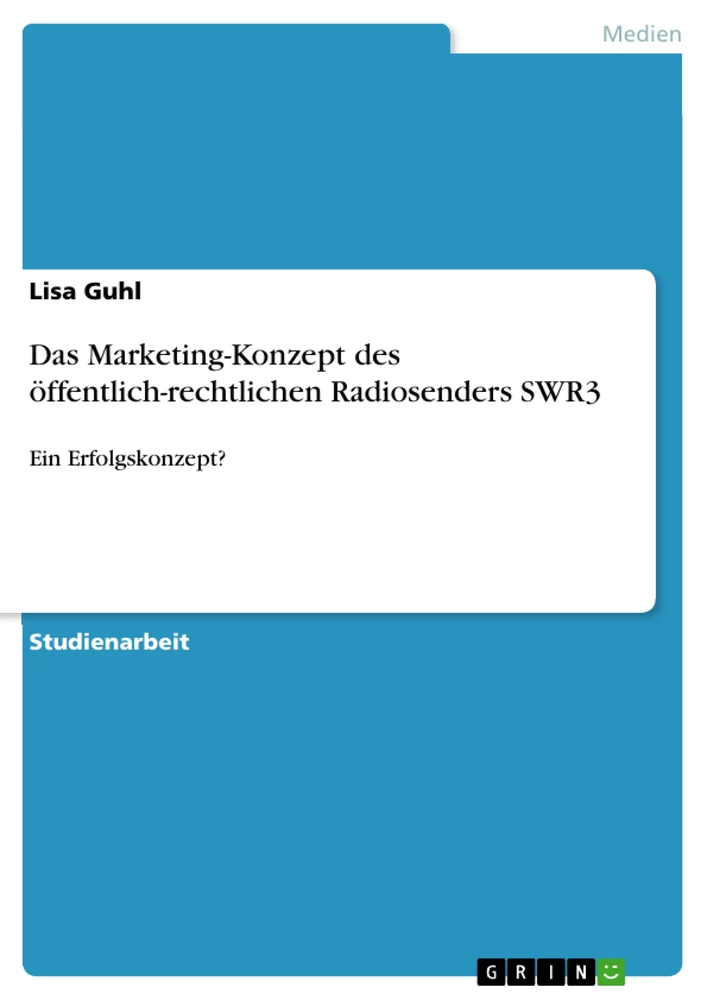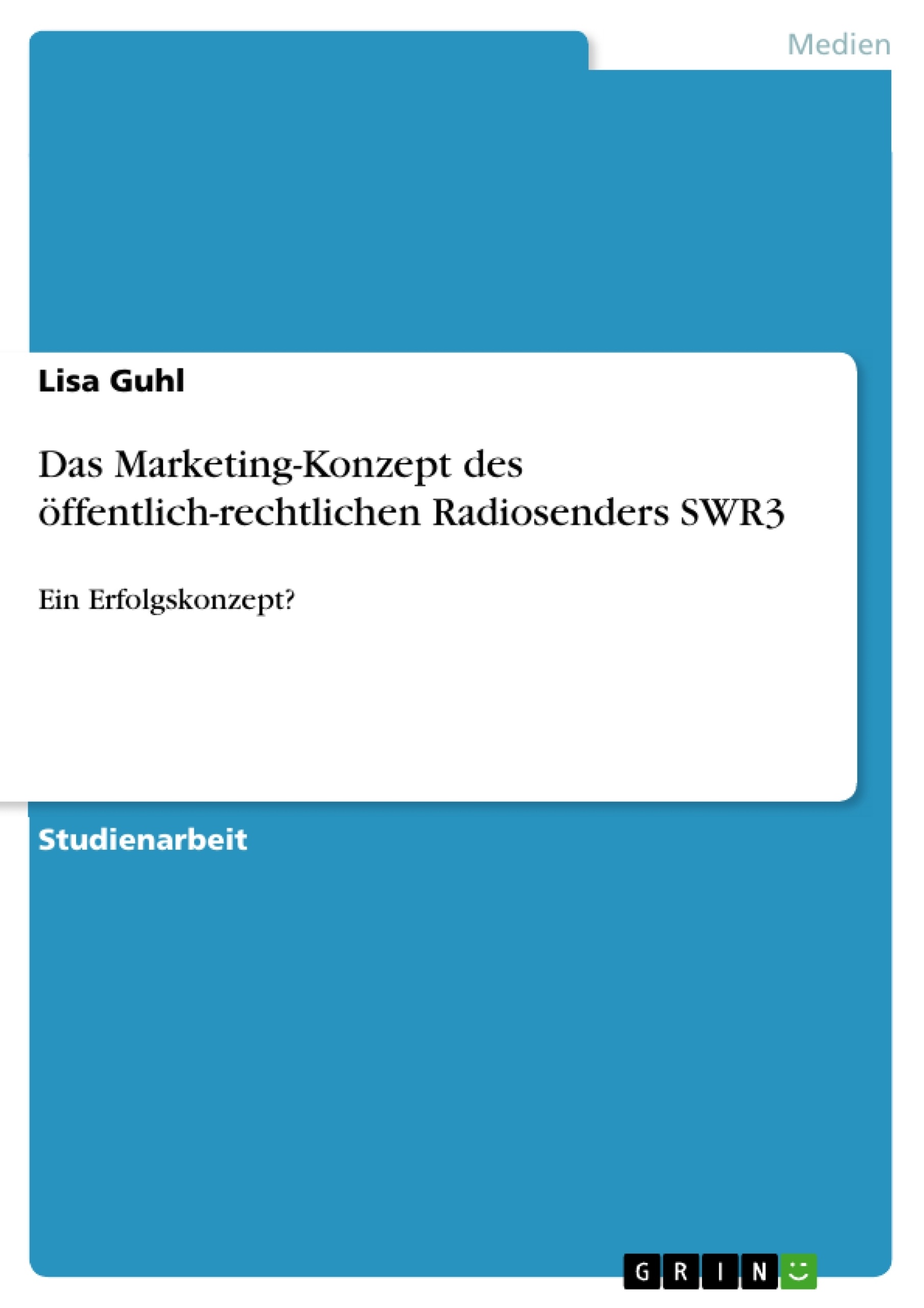Als dritter Radiosender des Südwestrundfunks (SWR) agiert „SWR3 – Deutschlands meistgehörtes öffentlich-rechtliches Radio“ (SWR Media Services 1: 3) auf dem Hörfunkmarkt. Radio als Synonym für Hörfunk bildet zusammen mit dem Fernsehen als elektronisches Massenmedium den Rundfunk. Unter dem Begriff „Radio“ (lat. „radius“ - der Strahl) wird sowohl das technische Empfangsgerät als auch das Medium selbst verstanden (vgl. Wirtz 2013: 495ff.). Die vorliegende Arbeit behandelt Radio als Hörfunksender mit seinem Produkt bestehend aus Information und Unterhaltung.
Im Gegensatz zu konsum- oder industriegüterproduzierenden Unternehmen agieren Medienunternehmen im Allgemeinen auf einem dualen Markt: dem Rezipienten- und dem Werbemarkt. Es entsteht ein Konflikt zwischen publizistischen Ansprüchen und ökonomischen Zielsetzungen. Wird zusätzlich die gesellschaftliche und politische Bedeutung betrachtet, stellen sich besondere Anforderungen an das Marketing. Auch wenn der Werbemarkt bei einem öffentlich-rechtlichen Sender wie SWR3 eine weniger große Rolle spielt als bei privatwirtschaftlichen Sendern, so gelten diese besonderen Anforderungen dennoch für SWR3 als Medienunternehmen. Durch die Einführung des dualen Rundfunksystems und die fortschreitende Digitalisierung herrscht auf dem Radiomarkt eine hohe Rivalität unter den Wettbewerbern (vgl. Pezoldt/Sattler 2009: 1/29). Dennoch stellt sich die Frage, ob öffentlich-rechtliche Sender durch ihre Gebührenfinanzierung überhaupt im Wettbewerb stehen und daher eines Marketings bedürfen. Ein weiteres Problem ergibt sich bezüglich der Marktfähigkeit von frei empfangbaren Hörfunkprogrammen wie SWR3. Im Gegensatz zur Werbung, welche als privates Gut voll marktfähig ist, handelt es sich beim Programm selbst um ein nicht marktfähiges öffentliches Gut. Nichtausschließbarkeit vom Konsum (kein Rezipient kann an der Nutzung gehindert werden) und Nichtrivalität im Konsum (Inhalte nutzen sich durch Konsum nicht ab) führen dazu, dass Preisforderungen durch fehlende Eigentumsrechte nicht durchgesetzt werden können (vgl. Wirtz 2013: 42/496; Heinrich 2010: 26). Daraus ergibt sich die Frage, wie ein solches Gut erfolgreich vermarktet werden könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Öffentlich-rechtlicher Hörfunkmarkt
- Nutzung des Mediums Radio
- Marketing im dualen Rundfunksystem
- SWR3 als öffentlich-rechtlicher Radiosender
- Entstehung und Entwicklung
- Zielgruppe und Marketingziele
- Marketing-Instrumente
- Produktpolitik
- Preispolitik
- Kommunikationspolitik
- Marke
- Verkaufsförderung
- Events und Social Media
- Distributionspolitik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert das Marketing-Konzept des öffentlich-rechtlichen Radiosenders SWR3 und untersucht dessen Erfolgsfaktoren. Ziel ist es, die Strategien und Maßnahmen von SWR3 im Kontext des dualen Rundfunksystems zu beleuchten und deren Wirksamkeit im Hinblick auf die Zielgruppe und die gesteckten Marketingziele zu bewerten.
- Marketing im dualen Rundfunksystem
- Zielgruppe und Marketingziele von SWR3
- Analyse der Marketing-Instrumente von SWR3
- Bewertung des Erfolgs des Marketing-Konzepts von SWR3
- Relevanz von Social Media und Events im Marketing-Mix von SWR3
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und beschreibt die Relevanz des Themas im Kontext des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems. Sie skizziert die Forschungsfragen und den Aufbau der Arbeit.
- Öffentlich-rechtlicher Hörfunkmarkt: Dieses Kapitel beleuchtet die Nutzung des Mediums Radio im Allgemeinen und betrachtet die Besonderheiten des Marketing im dualen Rundfunksystem. Es werden die Herausforderungen und Chancen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einem kompetitiven Medienumfeld diskutiert.
- SWR3 als öffentlich-rechtlicher Radiosender: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung des Radiosenders SWR3. Es analysiert die Zielgruppe und die Marketingziele, die SWR3 verfolgt.
- Marketing-Instrumente: Dieses Kapitel untersucht die einzelnen Marketing-Instrumente, die SWR3 einsetzt. Es analysiert die Produktpolitik, die Preispolitik, die Kommunikationspolitik und die Distributionspolitik des Senders.
Schlüsselwörter
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, SWR3, Marketing, Radio, Zielgruppe, Marketingziele, Produktpolitik, Preispolitik, Kommunikationspolitik, Distributionspolitik, Social Media, Events, duales Rundfunksystem, Erfolgsfaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Braucht ein öffentlich-rechtlicher Sender wie SWR3 überhaupt Marketing?
Ja, aufgrund der hohen Rivalität im dualen Rundfunksystem und der Digitalisierung muss sich auch SWR3 im Wettbewerb positionieren, um Hörer zu binden.
Was ist die Zielgruppe von SWR3?
SWR3 richtet sich an eine breite Zielgruppe im Südwesten Deutschlands, wobei der Fokus auf einer modernen, informations- und unterhaltungsorientierten Hörerschaft liegt.
Welche Rolle spielen Events im Marketing-Mix?
Events wie das SWR3 New Pop Festival sind zentrale Instrumente der Kommunikationspolitik, um die Marke erlebbar zu machen und die Hörerbindung zu stärken.
Wie geht SWR3 mit dem Problem der "Nichtmarktfähigkeit" um?
Da das Programm ein öffentliches Gut ist, setzt SWR3 auf Markenbildung und Zusatzleistungen, um trotz Gebührenfinanzierung erfolgreich am Markt zu agieren.
Wie wichtig ist Social Media für den Radiosender?
Social Media ist ein essenzieller Bestandteil der Kommunikations- und Distributionspolitik, um Interaktion mit den Rezipienten in Echtzeit zu ermöglichen.
- Quote paper
- Lisa Guhl (Author), 2014, Das Marketing-Konzept des öffentlich-rechtlichen Radiosenders SWR3, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345236