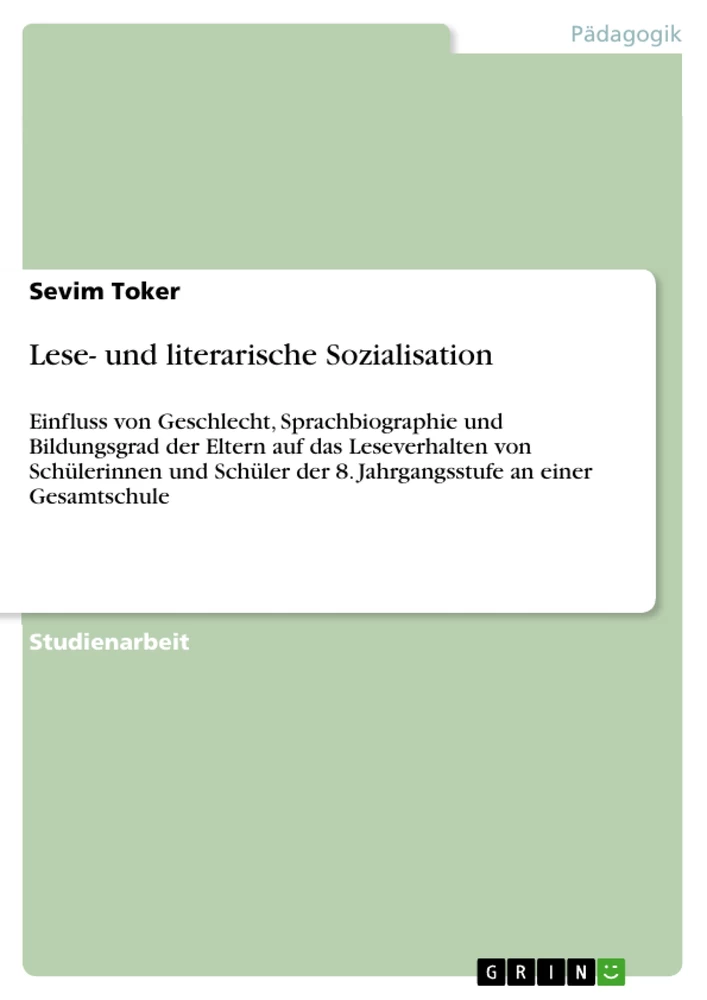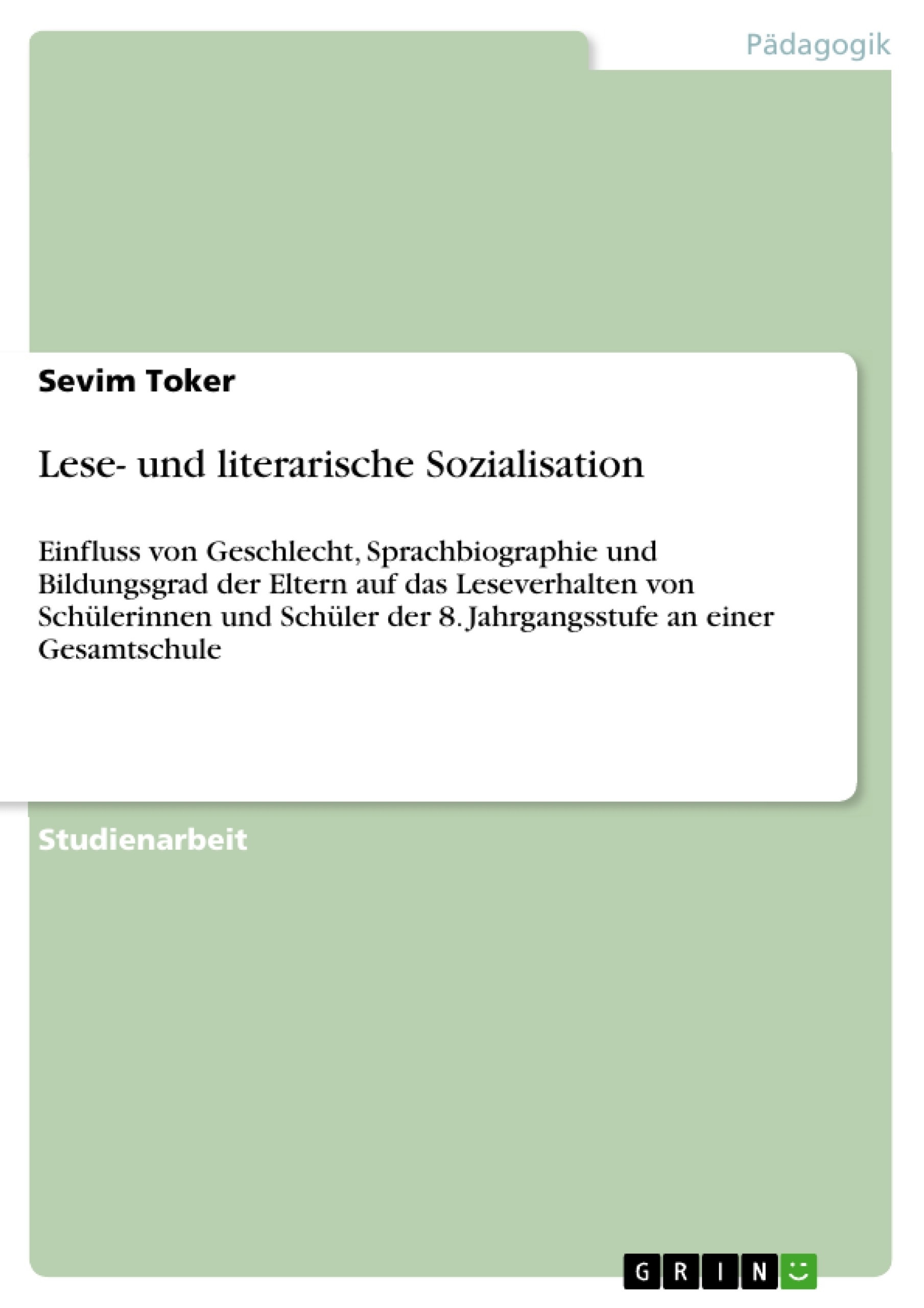Lesen stellt in der heutigen Gesellschaft eine Schlüsselkompetenz für Bildungserfolg dar. Es ist der Schlüssel zum Wissen und zum Verstehen unserer Welt.
Seit den PISA-Ergebnissen aus dem Jahre 2000 ist jedoch bekannt, dass Jugendliche in puncto lesen viel aufzuholen haben: knapp ein Viertel der getesteten Schülerinnen und Schüler hatten Schwierigkeiten einfache Texte verschiedenster Art auf elementarer Ebene zu verstehen und nahezu die Hälfte aller Getesteten gab an, nicht gerne zu lesen. Als Konsequenz wurden bundesweite Bildungsstandards beschlossen. Dieser sogenannte PISA-Schock war der ´Auslöser´ für die didaktische Forderung, die Lesekompetenz (in allen Fächern) zu entwickeln und zu fördern.
Dem Deutschunterricht wurde und wird in dieser Aufgabe eine zentrale Funktion zugesprochen: so ist in den Bildungsstandards für das Fach Deutsch die Entwicklung und Förderung der Lesekompetenz integraler Bestandteil aller Kompetenzbereiche. Darin heißt es, dass „die Schülerinnen und Schüler über grundlegende Verfahren für das Verstehen von Texten [verfügen sollen], was Leseinteresse sowie Lesefreude fördert und zur Ausbildung von Empathie und Fremdverstehen beiträgt“. Außerdem sollen sie „verschiedene Lesetechniken beherrschen, über grundlegende Lesefertigkeiten verfügen: flüssig, sinnbezogen, überfliegend, selektiv, navigierend (z.B. Bild-Ton-Text integrierend) lesen[,] Strategien zum Lesen kennen und anwenden, Leseerwartungen und -erfahrungen bewusst nutzen“.
Neben der oben genannten didaktischen Forderung, zogen die internationalen Vergleichsstudien eine wichtige und berechtigte Frage nach sich, nämlich worauf die unterdurchschnittlichen Leistungen der Schülerinnen und Schülern zurückzuführen sind.
Damit rückte ein weiteres wichtiges Ergebnis in den Mittelpunkt von Forschung und Unterrichtsarbeit: aus den Resultaten ging hervor, dass das Leseverhalten durch verschiedene Faktoren maßgeblich beeinflusst wird, nämlich durch Geschlecht und Bildungsstatus der Eltern. Weitere Studien weisen auf geschlechterspezifische Unterschiede im Umgang mit Literatur und auf die Bedeutung von Familie für das Leseverhalten hin.
Inhaltsverzeichnis
- Forschungsthematik
- Herleitung und Relevanz der Forschungsthematik
- Theoretische Verortung
- Begriffsdefinition Leseverhalten
- Darstellung des Forschungsstandes
- Methodik
- Darstellung der Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit untersucht den Einfluss von Geschlecht, Sprachbiografie und dem Bildungsgrad der Eltern auf das Leseverhalten von Achtklässlern an einer Velberter Gesamtschule. Das Hauptziel ist es, den aktuellen Zusammenhang zwischen Leseverhalten und diesen Einflussfaktoren zu überprüfen und die Forschungslücke bezüglich des Einflusses von Mehrsprachigkeit zu schließen. Die Ergebnisse sollen die bisherigen Studien überprüfen und gegebenenfalls erweitern.
- Einfluss des Geschlechts auf das Leseverhalten
- Auswirkung des Bildungsstands der Eltern auf das Leseverhalten
- Bedeutung der Sprachbiografie (insbesondere Mehrsprachigkeit) für das Leseverhalten
- Lesekompetenz und Lesefreude im Kontext der untersuchten Faktoren
- Aktuelle Relevanz von PISA-Ergebnissen im Hinblick auf Lesekompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Forschungsthematik: Diese Arbeit konzentriert sich auf literarische und Lesesozialisation, untersucht anhand einer quantitativen Studie das Leseverhalten von Achtklässlern und den Einfluss von Geschlecht, Sprachbiografie und elterlichem Bildungsstatus darauf. Der Fokus liegt auf der Überprüfung bestehender Forschungsergebnisse und der Erforschung des Einflusses von Mehrsprachigkeit.
Herleitung und Relevanz der Forschungsthematik: Dieses Kapitel unterstreicht die Bedeutung von Lesekompetenz als Schlüsselqualifikation und verweist auf die Ergebnisse von PISA-Studien, die Defizite bei Jugendlichen aufzeigen. Es erläutert die didaktische Notwendigkeit, Lesekompetenz zu fördern und untersucht die Faktoren, die das Leseverhalten beeinflussen, insbesondere Geschlecht und elterlicher Bildungsstatus, sowie die bisher unerforschte Rolle der Sprachbiografie, insbesondere von Mehrsprachigkeit.
Theoretische Verortung: Der Begriff "Leseverhalten" wird definiert, indem Aspekte wie Lesequantität, -frequenz, Lesestoffe, -präferenzen, -weisen, -freude, -neigung und -kompetenz unterschieden werden. Der Forschungsstand wird dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf dem Einfluss von Geschlecht und sozialer Herkunft auf Leseneigungen und -fähigkeiten liegt. Die KIM- und JIM-Studien werden als relevante Quellen genannt.
Schlüsselwörter
Leseverhalten, Lesesozialisation, literarische Sozialisation, Geschlecht, Sprachbiografie, Mehrsprachigkeit, Bildungsgrad der Eltern, PISA-Studie, KIM-Studie, JIM-Studie, Lesekompetenz, quantitative Studie, Achtklässler.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Forschungsarbeit: Einflussfaktoren auf das Leseverhalten von Achtklässlern
Was ist das Thema der Forschungsarbeit?
Die Forschungsarbeit untersucht den Einfluss von Geschlecht, Sprachbiografie und dem Bildungsgrad der Eltern auf das Leseverhalten von Achtklässlern an einer Velberter Gesamtschule. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Einfluss von Mehrsprachigkeit.
Welche Ziele verfolgt die Studie?
Die Studie zielt darauf ab, den aktuellen Zusammenhang zwischen Leseverhalten und den genannten Einflussfaktoren zu überprüfen und die Forschungslücke bezüglich des Einflusses von Mehrsprachigkeit zu schließen. Die Ergebnisse sollen bestehende Studien überprüfen und gegebenenfalls erweitern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss des Geschlechts, des Bildungsstands der Eltern und der Sprachbiografie (insbesondere Mehrsprachigkeit) auf das Leseverhalten. Weiterhin werden Lesekompetenz und Lesefreude im Kontext der untersuchten Faktoren sowie die Relevanz von PISA-Ergebnissen betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Forschungsthematik, Herleitung und Relevanz der Forschungsthematik, Theoretische Verortung (inkl. Begriffsdefinition Leseverhalten und Darstellung des Forschungsstandes), Methodik, Darstellung der Ergebnisse, Literaturverzeichnis und Anhang.
Wie wird der Begriff "Leseverhalten" definiert?
Der Begriff "Leseverhalten" umfasst Aspekte wie Lesequantität, -frequenz, Lesestoffe, -präferenzen, -weisen, -freude, -neigung und -kompetenz.
Welche Studien werden als Grundlage herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf relevante Studien wie PISA-, KIM- und JIM-Studien, um den Forschungsstand darzustellen und die eigenen Ergebnisse einzuordnen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine quantitative Methode zur Untersuchung des Leseverhaltens.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Leseverhalten, Lesesozialisation, literarische Sozialisation, Geschlecht, Sprachbiografie, Mehrsprachigkeit, Bildungsgrad der Eltern, PISA-Studie, KIM-Studie, JIM-Studie, Lesekompetenz, quantitative Studie, Achtklässler.
Welche Bedeutung hat die Studie?
Die Studie trägt dazu bei, ein besseres Verständnis der Einflussfaktoren auf das Leseverhalten von Jugendlichen zu entwickeln und somit mögliche Ansätze zur Förderung der Lesekompetenz aufzuzeigen. Sie schließt eine Forschungslücke hinsichtlich des Einflusses von Mehrsprachigkeit.
- Quote paper
- Sevim Toker (Author), 2016, Lese- und literarische Sozialisation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345286