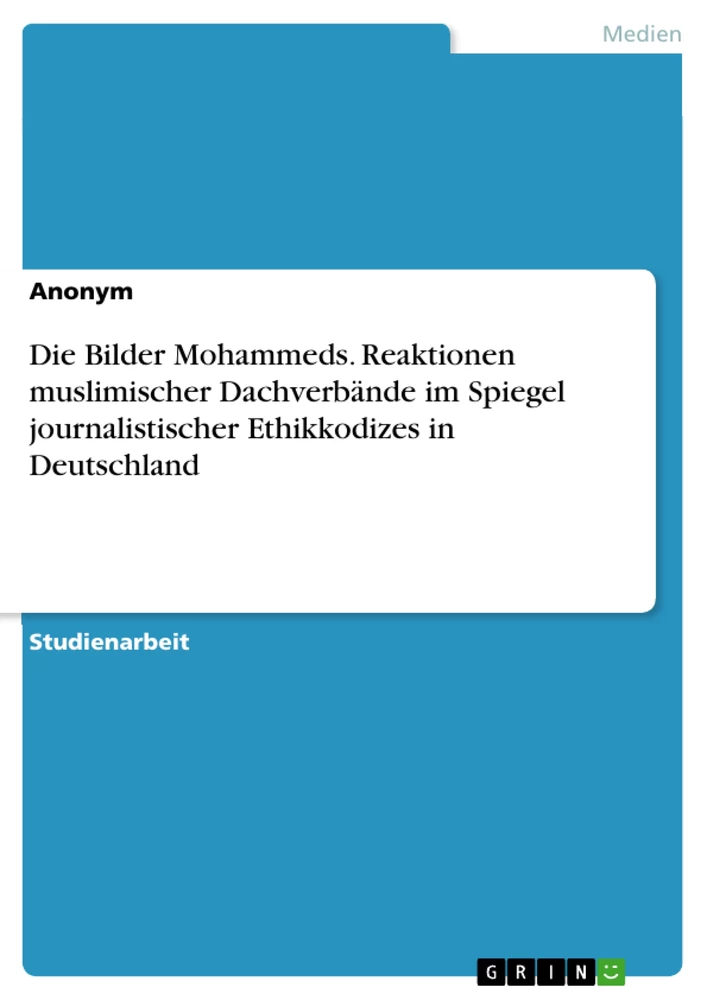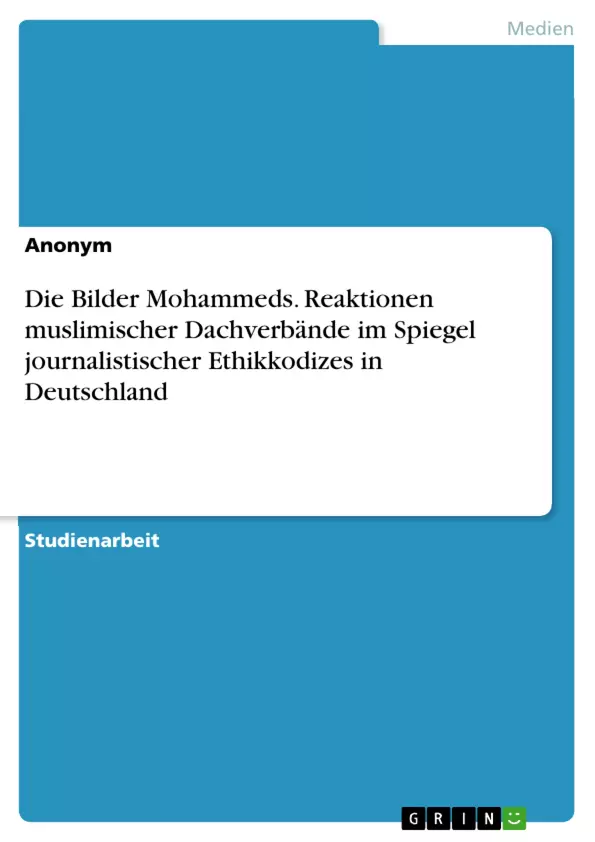Rund anderthalb Jahre sind nach der öffentlichen Debatte um die Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed vergangen. Die erstmals bereits am 30. September 2005 in der dänischen Tageszeitung „Jyllands-Posten“ veröffentlichten zwölf Bilder gingen um die Welt und lösten bei Muslimen rund um den Globus zum Teil heftige Stürme der Entrüstung aus, die sogar in Gewalt gegen Mensch und Material gipfelten. Während vornehmlich im arabischen Raum gewaltsame Proteste, besonders medienwirksame öffentliche Flaggenverbrennungen oder ähnliches als adäquate Mittel der Wut und des Entsetzen über die Karikaturen galten, blieben derartige Szenen in weiten Teilen Westeuropas aus. Das galt auch für Deutschland. Doch wie fielen die Reaktionen bei den in Deutschland lebenden Muslimen, immerhin rund 3,2 Millionen, aus? Darf man annehmen, dass insbesondere die Nachfolgegeneration der ehemals türkischen Gastarbeiter die vermeintlichen Skandal-Bilder aus einem anderen Blickwinkel sieht? Immerhin sind viele Muslime bereits in Deutschland geboren und auch aufgewachsen, in der Gesellschaft integriert und womöglich liberaler in Auslebung ihres Glaubens. Eine Welle der Entrüstung sollte dann doch nach den vorangestellten Vermutungen ausbleiben, so glaubt man. Aber ist dies wirklich so?
Diese Arbeit soll Aufschluss über die Reaktionen islamischer Dachverbände in Deutschland bringen, sie vergleichen und journalistischen Kodizes gegenüberstellen. Die Ausgangsfrage soll also sein: Besteht eine Deckungsgleichheit der Stellungnahmen islamischer Verbände in Deutschland mit journalistischen Ethikvorstellungen? Zunächst einmal sollen dazu zu Beginn des Hauptteils aber die zwei größten Verbände, der Zentralrat der Muslime und der Islamrat, im Kurzportrait vorgestellt werden. Gepaart damit sollen Ethikcodes des in Deutschland geltenden Presskodex’ knapp erörtert werden. Im Anschluss daran folgen dann eine Analyse der öffentlichen Stellungnahmen der Vertreter muslimischer Verbände sowie ein Vergleich derer mit Bestimmungen des Pressekodexes. Die Vermutung, dass sich die Reaktionen der muslimischen Verbände auf die Mohammed-Karikaturen mit den Bestimmungen der journalistischen Ethik decken, soll die vorangestellte Hauptthese bilden, die dann im Schlussteil belegt bzw. widerlegt werden und die Gesamtarbeit abrunden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Muslimische Reaktionen im Spiegel journalistischer Ethikcodes
- Muslimische Dachverbände in Deutschland
- Der Islamrat
- Der Zentralrat der Muslime
- Journalistische Pressekodizes
- Reaktionen muslimischer Dachverbände
- Muslimische Dachverbände in Deutschland
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Reaktionen islamischer Dachverbände in Deutschland auf die Mohammed-Karikaturen und stellt sie den journalistischen Ethikcodes gegenüber. Die zentrale Frage lautet: Entsprechen die Stellungnahmen islamischer Verbände in Deutschland den journalistischen Ethikvorstellungen?
- Vorstellung der beiden größten muslimischen Verbände in Deutschland: Der Islamrat und der Zentralrat der Muslime
- Analyse der Ethikcodes des in Deutschland geltenden Pressekodex'
- Bewertung der öffentlichen Stellungnahmen der muslimischen Verbände im Hinblick auf die Mohammed-Karikaturen
- Vergleich der Stellungnahmen der muslimischen Verbände mit den Bestimmungen des Pressekodex'
- Überprüfung der These, dass sich die Reaktionen der muslimischen Verbände auf die Mohammed-Karikaturen mit den Bestimmungen der journalistischen Ethik decken.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Debatte um die Mohammed-Karikaturen in den Kontext und untersucht die Reaktionen von Muslimen in Deutschland. Sie formuliert die Forschungsfrage und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Muslimische Reaktionen im Spiegel journalistischer Ethikcodes: Dieses Kapitel stellt die beiden größten muslimischen Dachverbände in Deutschland, den Islamrat und den Zentralrat der Muslime, vor. Es beschreibt ihre Ziele, Mitgliederzahlen und Auffassungen. Außerdem werden die wichtigsten Punkte des Pressekodex' hinsichtlich der Themen Religion, Weltanschauung und Diskriminierung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Islamische Dachverbände, Mohammed-Karikaturen, journalistische Ethikkodizes, Islamrat, Zentralrat der Muslime, Pressekodex, Religionsfreiheit, Diskriminierung, Integration, Islam in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagierten muslimische Dachverbände in Deutschland auf die Mohammed-Karikaturen?
Die Arbeit analysiert die offiziellen Stellungnahmen des Islamrats und des Zentralrats der Muslime und vergleicht sie mit westlichen journalistischen Standards.
Was ist der Pressekodex?
Der Pressekodex enthält ethische Richtlinien für Journalisten in Deutschland, unter anderem zum Schutz vor Diskriminierung und zur Achtung religiöser Überzeugungen.
Gibt es eine Deckungsgleichheit zwischen muslimischen Reaktionen und Medienethik?
Die Arbeit untersucht die These, ob die Forderungen der Verbände nach Respekt vor religiösen Symbolen mit den Bestimmungen des Pressekodexes vereinbar sind.
Unterscheiden sich die Reaktionen der jüngeren Muslime in Deutschland?
Es wird die Vermutung geprüft, ob in Deutschland geborene Muslime die Karikaturen aufgrund ihrer Integration liberaler betrachten als Muslime im arabischen Raum.
Wie verliefen die Proteste in Deutschland im Vergleich zum Ausland?
Während es im arabischen Raum zu gewaltsamen Ausschreitungen kam, blieben die Reaktionen in Deutschland weitgehend friedlich und auf öffentlicher Debattenebene.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2007, Die Bilder Mohammeds. Reaktionen muslimischer Dachverbände im Spiegel journalistischer Ethikkodizes in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345390