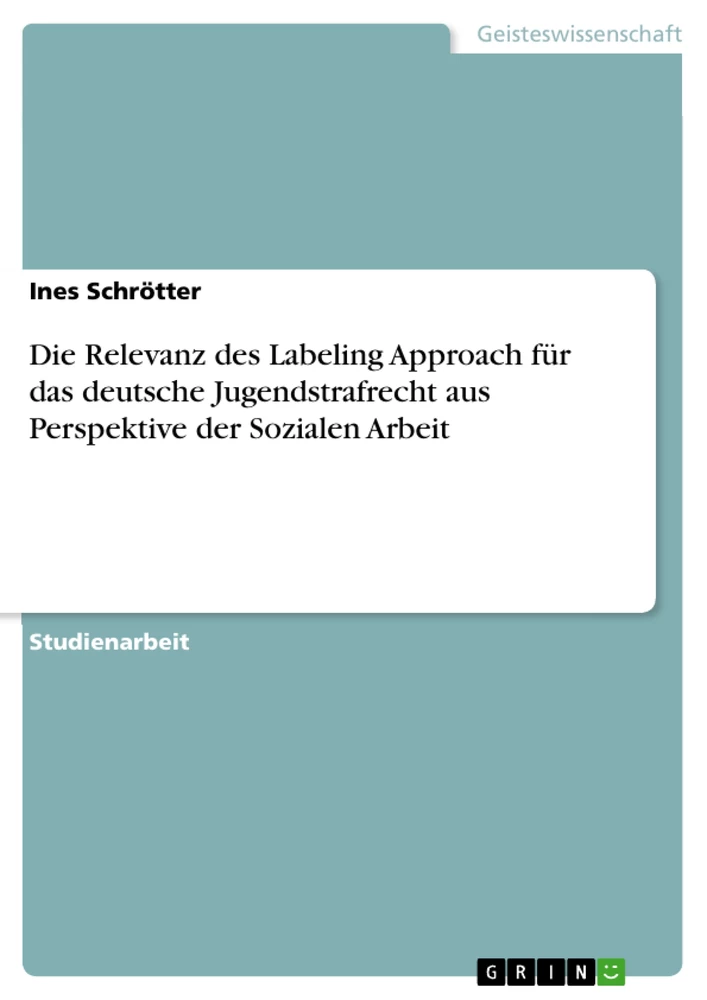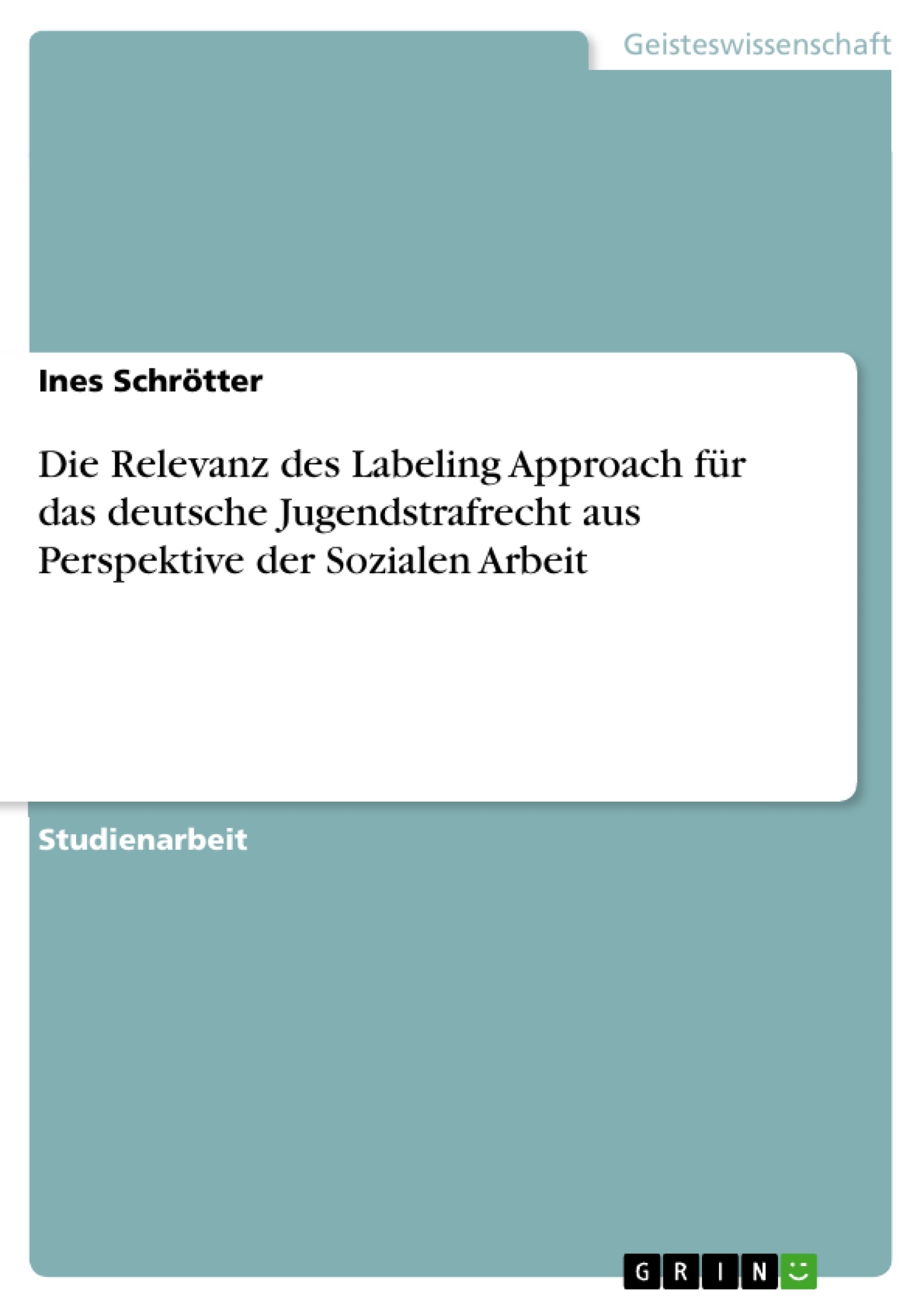Betrachtet man die Menschheit in Bezug auf die Verhaltensdetermination sozialen oder kriminellen Handelns wird es immer Abweichung und Konformität geben. In wissenschaftlichen Untersuchungen dieser beiden Aspekte wurde dem abweichenden Verhalten immer mehr Interesse entgegengebracht als dem konformen Verhalten. Letztendlich steht an erster Stelle der Untersuchungen nicht die Frage, wie konformes Verhalten entsteht, sondern welche Ursache abweichendes Verhalten hat und wie diesem entgegenzuwirken ist.
Entgegen dieser ursächlich orientierten soziologischen Theorien richtet der Labeling Approach seine Aufmerksamkeit auf die Instanzen sozialer Kontrolle, welche erst deviantes Verhalten zur Kriminalität durch Kriminalisierung erschafft. Da ein grundlegender Auftrag der Sozialen Arbeit darin besteht, sich der Differenzminimierung abweichenden Verhaltens der Klientel anzunehmen und sie durch sozialarbeiterische Interventionen zur gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen, besteht die Möglichkeit, mit Fragen des Strafrechts in Berührung zu geraten. Sollte an dieser Stelle Soziale Arbeit intervenieren, setzt das fundiertes Gundlagenwissen voraus.
Diesbezüglich möchte ich der Relevanz des Labeling Approach für das deutsche Strafrecht, speziell im Kontext von Intensivtätern, nachgehen. Zum Verständnis des Aspektes des Labeling Approach wird sich die vorliegende Arbeit anfänglich mit der Entwicklungsgeschichte des Etikettierungsansatzes auseinandersetzen. Inwieweit der Labeling Approach relevant ist für das Jugendstrafrecht und welchem wissenschaftlichen Anspruch sich die Soziale Arbeit stellen muss, soll in einem kurzen Ausblick resümiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Etikettierungstheorie: Labeling Approach
- Entwicklungsgeschichte des Labeling Approach und ihre Begründer
- Tannenbaum- Erfinder des Labeling Approach
- Lemert- Unterteilung in primäre und sekundäre Devianz
- Becker Grundlegung des Labeling Approach
- Erikson und Kitsuse- Aspekte des mikro- und makrosozialen Bereiches
- Sack- ein radikaler Ansatz
- Labeling Approach- Bedeutung für das deutsche Jugendstrafrecht bezüglich des Karrieremodels von Intensivtätern
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Labeling Approach für das deutsche Jugendstrafrecht im Kontext von Intensivtätern. Sie analysiert die historische Entwicklung des Etikettierungsansatzes und seine zentralen Elemente sowie dessen Relevanz für die Soziale Arbeit.
- Entwicklung des Labeling Approach
- Konzept der primären und sekundären Devianz
- Bedeutung des Etikettierungsansatzes für das Strafrecht
- Anwendung des Labeling Approach im Jugendstrafrecht
- Relevanz des Ansatzes für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des abweichenden Verhaltens in der wissenschaftlichen Forschung und stellt den Fokus des Labeling Approach auf die sozialen Kontrollmechanismen und deren Einfluss auf die Kriminalisierung von Verhalten heraus. Das zweite Kapitel erläutert den Labeling Approach als Etikettierungsansatz, der die Entstehung und Durchsetzung sozialer Normen und deren Einfluss auf die Zuschreibung von Devianz untersucht. Im dritten Kapitel werden die wichtigsten Begründer des Labeling Approach, Tannenbaum, Lemert, Becker, Erikson und Kitsuse sowie Sack, vorgestellt und ihre zentralen Beiträge zur Theorie erläutert. Die Bedeutung des Labeling Approach für das deutsche Jugendstrafrecht, speziell im Kontext von Intensivtätern, wird im vierten Kapitel behandelt.
Schlüsselwörter
Labeling Approach, Etikettierungstheorie, Devianz, Kriminalität, Jugendstrafrecht, Intensivtäter, Soziale Arbeit, Strafrecht, Kriminalsoziologie, symbolischer Interaktionismus, primäre Devianz, sekundäre Devianz, Stigmatisierung, soziale Kontrolle
Häufig gestellte Fragen
Was erklärt der Labeling Approach?
Der Labeling Approach (Etikettierungsansatz) besagt, dass Kriminalität erst durch die Zuschreibung und Stigmatisierung durch Instanzen der sozialen Kontrolle (wie Polizei oder Justiz) entsteht.
Was ist der Unterschied zwischen primärer und sekundärer Devianz?
Primäre Devianz ist das anfängliche abweichende Verhalten. Sekundäre Devianz entsteht, wenn die Person das Etikett "kriminell" in ihr Selbstbild übernimmt und daraufhin eine kriminelle Karriere startet.
Wer sind die wichtigsten Vertreter der Etikettierungstheorie?
Zu den Begründern zählen Frank Tannenbaum, Edwin Lemert, Howard S. Becker sowie Fritz Sack im deutschen Kontext.
Warum ist diese Theorie für das Jugendstrafrecht relevant?
Sie hilft zu verstehen, wie formelle Verfahren Jugendliche als "Intensivtäter" abstempeln und dadurch paradoxerweise zur Festigung krimineller Karrieren beitragen können.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in diesem Kontext?
Soziale Arbeit zielt auf Differenzminimierung ab und muss verhindern, dass Klienten durch Stigmatisierung dauerhaft aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden.
- Arbeit zitieren
- Ines Schrötter (Autor:in), 2014, Die Relevanz des Labeling Approach für das deutsche Jugendstrafrecht aus Perspektive der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345560