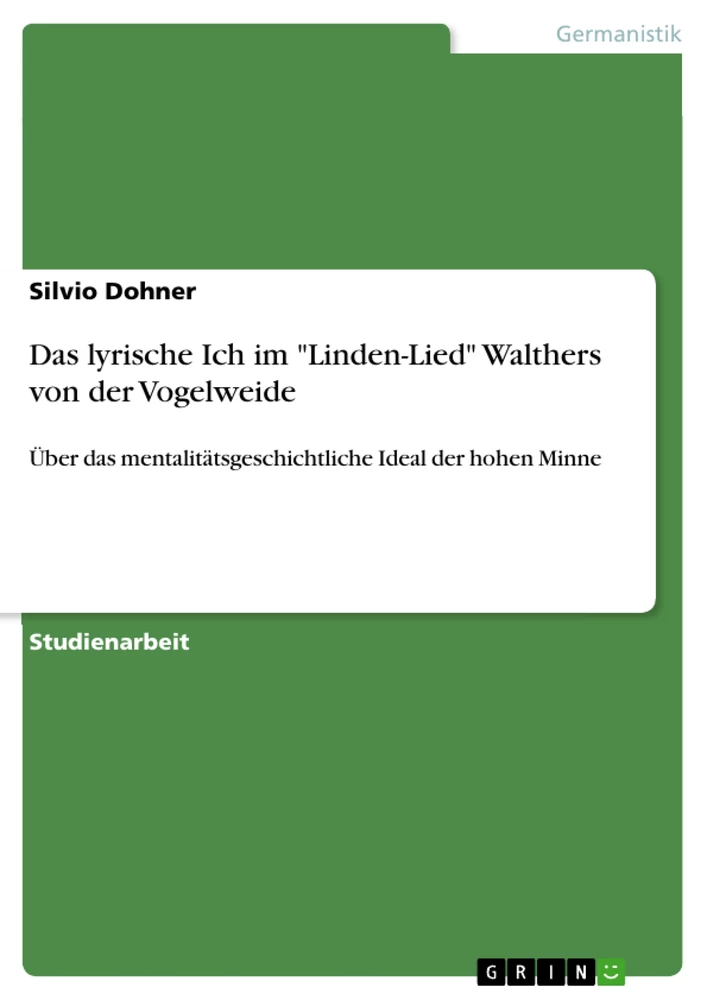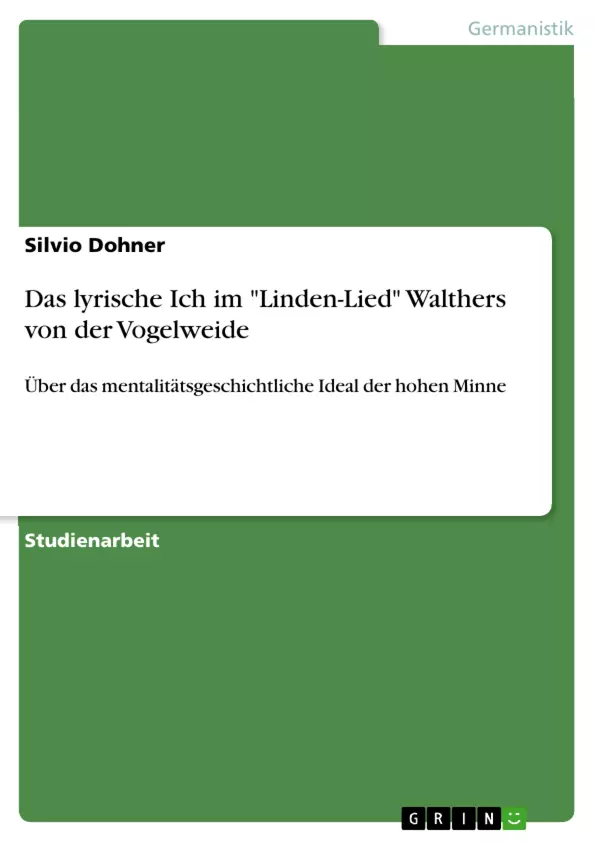In der Liebeslyrik des Mittelalters waren Blumen "Requisiten der Naturdarstellung". Oder sie symbolisierten den Verlust des Sommers und den Verdruss, den der Winter
bereitet. Je nach Liedkontext konnten die "bluomen" die Jahreszeit betonen oder den "locus amoenus" evozieren. Die Blumen standen für das Schöne an der Minne, für das
Seelenleben oder für die Sehnsucht des lyrischen Ich.
Ist es möglich, anhand des Topos' des Blumenbrechens zu ermitteln, wie das lyrische Ich zu deuten ist? Und wenn ja, was kann es und mentalitätsgeschichtlich über die den Wandel von Minne zu Liebe verraten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Liebe als Rose
- Das Brechen einer Rose
- Das liebende lyrische Ich
- Deiktische Semantik
- Liebe als Mentalitätsgeschichte
- Liebe in der Ehe
- Von Minne zu,Liebe
- Ausblick
- Von blauen Blumen und roten Rosen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem lyrischen Ich in Walthers von der Vogelweides Linden-Lied und dessen Bedeutung für die Mentalitätsgeschichte des Minnesangs. Die Untersuchung analysiert das Lied im Kontext der höfischen Liebeslyrik des Mittelalters und beleuchtet, wie das lyrische Ich das Ideal der hohen Minne in Beziehung zu Blumen und Rosen symbolisch verrät.
- Die Rolle der Blumen und Rosen als Symbole in der Minnelyrik
- Das lyrische Ich als Repräsentant einer sich wandelnden Mentalität
- Die Bedeutung von deiktischer Semantik für die Interpretation des Liedes
- Die Verbindung von Liebe, Gewalt und Sexualität im Kontext der Minne
- Die Entwicklung des Minnekonzepts von der hohen Minne zur Liebe
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des lyrischen Ichs in Walthers von der Vogelweides Linden-Lied ein und erläutert die Bedeutung von Blumen als Symbole in der Liebeslyrik des Mittelalters.
- Die Liebe als Rose: Dieser Abschnitt fokussiert auf die Rose als Symbol für die Liebe und die Ambivalenz zwischen Liebe und Wollust, die in bestimmten Minnesangliedern zum Ausdruck gebracht wird.
- Das Brechen einer Rose: Dieser Abschnitt untersucht die Metapher des "Blumenbrechens" in zwei Liedern des Späten Minnesangs und vergleicht diese mit Walthers von der Vogelweides Linden-Lied.
- Das liebende lyrische Ich: Hier wird der Fokus auf das lyrische Ich in Walthers Linden-Lied gelegt und seine Rolle in der Darstellung des Minnekonzepts analysiert.
- Deiktische Semantik: Dieser Abschnitt analysiert die deiktische Semantik im Linden-Lied, die sich auf die Beziehung zwischen dem lyrischen Ich und der geliebten Frau bezieht.
- Liebe als Mentalitätsgeschichte: Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung des Linden-Lieds für die Mentalitätsgeschichte des Minnesangs.
- Liebe in der Ehe: Dieser Abschnitt betrachtet die Beziehung zwischen Liebe und Ehe in Walthers Linden-Lied.
- Von Minne zu,Liebe: Dieser Abschnitt untersucht die Entwicklung des Minnekonzepts von der hohen Minne zur Liebe.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themenbereiche dieser Arbeit umfassen die höfische Liebeslyrik des Mittelalters, das lyrische Ich, das Ideal der hohen Minne, Blumen und Rosen als Symbole, deiktische Semantik, die Metapher des Blumenbrechens und die Verbindung zwischen Liebe, Gewalt und Sexualität.
- Quote paper
- Silvio Dohner (Author), 2014, Das lyrische Ich im "Linden-Lied" Walthers von der Vogelweide, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345630