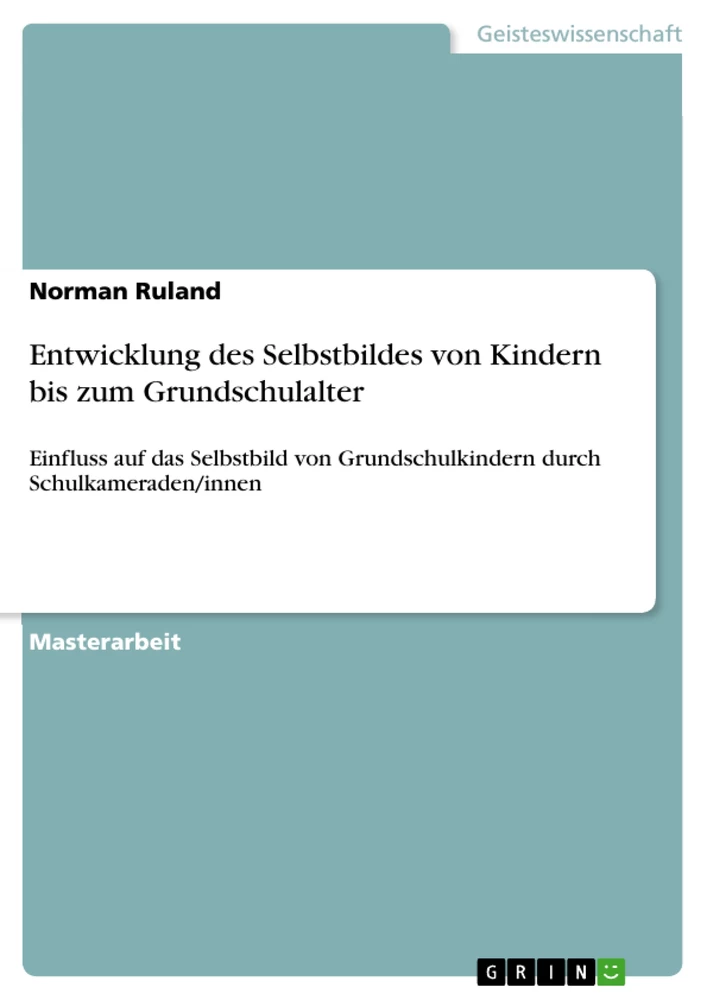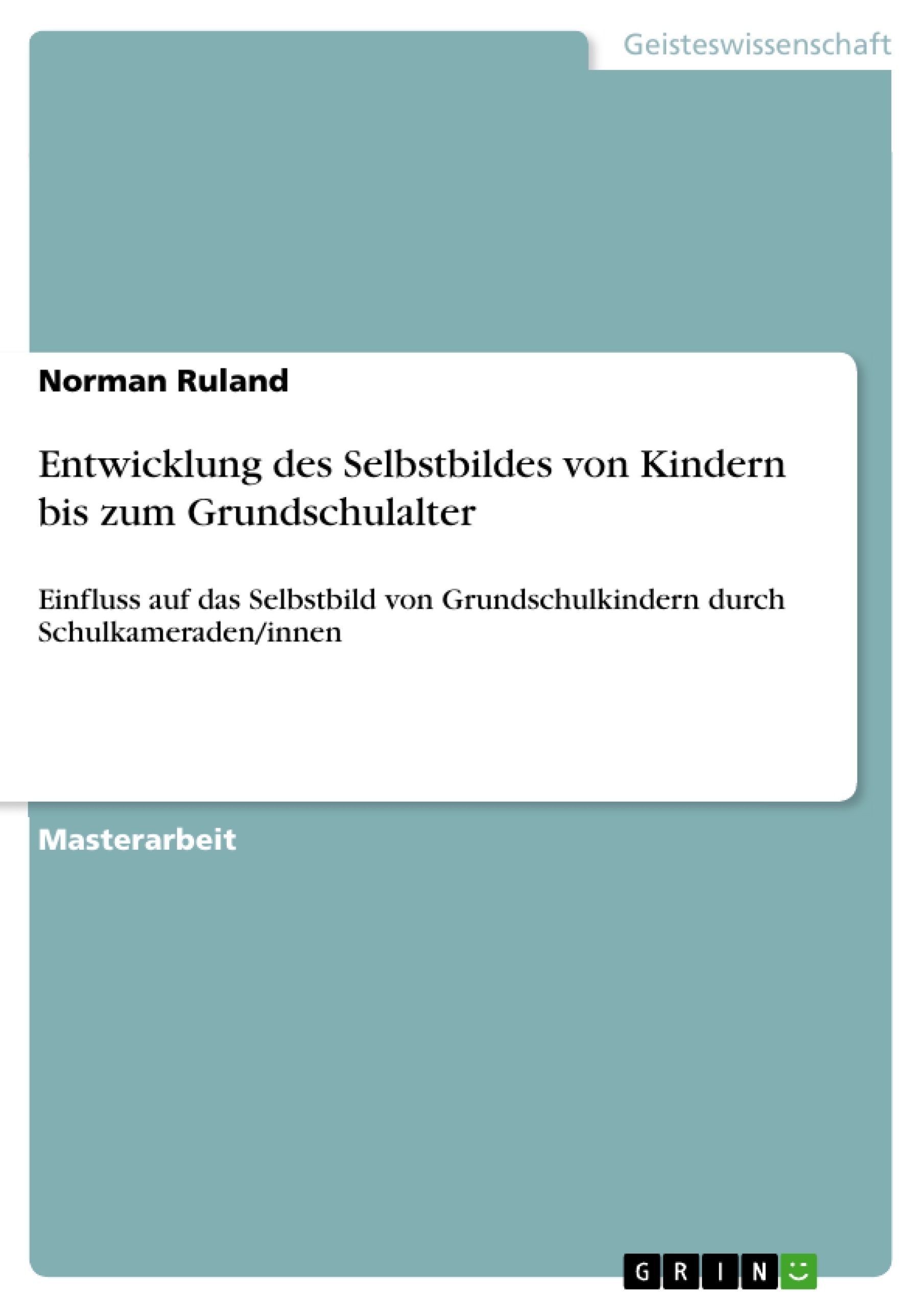Für das eigene Erleben von Schulkindern sind Selbstkonzepte von wesentlicher Bedeutung. Jeder Aspekt der eigenen Person kann seinen Niederschlag in Selbstkonzepten finden und Einfluss auf diese haben. Die Einstellung einer Person zu ihrem eigenen Selbst kann sich auf mehrere Bereiche beziehen. So geht Dagmar Baldering davon aus, dass Selbstkonzepte multidimensional zu fassen sind. Einstellungen der Person zum eigenen Körper, verschiedene Fähig- und Fertigkeiten, Interessen, Gefühle, Wünsche und Verhalten sind eine Auswahl relevanter Aspekte (vgl. Baldering 1993, S. 2).
Die Frage danach, wer man ist oder was man ist, ist für jeden Menschen eine existenzielle. Der Mensch hat die einzigartige Fähigkeit, sich selbst als Objekt zu reflektieren und zu betrachten (vgl. Baldering 1993, S. 3). Er macht sich ein Bild von seinen Fähigkeiten, Eigenschaften, Gefühlen, Wünschen und Einstellungen. Insbesondere gelangt er zu diesem Bild durch den Vergleich mit anderen. Was unterscheidet mich von anderen? Was macht mich einzigartig?
Verschiedene Ansätze aus der Psychoanalyse, Psychologie und der Sozialen Arbeit versuchen die Entwicklung von Selbstkonzepten zu ergründen. Auf die verschiedenen theoretischen Auffassungen zur Entstehung von Selbstkonzepten bei Schulkindern wird in dieser Arbeit eingegangen. Ebenso sollen disziplinübergreifende Aspekte herausgearbeitet und auf deren Bedeutung für eine psychoanalytische Soziale Arbeit geprüft werden.
Es wird insbesondere der Frage nachgegangen, wo der Ursprung der Selbstentwicklung zu verorten ist und ob es so etwas wie ein wahres Selbst gibt. So geht Alice Miller davon aus, dass es zur Verdrängung von Gefühlen des Kindes und zum Verlust des wahren Selbst kommt, wenn narzisstische Bedürfnisse nicht genügend Beachtung finden (vgl. Miller 2014, S. 21 f.). Inwieweit können Schulkinder im schulischen Kontext ihr eigenes Selbst zeigen und ausleben? Wo werden eigene Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen angepasst, verändert oder verdrängt, um sich, beispielsweise, bei Schulkameraden beliebt zu machen oder vermeintlich gewünschten Leistungen oder Erwartungen zu entsprechen?
In einer eigenen qualitativen Studie mit ästhetischen Forschungsmethoden wurde sich der Frage angenähert, ob Schulkinder durch den Einfluss ihrer Schulkameraden an ihrem eigenen Selbst scheitern. Die Studie und deren Ergebnisse werden hier aufgezeigt und ein Ausblick auf noch zu erforschende Fragen geworfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung psychoanalytischer Einflüsse auf die Soziale Arbeit
- Psychoanalytische Soziale Arbeit
- Einfluss der Psychoanalyse auf das Arbeitsbündnis in der Sozialen Arbeit
- Berührungspunkte von Sozialer Arbeit und Psychoanalyse
- Praxisbeispiel: „Verein für Psychoanalytische Sozialarbeit e.V.“
- Entwicklung der Selbstkonzeptforschung und Forschungsstand
- Weitere Akteure in der Selbstkonzeptforschung
- Aktuelle Perspektiven zur Selbstkonzeptforschung
- Begriffsannäherungen und Definitionen in der Selbstkonzeptforschung
- Identität und Subjekt
- Perspektiven zum Ich-Begriff
- Perspektiven zum Selbst-Begriff
- Selbstkonzept
- Schul- und Fähigkeitsselbstkonzept
- Entwicklung von Selbstkonzepten bei Kindern bis zum Grundschulalter
- Anfänge der Selbstkonzeptentwicklung
- Aufnahme von Informationen für Selbstkonzepte
- Informationsquellen für Selbstkonzepte
- Bedeutung von sozialen Beziehungen auf die Selbstkonzeptentwicklung
- Plötzliche Entdeckung des Selbst
- Identität und Selbstdarstellung
- Bedeutung von Gleichaltrigenbeziehungen für die Selbstkonzeptentwicklung
- Entwicklung des schulischen Selbstkonzeptes
- Zusammenfassung - Entwicklung von Selbstkonzepten
- Einflussfaktoren - Gene und Umwelt
- Dialektische Bezogenheit von Genen und Umwelt
- Einflussfaktoren auf schulische Selbstkonzepte
- Verteidigung des Selbst
- Der Ursprung des Selbst und seine Gefährdungen
- Das Selbst im Widerspruch zu sich und der Umwelt
- Gefährdungen durch Gleichaltrigenbeziehungen
- Zusammenfassung – Ursprung des Selbst und seine Gefährdungen
- Forschungsentwurf
- Subjektivität durch Ästhetik gewinnen
- Von der Frage zur Methode
- Der Rahmen des Forschungsentwurfs
- Kontaktaufnahme zur Grundschule
- Erhebung und Organisation des Forschungsprozesses
- Ansprechpartner gesucht
- Auswertung der Ergebnisse
- Darstellung und Diskussion der Ergebnisse
- Ergebnisse von 60 jungen Selbst-Forschern/innen
- Eingrenzung und Diskussion von ausgewählten Teilaspekten in Bezugnahme zu den Ausgangsthesen
- Der Einfluss von Schulkameraden/innen auf Gefühle und Statussymbole
- Fußball, Markenbewusstsein und Schönheitssymbole als starke Prestigeträger
- Reflexion des Forschungsprojektes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Entwicklung des Selbstbildes von Kindern bis zum Grundschulalter, wobei der Schwerpunkt auf dem Einfluss von Schulkameraden auf das Selbstbild gelegt wird. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die komplexen Faktoren zu gewinnen, die die Selbstentwicklung von Kindern beeinflussen.
- Die Bedeutung von psychoanalytischen Theorien für die Soziale Arbeit
- Die Entwicklung von Selbstkonzepten bei Kindern und die Rolle von sozialen Beziehungen
- Der Einfluss von Gleichaltrigen auf das Selbstbild von Grundschulkindern
- Die Bedeutung von Selbstkonzepten für das eigene Erleben und Verhalten von Kindern
- Die Herausforderungen und Gefährdungen für die Selbstentwicklung von Kindern im Schulkontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Selbstbildentwicklung für Grundschulkinder. Kapitel 2 beleuchtet die Bedeutung psychoanalytischer Einflüsse auf die Soziale Arbeit und stellt deren Relevanz für die Selbstentwicklung von Kindern in den Vordergrund. Kapitel 3 befasst sich mit der Entwicklung der Selbstkonzeptforschung und den aktuellen Perspektiven in diesem Bereich. Kapitel 4 bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit Begriffsannäherungen und Definitionen im Kontext der Selbstkonzeptforschung. Kapitel 5 untersucht die Entwicklung von Selbstkonzepten bei Kindern bis zum Grundschulalter und beleuchtet die Rolle von sozialen Beziehungen in diesem Prozess.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Selbstbildentwicklung, Selbstkonzept, psychoanalytische Soziale Arbeit, Gleichaltrigenbeziehungen, Schulkontext, Kinder bis zum Grundschulalter, Einflussfaktoren, Selbstverteidigung, Gefährdungen, qualitative Forschung, ästhetische Methoden.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Norman Ruland (Autor:in), 2006, Entwicklung des Selbstbildes von Kindern bis zum Grundschulalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345706