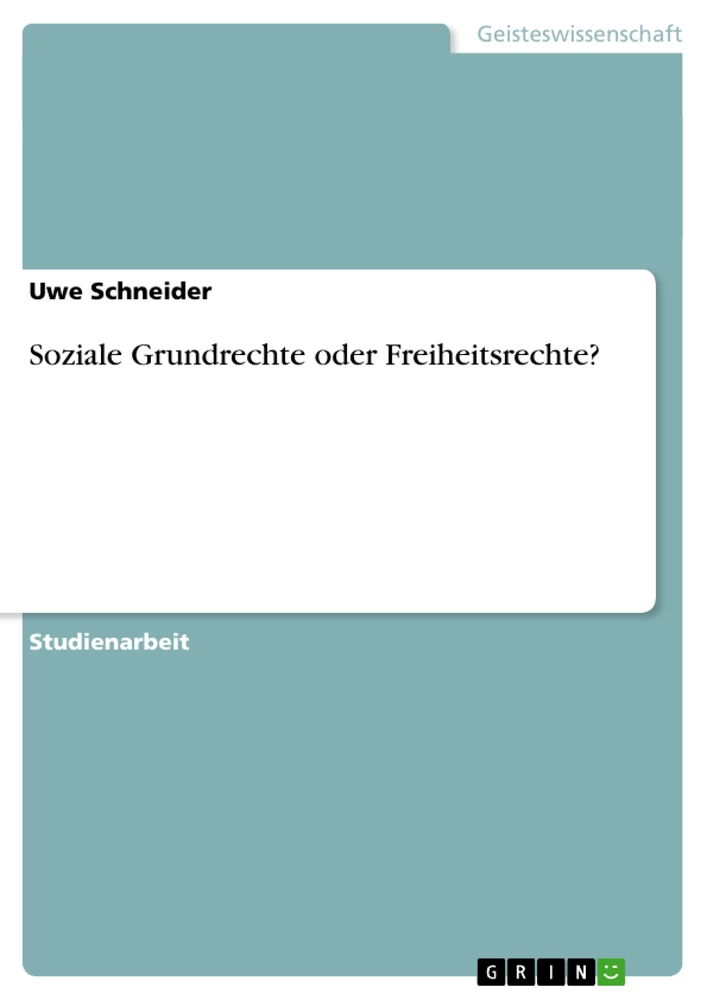„Räumen die klassischen Grundrechte dem Individuum grundsätzlich unbeschränkte Freiheit ein, wogegen sie den Staat in seinen Handlungen grundsätzlich beschränkt erscheinen lassen, bereitet die gleichzeitige Aufnahme sozialer Grundrechte in die Verfassung diesem Konzept ein so jähes Ende.“ In dieser Äußerung Theodor Tomandels (zitiert von Horner, S. 220) spiegelt sich sehr deutlich die Problematik wieder, dass soziale Grundrechte die liberale Freiheit erheblich zu gefährden scheinen.
Jede Demokratie im 20. Jahrhundert versteht sich als eine soziale, und es wird auch der sozialen Dimension, wenn auch in unterschiedlichen Formen, weitgehend Rechnung getragen. Soziale Rechte werden in Verbindung mit bürgerlichen und politischen Rechten als Grundlage für echte Demokratien gesehen. Nur wenn es um die Verankerung in der Verfassung und damit um die Gleichsetzung der sozialen Grundrechte mit den klassischen Grundrechten als unveräußerliche Menschenrechte geht, wird immer wieder abgeblockt, mit dem Hinweis auf die Gefährdung der individuellen Freiheit.
Diese Diskussion ist nicht erst in diesem Jahrhundert aufgekommen. Bereits die französische Nationalversammlung bezog 1789 das Recht auf ein Existenzminimum in ihre Beratungen über die Menschenrechte ein. Unstrittig war damals bereits, dass es notwendiger ist, den Menschen einen Lebensunterhalt zu verschaffen, als abstrakte Freiheit zu versprechen. „Die politische Gemeinschaft schuldet jedermann die Mittel zu seiner Erhaltung, sei es durch Arbeit, Eigentum oder durch Hilfe seinesgleichen.“ (Krause, S. 410). In der Menschenrechtserklärung der französischen Verfassung wurden soziale Grundrechte dann aber doch nicht aufgenommen. Bis heute wurden in den Verfassungen soziale Grundrechte von den geheiligten Menschenrechten ausgespart. Diese „stiefmütterliche Behandlung“ begünstigte sicherlich die gängige Auffassung, dass soziale Grundrechte und Freiheitsrechte inkompatibel sind. In dieser Arbeit werde ich mich damit auseinandersetzen, ob dem wirklich so ist, ob der propagierte Absolutheitsanspruch der Freiheitsrechte und der klassischen liberalen Verfassungsordnung noch gerechtfertigt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Freiheitsrechte und soziale Grundrechte - ein Überblick
- Freiheitsrechte
- Soziale Grundrechte
- Freiheit oder soziale Grundrechte?
- Negative Freiheit
- Positive Freiheit
- Weniger schwarz-weiße Sicht auf Freiheit
- Freiheit und soziale Grundrechte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die scheinbare Inkompatibilität von sozialen Grundrechten und Freiheitsrechten. Ziel ist es, den propagierten Absolutheitsanspruch der Freiheitsrechte im Kontext der liberalen Verfassungsordnung zu hinterfragen.
- Charakterisierung klassischer und sozialer Grundrechte
- Untersuchung verschiedener Freiheitskonzeptionen
- Analyse des Einflusses sozialer Grundrechte auf die individuelle Freiheit
- Diskussion des Widerspruchs zwischen der Sicherung der Existenzgrundlage und der Wahrung individueller Freiheiten
- Bewertung der Rechtfertigung sozialer Grundrechte im liberalen Staat
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von sozialen Grundrechten und Freiheitsrechten dar. Sie verweist auf den scheinbaren Widerspruch zwischen dem liberalen Freiheitsbegriff und der Einbeziehung sozialer Rechte in moderne Verfassungen. Die Arbeit kündigt eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Freiheitskonzeptionen und die Analyse des Einflusses sozialer Grundrechte auf die individuelle Freiheit an.
Freiheitsrechte und soziale Grundrechte - ein Überblick: Dieses Kapitel charakterisiert Freiheitsrechte und soziale Grundrechte. Freiheitsrechte werden als Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe in die individuelle Freiheit dargestellt, die auf einer vorstaatlichen Freiheitssphäre beruhen. Soziale Grundrechte hingegen werden als Ansprüche auf staatliche Leistungen zur Sicherung der Existenzgrundlage beschrieben. Der historische Kontext der Entstehung beider Rechtstypen wird beleuchtet, und die unterschiedlichen Auffassungen über deren Umsetzbarkeit werden diskutiert.
Freiheit oder soziale Grundrechte?: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Freiheitskonzeptionen, insbesondere negative und positive Freiheit. Es wird diskutiert, inwiefern die unterschiedlichen Verständnisweisen von Freiheit die Debatte um soziale Grundrechte beeinflussen. Die Arbeit hinterfragt eine rein schwarz-weiß Sicht auf Freiheit und betont die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise.
Schlüsselwörter
Soziale Grundrechte, Freiheitsrechte, Negative Freiheit, Positive Freiheit, Liberalismus, Verfassung, Menschenrechte, Existenzminimum, Individuelle Freiheit, Staat, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Freiheitsrechte und Soziale Grundrechte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das scheinbar widersprüchliche Verhältnis von sozialen Grundrechten und Freiheitsrechten, insbesondere den Absolutheitsanspruch der Freiheitsrechte im liberalen Kontext.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Charakterisierung klassischer und sozialer Grundrechte, verschiedene Freiheitskonzeptionen (negative und positive Freiheit), den Einfluss sozialer Grundrechte auf die individuelle Freiheit, den Widerspruch zwischen Existenzsicherung und individueller Freiheit, und die Rechtfertigung sozialer Grundrechte im liberalen Staat.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Freiheits- und sozialen Grundrechten (mit Unterkapiteln zu beiden Rechtstypen), ein Kapitel zu Freiheit *oder* sozialen Grundrechten (mit Fokus auf negative und positive Freiheit und einer differenzierten Betrachtungsweise), ein Kapitel zu Freiheit *und* sozialen Grundrechten und ein Fazit.
Wie werden Freiheitsrechte und soziale Grundrechte charakterisiert?
Freiheitsrechte werden als Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe dargestellt, die auf einer vorstaatlichen Freiheitssphäre beruhen. Soziale Grundrechte hingegen werden als Ansprüche auf staatliche Leistungen zur Existenzsicherung beschrieben. Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext und unterschiedliche Auffassungen zur Umsetzbarkeit beider Rechtstypen.
Welche Rolle spielen unterschiedliche Freiheitskonzeptionen?
Die Arbeit analysiert negative und positive Freiheit und diskutiert deren Einfluss auf die Debatte um soziale Grundrechte. Sie geht über eine Schwarz-Weiß-Sicht hinaus und plädiert für eine differenzierte Betrachtung.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Frage ist das Verhältnis von sozialen Grundrechten und Freiheitsrechten und der scheinbare Widerspruch zwischen dem liberalen Freiheitsbegriff und der Einbeziehung sozialer Rechte in moderne Verfassungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Soziale Grundrechte, Freiheitsrechte, Negative Freiheit, Positive Freiheit, Liberalismus, Verfassung, Menschenrechte, Existenzminimum, Individuelle Freiheit, Staat, Gesellschaft.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel ist es, den propagierten Absolutheitsanspruch der Freiheitsrechte im Kontext der liberalen Verfassungsordnung zu hinterfragen.
Wie wird die Einleitung beschrieben?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage dar, verweist auf den scheinbaren Widerspruch zwischen liberalem Freiheitsbegriff und sozialen Grundrechten und kündigt die Auseinandersetzung mit verschiedenen Freiheitskonzeptionen und dem Einfluss sozialer Grundrechte auf die individuelle Freiheit an.
- Citar trabajo
- Uwe Schneider (Autor), 2001, Soziale Grundrechte oder Freiheitsrechte?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34579