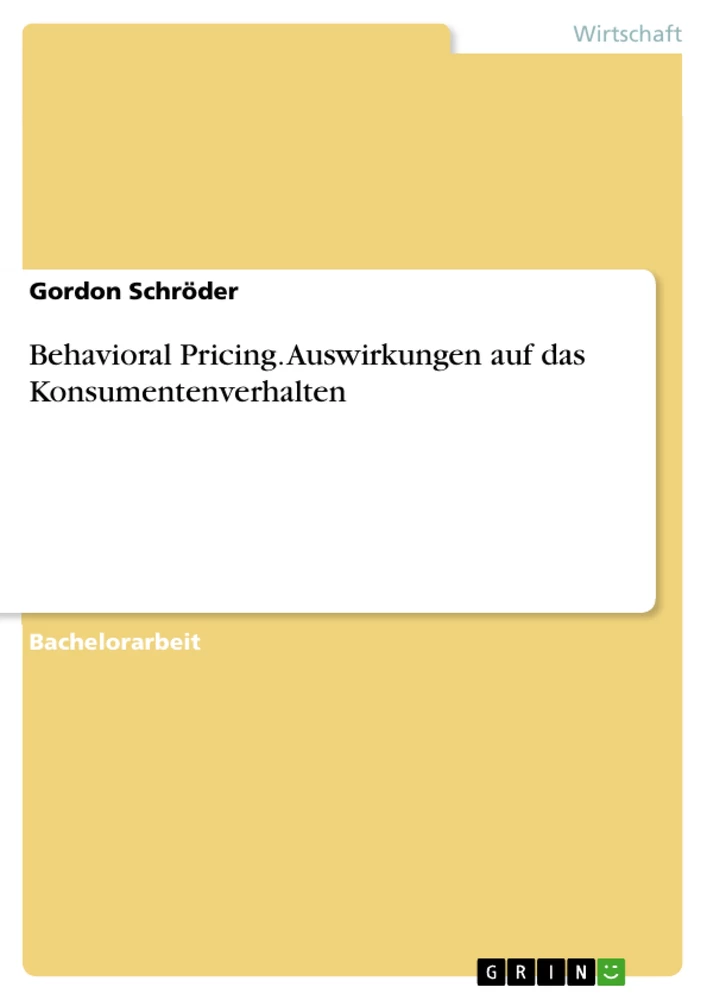Emotionen begleiten den Menschen in vielen Lebenslagen. Eine höchst emotionale Situation entsteht u.a. bei Wahlen und demokratischen Entscheidungen.
„Das ist ein Sieg der Emotionen über die Fakten,“ sagte Elmar Brok (2016) nach dem Volksentscheid der Briten über den EU-Austritt. Er kritisiert damit den emotionsgeladenen Wahlkampf und die emotionale Entscheidung der britischen Bevölkerung für einen Ausstieg aus der Europäischen Union.
Die Aussage von Brok impliziert, dass Emotionen die Macht besitzen, die Informationsaufnahme und dementsprechend das Wahlverhalten von Menschen zu beeinflussen.
Die Frage ist nun, ob Emotionen auf einer niedrigeren Entscheidungsstufe ähnlich intensive Wirkungskraft besitzen.
Die Emotionalisierung einer Marke bspw. setzt sich beim Kunden sehr prägnant im Gedächtnis fest. Dort wirken sich die Emotionen auf sein Kaufverhalten aus. Wird der Entscheidungsprozess noch weiter simplifiziert, indem Markenimage, Werbung und weitere produktpolitische Maßnahmen ausgeblendet werden, bleibt einzig allein der Preis als Beurteilungskriterium übrig. Besitzt die Verarbeitung dieser simplen Zahl das Potenzial, von Emotionen beeinflusst zu werden?
Diese Arbeit untersucht jenen Zusammenhang und steht unter folgender Forschungsfrage: Welche Auswirkungen haben Emotionen auf den Preisbeurteilungsprozess und das Konsumentenverhalten? Gibt es bei der Wirkung Unterschiede zwischen positiven und negativen Emotionen? Ist hier ebenfalls ein Sieg der Emotionen über die Fakten zu beobachten?
Das Ziel dieser Arbeit ist die strukturierte Ausarbeitung des Preisbeurteilungsprozesses des emotionalen Konsumenten. Dabei liegt der Fokus auf den emotionalen Auswirkungen und den Konsequenzen für das Konsumentenverhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Untersuchungsgegenstand
- Theoretische Grundlagen
- Behavioral Pricing
- Preisinformationsbeurteilung
- Emotionen
- Preisaffekt
- Der emotionale Konsument
- Die Rolle von Emotionen vor der Preisbeurteilung
- Emotionsentwicklung nach der Preisbeurteilung
- Preisveränderung
- Preisdifferenzierung
- Preisimage und Konsumentencharakteristika
- Auswirkungen auf das Konsumentenverhalten
- Die Auswirkung negativer Emotionen
- Die Auswirkung positiver Emotionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Behavioral Pricing auf das Konsumentenverhalten. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen von Emotionen auf die Preiswahrnehmung und die daraus resultierenden Kaufentscheidungen. Ziel ist es, die Rolle von Emotionen im Entscheidungsfindungsprozess des Konsumenten zu analysieren und die Mechanismen zu verstehen, die zu einem emotionalen Preisaffekt führen.
- Theoretische Grundlagen von Behavioral Pricing
- Die Rolle von Emotionen bei der Preisbeurteilung
- Die Auswirkungen von Preisveränderungen und Preisdifferenzierung auf Emotionen
- Der Einfluss von Preisimage und Konsumentencharakteristika auf die emotionale Reaktion
- Die Folgen von emotionalen Reaktionen auf das Konsumentenverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in den Untersuchungsgegenstand ein und erläutert die theoretischen Grundlagen von Behavioral Pricing. Es werden wichtige Konzepte wie Preisinformationsbeurteilung, Emotionen und Preisaffekt vorgestellt.
Das zweite Kapitel widmet sich dem emotionalen Konsumenten und analysiert die Rolle von Emotionen im Preiserfahrungsprozess. Es beleuchtet die Emotionsentwicklung vor und nach der Preisbeurteilung, insbesondere im Hinblick auf Preisveränderungen, Preisdifferenzierung und das Preisimage.
Schlüsselwörter
Behavioral Pricing, Konsumentenverhalten, Emotionen, Preisinformationsbeurteilung, Preisaffekt, Preisimage, Preisdifferenzierung, Kaufentscheidungen, Marketing
Häufig gestellte Fragen
Was ist Behavioral Pricing?
Behavioral Pricing untersucht, wie Konsumenten Preise tatsächlich wahrnehmen und beurteilen, wobei psychologische Faktoren statt rein rationaler Kalkulation im Fokus stehen.
Welchen Einfluss haben Emotionen auf die Preisbeurteilung?
Emotionen können die Informationsaufnahme verzerren und dazu führen, dass Preise eher affektiv als faktisch bewertet werden.
Was ist der Unterschied zwischen positiven und negativen Emotionen beim Preis?
Positive Emotionen können die Zahlungsbereitschaft erhöhen, während negative Emotionen (z. B. Ärger über Preissteigerungen) zu Kaufabbrüchen führen können.
Was versteht man unter "Preisaffekt"?
Preisaffekt bezeichnet die unmittelbare emotionale Reaktion eines Konsumenten auf eine Preisinformation.
Wie beeinflusst das Preisimage das Verhalten?
Ein etabliertes Preisimage (z. B. "Discounter") prägt die Erwartungshaltung und die emotionale Bewertung jeder einzelnen Preisangabe.
- Quote paper
- Gordon Schröder (Author), 2016, Behavioral Pricing. Auswirkungen auf das Konsumentenverhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346496