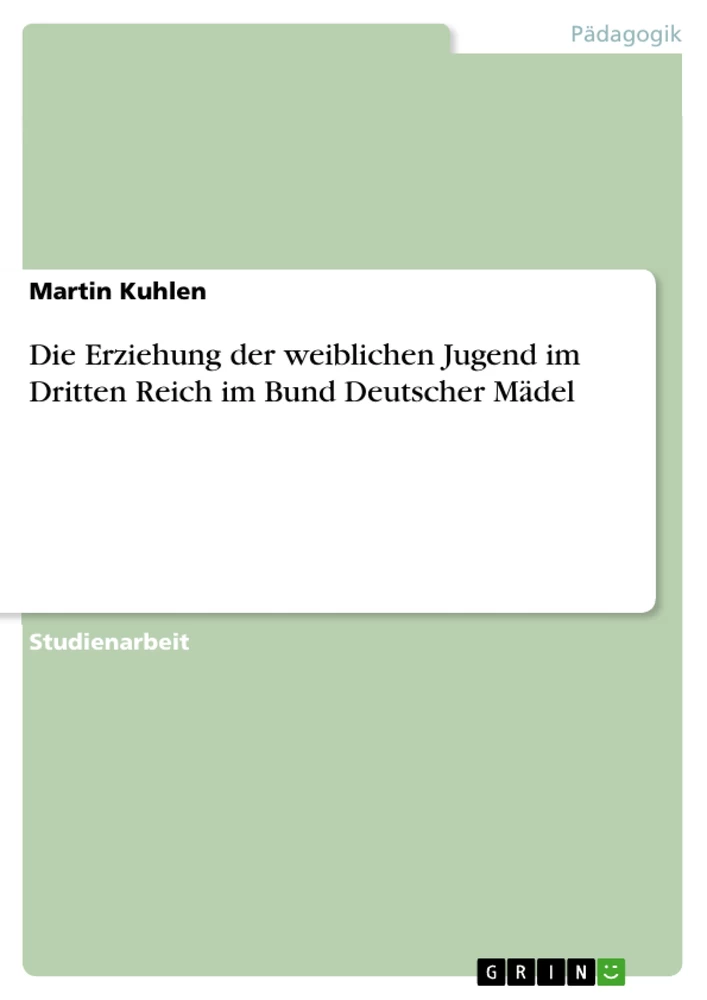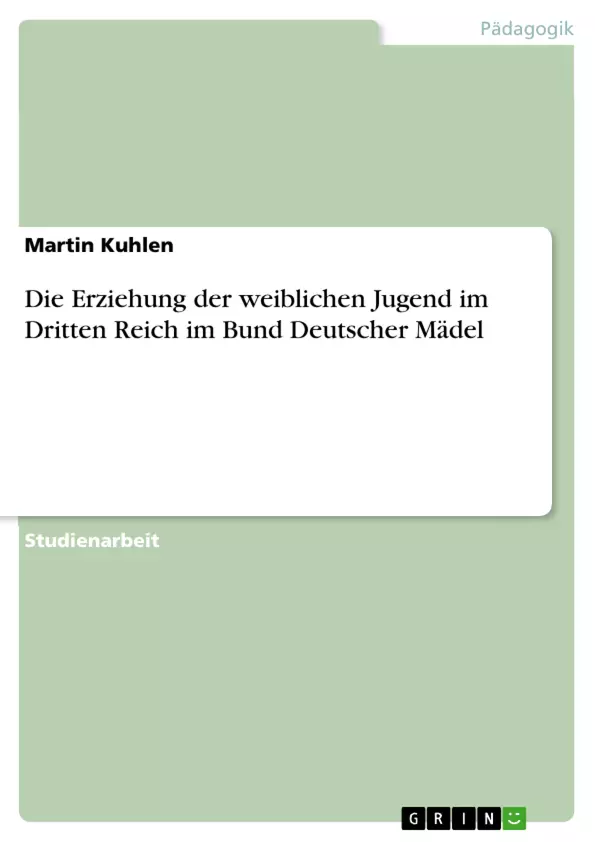Von elementarer Bedeutung für die Festigung und den Ausbau ihrer Macht war für die Nazis die Gewinnung der deutschen Jugend. So wurde bereits 1922 in München der erste kleine Jungendverband der NSDAP in München ins Leben gerufen. Als die Hitler-Jugend und der Bund Deutscher Mädel in den Jahren 1926/27 schließlich offiziell gegründet wurden und nur aus wenigen hundert Mitgliedern bestanden, hätte sich wohl niemand träumen lassen, dass das vom Reichsjugendführer Baldur von Schirach 1931 proklamierte Ziel, die gesamte deutsche Jugend in die Verbände einzugliedern, binnen weniger Jahre annähernd erreicht sein würde.
Dies wirft die Frage auf, wie ein solch gigantisches Unterfangen in so kurzer Zeit gelingen konnte. Wer trug die Verantwortung dafür und welche Organisationsstrukturen waren für die Aufnahme von Millionen neuer Mitglieder vonnöten? Wie wurden Jugendliche dazu gebracht, sich BDM und HJ anzuschließen und wie verfuhr man mit konkurrierenden Jugendorganisationen? Im folgen Text werde ich versuchen, diese Fragen zu beantworten, wobei ich mich hauptsächlich mit der Mädchenorganisation der Nazis, dem Bund Deutscher Mädel, beschäftigen werde, zu der es im Vergleich mit der allgemeinen HJ nur einen Bruchteil an Quellen und Publikationen gibt. Neben der Entstehung, dem Werdegang der Organisation und der Beschreibung ihrer Funktionen möchte ich außerdem erörtern, was die pädagogischen Maxime der Nazis waren und welches Frauenbild den Mädchen im BDM vermittelt wurde. Außerdem gehe ich der Frage nach, was die „nationalsozialistische Weltanschauung“ kennzeichnete, zu deren Trägerinnen die Mädchen nach dem Willen Hitlers und der Reichsjugendführung erzogen werden sollten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Zusammenhang
- Der BDM vor der Machtergreifung
- Der BDM als Teil der Staatsjugend im Dritten Reich
- Charakteristika der Organisation
- Aufbau und Organisation
- Ideologische Ausrichtung und pädagogische Maxime
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erziehung der weiblichen Jugend im Dritten Reich im Bund Deutscher Mädel (BDM). Sie analysiert die Entstehung, den Aufbau und die Funktionsweise des BDM, sowie dessen ideologische Ausrichtung und pädagogische Maxime. Das zentrale Ziel ist es, die Rolle des BDM im NS-Staat zu beleuchten und zu untersuchen, wie die Mädchen zu Trägerinnen der „nationalsozialistischen Weltanschauung“ erzogen werden sollten.
- Die Entstehung und Entwicklung des BDM im Kontext der NS-Machtübernahme.
- Die Organisation des BDM und seine Integration in die NS-Staatsjugend.
- Die pädagogischen Maxime des BDM und die Vermittlung des NS-Frauenbildes.
- Die Rolle des BDM bei der Verbreitung der nationalsozialistischen Ideologie.
- Die Bedeutung des BDM für die NS-Herrschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Dritten Reichs für die deutsche Geschichte und führt in die Forschungsfrage ein, wie die Nazis die gesamte deutsche Jugend in ihre Verbände einzugliedern konnten.
Das Kapitel „Historischer Zusammenhang“ behandelt die Entstehung des BDM. Hierbei wird die Entwicklung von nationalsozialistischen Mädchengruppen vor der Machtergreifung bis zur Gründung des BDM im Jahr 1930 nachgezeichnet. Es wird außerdem erläutert, wie der BDM unter der Führung von Baldur von Schirach zu einem zentralen Bestandteil der NS-Jugendorganisationen wurde.
Schlüsselwörter
Bund Deutscher Mädel (BDM), Nationalsozialismus, Jugendorganisation, Staatsjugend, Frauenbild, nationalsozialistische Weltanschauung, Erziehungsziele, Ideologie, Machtübernahme, HJ, NS-Frauenschaft, Baldur von Schirach, Reichsjugendführer, Geschichte, Bildung, Gesellschaft, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Bund Deutscher Mädel (BDM)?
Der BDM war die Mädchenorganisation der NSDAP und Teil der Hitler-Jugend (HJ). Er diente dazu, die weibliche Jugend im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung zu erziehen.
Welches Frauenbild wurde im BDM vermittelt?
Mädchen sollten zu Trägerinnen der NS-Ideologie erzogen werden, wobei der Fokus auf ihrer zukünftigen Rolle als gesunde Mütter und Hausfrauen im Dienste der "Volksgemeinschaft" lag.
Wie gelang es den Nazis, Millionen Jugendliche einzugliedern?
Durch die Gleichschaltung konkurrierender Jugendverbände, geschickte Propaganda und schließlich die gesetzlich verankerte Pflichtmitgliedschaft in der Staatsjugend.
Wer trug die Verantwortung für die NS-Jugenderziehung?
Eine zentrale Figur war Reichsjugendführer Baldur von Schirach, der bereits 1931 das Ziel proklamierte, die gesamte deutsche Jugend in die NS-Verbände einzugliedern.
Was waren die pädagogischen Maxime im BDM?
Die Erziehung war geprägt von Disziplin, ideologischer Schulung, körperlicher Ertüchtigung und der Unterordnung des Einzelnen unter die Ziele des NS-Staates.
- Citar trabajo
- Martin Kuhlen (Autor), 2014, Die Erziehung der weiblichen Jugend im Dritten Reich im Bund Deutscher Mädel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346606