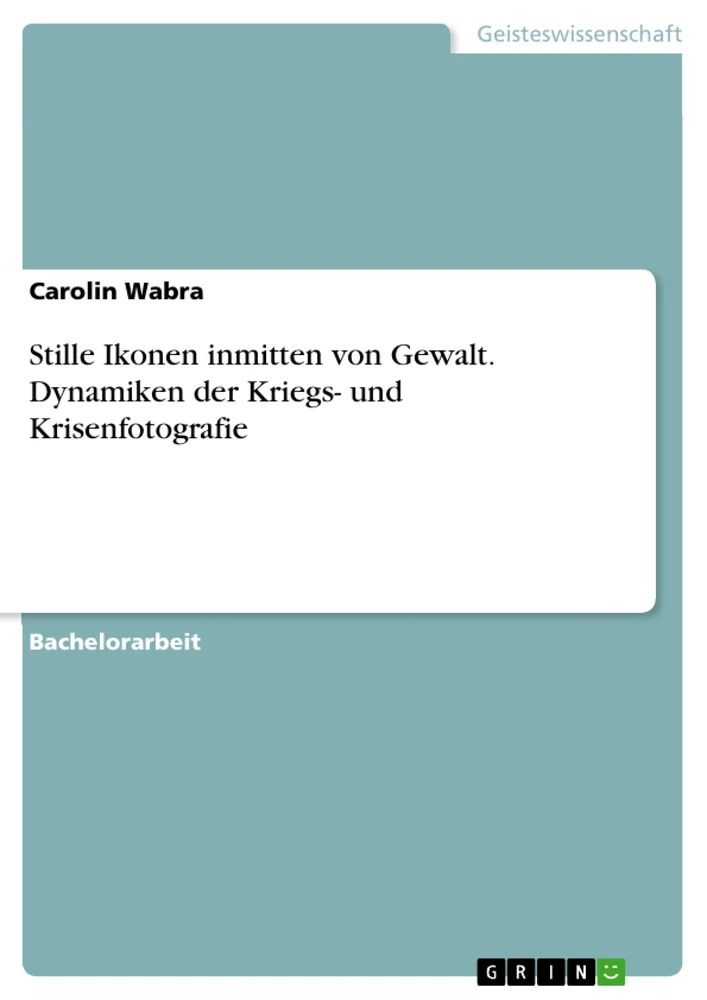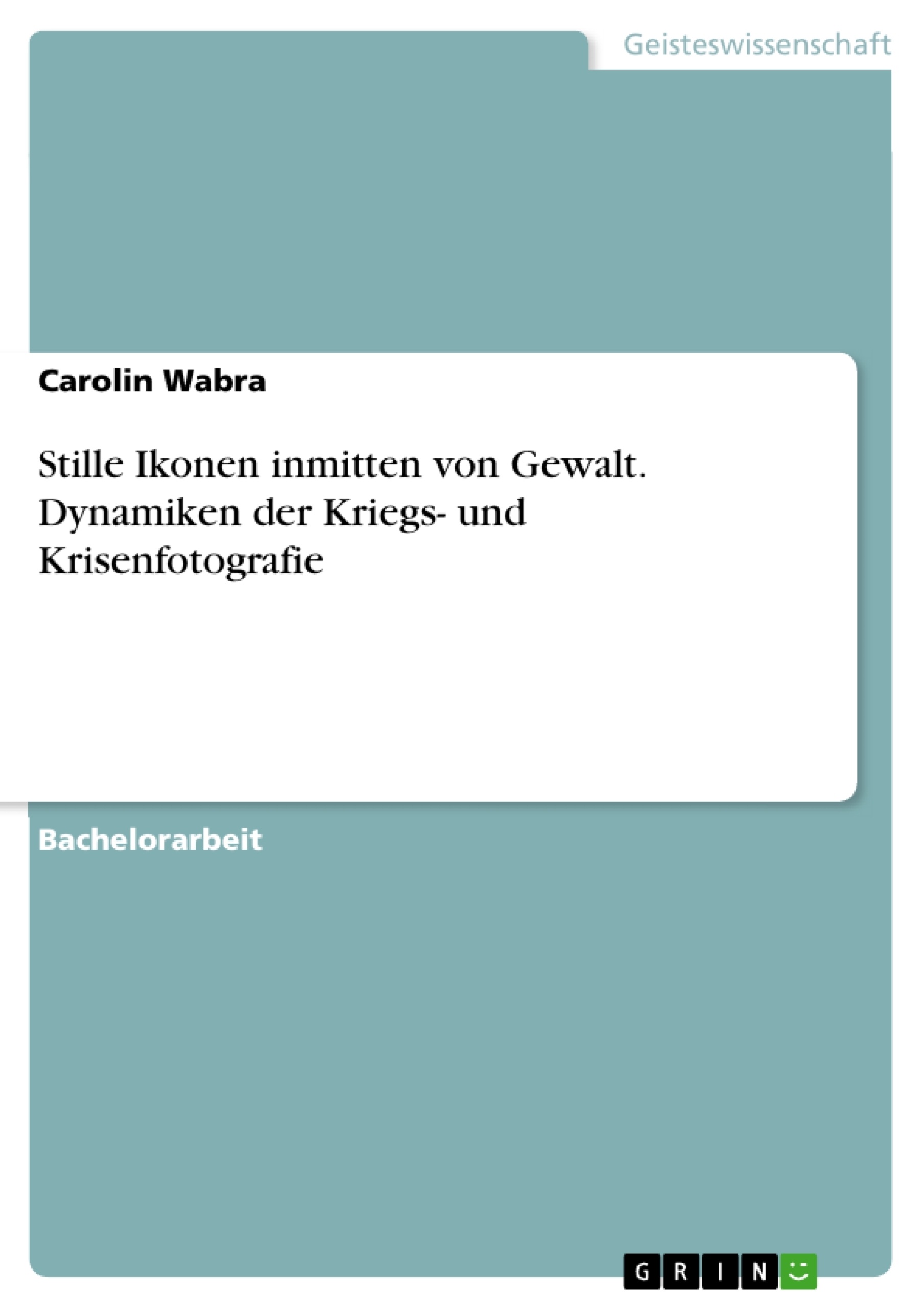Mit der Entwicklung der Fotografie und der Entstehung der Massenmedien zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist es uns möglich geworden über Ereignisse in fernen Ländern, ohne unmittelbare Nähe zum Geschehen, informiert zu sein und diese bildlich festzuhalten. Im Kopf hängen bleiben uns dabei meist nicht nur geschriebene Berichte, Kommentare oder Reportagen, sondern vor allem Fotografien, die ein vermeintlich genaues Abbild der Ereignisse geben. Bilder, in dieser Arbeit sind dabei meist Fotografien gemeint, geraten jedoch auch sehr schnell in Vergessenheit. Einige aber dringen tiefer in das Bewusstsein ein und gehen als berühmte Fotografien oder auch Ikonen der Fotografie in die Geschichte ein. Ob die Fotografie die definierten Kriterien und Prozesse einer ikonischen Fotografie erfüllt, soll abschließend und aufbauend auf deren Publikations- und Rezeptionsgeschichte dargestellt werden.
Im Theorieteil der Arbeit soll dazu im ersten Kapitel der Bildbegriff interdisziplinär betrachtet und erläutert werden. Neben der allgemeinen Definition wird auch auf die Besonderheiten eines Bildes, insbesondere einer Fotografie, eingegangen. Ein Augenmerk dieses Kapitels ist auf den iconic turn der Sozialwissenschaften gelegt. Zudem beschäftigt sich das Kapitel mit dem Thema der Bildanalyse und stellt die Methode der ästhesiologischen Bildhermeneutik vor. Der Begriff der Ikone und deren Rolle und Bedeutung innerhalb unserer Kultur spielen für die folgende Arbeit eine tragende Rolle. Dabei wird im zweiten Kapitel des Theorieteiles nicht nur eine Definition des Begriffes gegeben, sondern es soll auch dargestellt werden, welche Faktoren, Prozesse und Akteure dazu führen, dass bestimmte Fotografien zu Ikonen werden. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Geschichte der Kriegs- und Krisenfotografie, um zu beleuchten, welche Entwicklungen die Kriegsberichterstattung in den letzten Jahrhunderten durchlief und welche Auswirkungen diese auf Politik und Gesellschaft hatten.
Im empirischen Teil der Arbeit soll die Fotografie des syrischen Flüchtlingskind Aylan aus dem letzten Jahr einer qualitativen Bildanalyse unterzogen werden und dabei mithilfe der Methode der ästhesiologischen Bildhermeneutik analysiert und ausgewertet werden. Die Fotografie soll insbesondere nach diesem Moment der Stille untersucht werden und es wird der Frage nachgegangen, warum uns gerade jenes Bild so bewegt.
Inhaltsverzeichnis
- Aktualität und Aufbau der Arbeit
- Methodischer Teil der Arbeit
- Der Bildbegriff
- Der Iconic Turn in den Sozialwissenschaften
- Definition und Bedeutung von Fotografie
- Die ästhesiologische Bildhermeneutik
- Forschungsfragen
- Ikonen des Krieges
- Medienikonen - eine Begriffsdefinition
- Merkmale von Fotoikonen
- Akteure der Ikonisierung
- Kriegs- und Krisenfotografie
- Imaginierte Kriege des 19. Jahrhunderts
- Rolle der Bilder in den Weltkriegen
- Das Ende des schmutzigen Krieges in Vietnam
- Golfkrieg per Knopfdruck - Beginn der elektronischen Kriegsführung
- Die visuelle Kriegserklärung 9/11 und ihre Folgen
- Offene oder versteckte Gewalt
- Stille Gewalt im Bild - die Ikonisierung einer Fotografie
- Historischer Hintergrund der Fotografie: Die Flüchtlingskrise Europas
- Entstehung der Fotografie
- Analyse der ikonischen Fotografie: Leiche eines Kindes am Strand
- Publikations- und Rezeptionsgeschichte des Bildes
- Die Fotoikone Aylan
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Dynamiken der Kriegs- und Krisenfotografie und analysiert, wie bestimmte Bilder zu Ikonen werden.
- Der Einfluss von Fotografien auf die Wahrnehmung von Krieg und Krisen
- Die Rolle von Ikonen in der Konstruktion von kollektivem Gedächtnis
- Die Analyse der ästhesiologischen Bildhermeneutik und ihre Anwendung auf Fotoikonen
- Die Bedeutung von Stille und Gewalt in der Kriegs- und Krisenfotografie
- Die Ikonisierung des Bildes von Aylan, dem ertrunkenen Flüchtlingskind, und ihre gesellschaftliche Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich dem interdisziplinären Bildbegriff und beleuchtet den Iconic Turn in den Sozialwissenschaften. Es stellt die Besonderheiten der Fotografie und die Methode der ästhesiologischen Bildhermeneutik vor. Das zweite Kapitel definiert den Begriff der Ikone und untersucht die Faktoren, Prozesse und Akteure, die zur Ikonisierung von Fotografien führen. Im dritten Kapitel wird die Geschichte der Kriegs- und Krisenfotografie beleuchtet und ihre Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft untersucht. Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der Fotografie von Aylan, dem ertrunkenen syrischen Flüchtlingskind, mittels der ästhesiologischen Bildhermeneutik. Es untersucht den Moment der Stille im Bild und die Frage, warum dieses Bild so bewegt. Schließlich wird geklärt, ob die Fotografie die Kriterien und Prozesse einer ikonischen Fotografie erfüllt, basierend auf ihrer Publikations- und Rezeptionsgeschichte.
Schlüsselwörter
Kriegs- und Krisenfotografie, Fotoikonen, ästhesiologische Bildhermeneutik, Iconic Turn, Ikonisierung, Stille Gewalt, Aylan, Flüchtlingskrise, Medienikonen, visuelle Kriegserklärung, kollektives Gedächtnis, Bildbegriff.
Häufig gestellte Fragen
Was macht eine Fotografie zur 'Ikone'?
Bestimmte Kriterien, Publikationsprozesse und die Rezeptionsgeschichte führen dazu, dass ein Bild tief ins kollektive Bewusstsein eindringt und als historisches Symbol gilt.
Wer war Aylan Kurdi?
Aylan war ein syrisches Flüchtlingskind, dessen Fotografie (als Leiche am Strand) 2015 weltweit Bestürzung auslöste und zur Fotoikone der Flüchtlingskrise wurde.
Was ist der 'Iconic Turn' in den Sozialwissenschaften?
Die Erkenntnis, dass Bilder eine eigenständige Macht zur Wissensgenerierung und gesellschaftlichen Beeinflussung haben, die über den Text hinausgeht.
Was untersucht die 'ästhesiologische Bildhermeneutik'?
Diese Methode analysiert die sinnliche Wahrnehmung und die ästhetische Wirkung eines Bildes, um zu verstehen, warum es den Betrachter emotional bewegt.
Wie hat sich die Kriegsfotografie seit dem 19. Jahrhundert verändert?
Die Arbeit zeichnet den Weg von imaginierten Szenen über die Weltkriege und Vietnam bis zur elektronischen Kriegsführung (Golfkrieg) und 9/11 nach.
Was bedeutet 'stille Gewalt' im Bild?
Es bezeichnet Fotografien, die keine explizite Action zeigen, sondern durch Ruhe und Symbolik die Grausamkeit von Krisen oft eindringlicher vermitteln.
- Quote paper
- Carolin Wabra (Author), 2016, Stille Ikonen inmitten von Gewalt. Dynamiken der Kriegs- und Krisenfotografie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346751