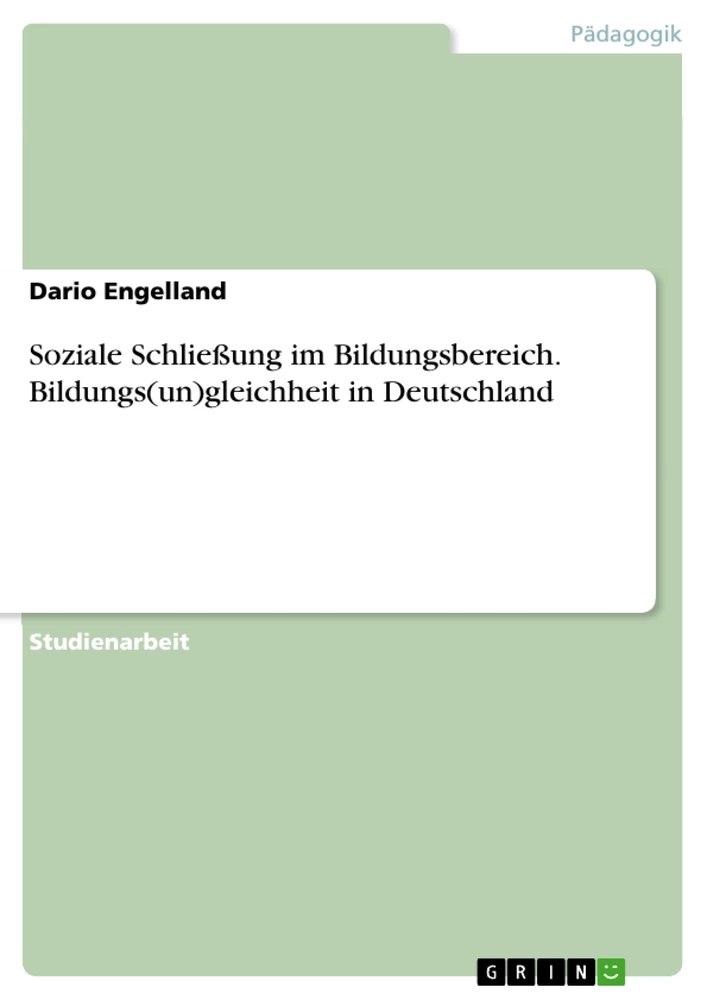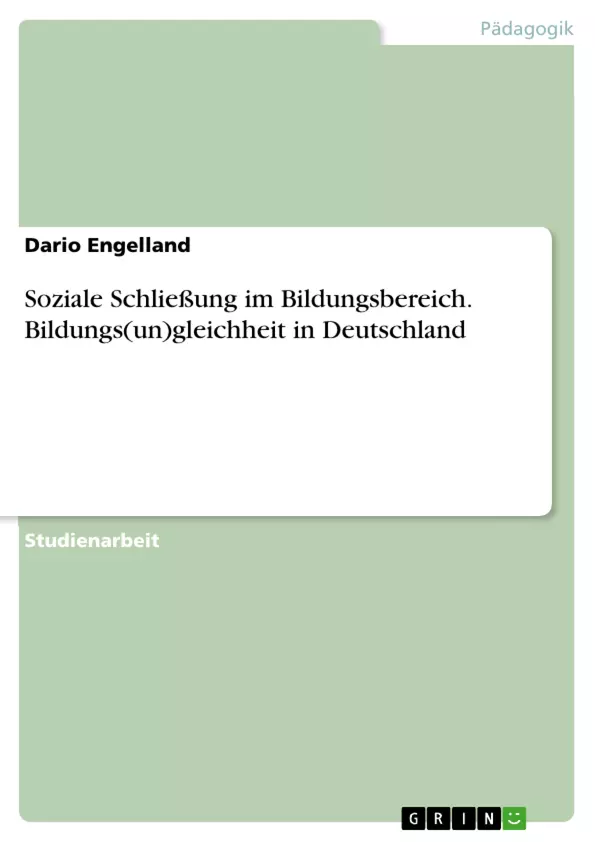Die Arbeit geht auf die derzeitige Bildungssituation in Deutschland ein und beschäftigt sich mit der Frage, welche Faktoren maßgeblich für den Zugang zu Bildung entscheidend sind und wie man diese eventuell angleichen kann.
Dazu wird auf das meritokratische Verständnis von Bildung und Chancen in unserer Gesellschaft eingegangen und der Einfluss von Herkunftsmerkmalen an Hand der Theorie von Boudon (1974) untersucht.
Soziale Schließung, als ein Grundbegriff der Soziologie, beschreibt grundsätzlich, dass die Möglichkeit, Mitglied einer sozialen Gruppe zu werden, beschränkt oder verboten ist.
Als Chancenungleichheit wird dagegen die über- oder unterdurchschnittliche Chance bestimmter Bevölkerungsgruppen bezeichnet, durch eigene Leistung sich Vor- oder Nachteile zu erarbeiten: beispielsweise bessere Bildungsabschlüsse zu erlangen, oder der Zugang zu bestimmten Berufen.
In unserer heutigen Gesellschaft erheben wir den Anspruch, jedem Gesellschaftsmitglied einen leistungsgerechten Bildungsstatus zu ermöglichen. Der Zugang zu Bildung sollte nicht von sozialen Faktoren, wie unterschiedlichen Sozialkapitalen abhängen, sondern lediglich durch Leistung bestimmt werden. Dieses sogenannte meritokratische Verständnis - abgeleitet von „meritum“, lateinisch „Ver-dienst“ - wird als gerecht angesehen.
Im Gegensatz zur sozialen Ungleichheit - die lediglich den manifestierten Lebensumstand beschreibt - ist der Begriff der Chancenungleichheit in unserem Verständnis stark wertend gebraucht. Jeder sollte zunächst einmal dieselben Voraussetzungen haben – wenn dem so ist, ist eine spätere soziale Ungleichheit das Resultat eines „fairen Wettbewerbs“ und unterschiedlicher individueller Anstrengungen. So zumindest die Theorie. In dieser Arbeit werden unter anderem Praxis und Status Quo in Deutschland beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was versteht man unter Bildungsungleichheit?
- Das Prinzip der Meritokratie in Bezug auf Bildung
- Leistungsselektion in der Grundschule
- Dimensionen sozialer Ungleichheit
- Der Einfluss der sozialen Herkunft
- Wie entstehen soziale Milieus?
- Theorie von Boudon (1974)
- Bildungsexpansion seit 1950
- Status Quo in Deutschland
- Ansätze zu einer besseren Chancengleichheit im Bildungssystem
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Faktoren, die maßgeblich über die Chancen-(un)Gleichheit im deutschen Bildungssystem entscheiden. Sie beleuchtet das Prinzip der Meritokratie im Bildungsbereich und untersucht, inwiefern die soziale Herkunft den Bildungserfolg beeinflusst. Darüber hinaus betrachtet die Arbeit Ansätze zur Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungssystem.
- Meritokratisches Verständnis von Bildung
- Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg
- Theorie von Boudon (1974) zur Erklärung sozialer Ungleichheit
- Bildungsexpansion in Deutschland seit 1950
- Chancenungleichheit im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Begriff der sozialen Ungleichheit und die Definition der Chancenungleichheit im Bildungssystem dar. Sie führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert den Fokus auf den Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg.
Was versteht man unter Bildungsungleichheit?
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Bildungsungleichheit als eine Form der sozialen Ungleichheit. Es beschreibt, dass Bildung als wertvolles gesellschaftliches Gut angesehen wird und Chancengleichheit im Bildungswesen bedeutet, allen Personen unabhängig von sozialen Faktoren gleiche Möglichkeiten zur Leistungsentfaltung zu ermöglichen.
Das Prinzip der Meritokratie in Bezug auf Bildung
Das Kapitel erläutert das Prinzip der Meritokratie im Bildungsbereich. Es beschreibt, dass alle Individuen entsprechend ihrer Fähigkeiten und Leistungen gleiche Chancen zum Erwerb von Bildungszertifikaten erhalten sollten. Leistungsfremde Kriterien wie soziale Herkunft oder Nationalität sollen keine Rolle spielen. Die Bedeutung von Leistung für den Bildungserfolg wird hervorgehoben.
Leistungsselektion in der Grundschule
Dieses Kapitel hinterfragt die Sinnhaftigkeit der frühzeitigen Leistungsselektion in der Grundschule. Es stellt die Frage, ob Schulnoten im Alter von 9-10 Jahren valide Aussagen über den zukünftigen Bildungserfolg treffen können und diskutiert die Rolle sozialer Faktoren bei der Einstufung von Schülern.
Dimensionen sozialer Ungleichheit
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Dimensionen sozialer Ungleichheit, wie materiellen Wohlstand, Macht und Prestige. Es stellt die theoretische Garantie der Chancengleichheit in Deutschland dar und definiert Chancengleichheit im Bildungswesen als die gleiche Möglichkeit zur Leistungsentfaltung unabhängig von leistungsfremden Eigenschaften.
Der Einfluss der sozialen Herkunft
Das Kapitel untersucht den Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg. Es wird die Verbindung zwischen sozialer Herkunft und Migrationshintergrund diskutiert und die Frage gestellt, inwieweit Migration oder die berufliche Zugehörigkeit der Eltern für Benachteiligungen verantwortlich ist.
Wie entstehen soziale Milieus?
Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung von sozialen Milieus als Gruppen gleich gesinnter Menschen mit ähnlichen Werthaltungen und Grundeinstellungen. Es wird auf die Bedeutung der sozialen Umgebung und den Einfluss von sozialen Brennpunkten auf die Chancen und Perspektiven von Kindern hingewiesen.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, Bildungsungleichheit, soziale Ungleichheit, Meritokratie, soziale Herkunft, Bildungsselektion, Leistung, soziale Brennpunkte, Bildungsexpansion, Boudon-Theorie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Bildungsungleichheit in Deutschland?
Es beschreibt den Zustand, in dem der Bildungserfolg stark von der sozialen Herkunft und nicht allein von der individuellen Leistung abhängt.
Was besagt das Prinzip der Meritokratie?
Meritokratie ist die Herrschaft der Leistung; jeder soll die gleichen Chancen haben, durch eigene Anstrengung und Begabung einen hohen Bildungsstatus zu erreichen.
Welchen Einfluss hat die soziale Herkunft nach Boudon?
Raymond Boudon unterscheidet zwischen primären Herkunftseffekten (Leistungsunterschiede) und sekundären Effekten (Bildungsentscheidungen der Eltern trotz gleicher Leistung).
Warum ist die Selektion nach der Grundschule umstritten?
Kritiker bezweifeln, dass Noten im Alter von 10 Jahren den künftigen Erfolg valide vorhersagen können und sehen darin eine Zementierung sozialer Unterschiede.
Was versteht man unter „sozialer Schließung“?
Ein soziologischer Begriff, der beschreibt, wie soziale Gruppen den Zugang zu Privilegien (wie Bildung) für Außenstehende begrenzen.
- Citar trabajo
- Dario Engelland (Autor), 2016, Soziale Schließung im Bildungsbereich. Bildungs(un)gleichheit in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346832