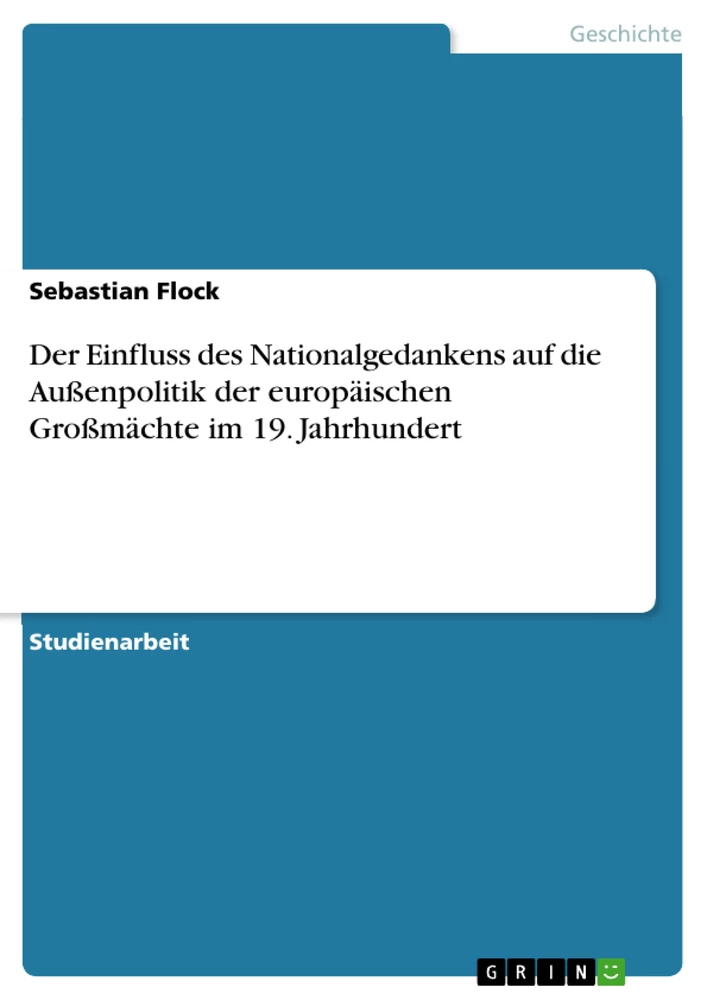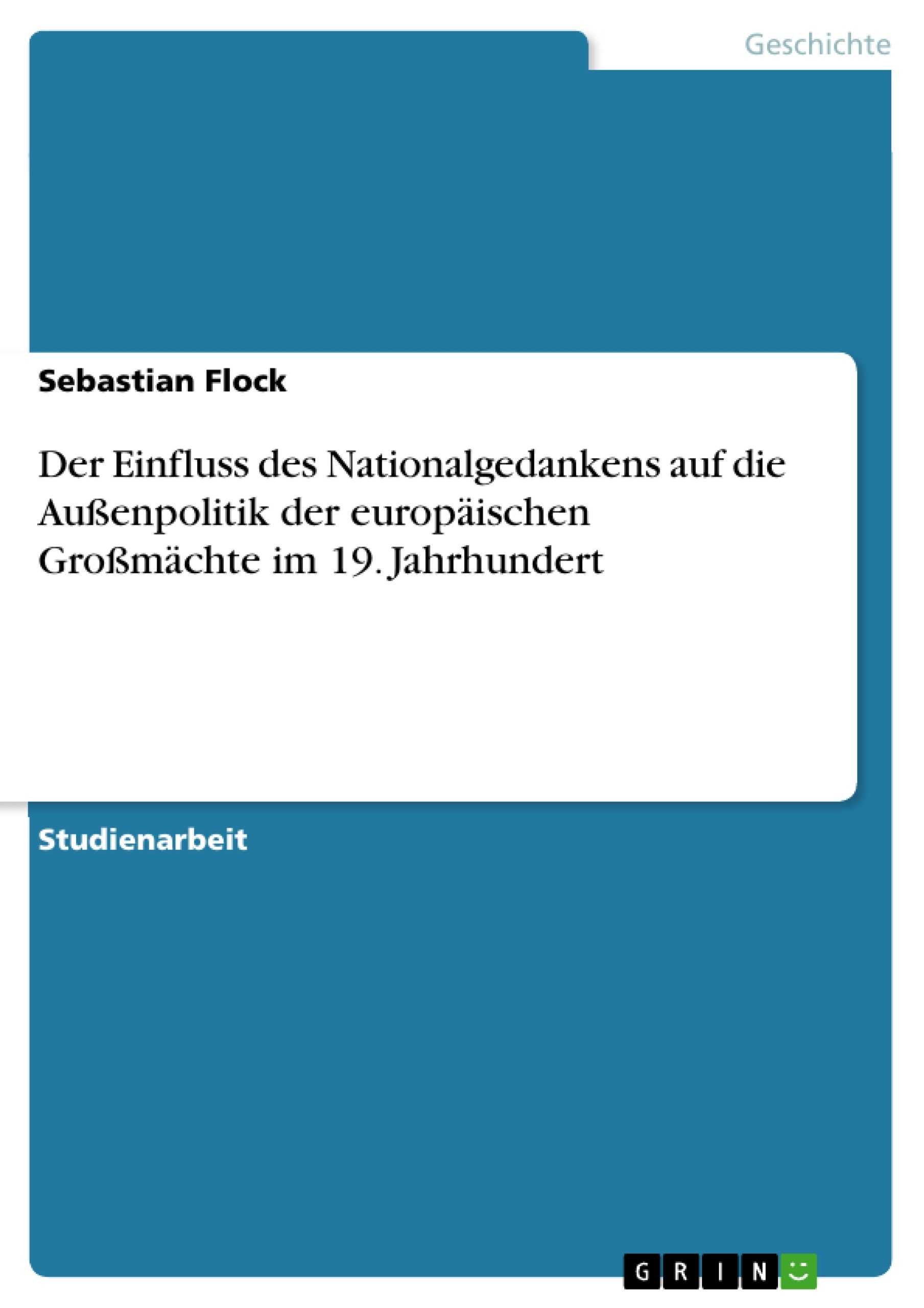Das Jahr 1815 leitete eine neue Epoche im kriegsgeplagten Europa des langen 19. Jahrhunderts ein. Durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses wurden die außenpolitischen Beziehungen zwischen den europäischen Großmächten dergestalt reglementiert, dass eine bemerkenswert lange Phase der friedlichen Koexistenz zwischen den Mächten der Pentarchie möglich war. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Europa während dieser Phase frei von Konflikten und Krisen blieb. Denn trotz der Sicherung des allgemeinen europäischen Friedens traten auf dem alten Kontinent immer wieder jene revolutionären Bestrebungen zu Tage, welche die Großmächte durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses einzudämmen versuchten. So blieb die Generation nach 1815 zwar von großen, europäischen Kriegen verschont, allerdings blieb stets ein Konfliktpotenzial spürbar, welches Dieter Langewiesche treffend als "Entzündbarkeit der Sozietät" beschreibt. Ein Katalysator jener revolutionären Tendenzen war zweifelsohne der für diese Epoche typische Nationalgedanke. Keine europäische Großmacht konnte es sich leisten, diese neue und bedeutende Strömung des 19. Jahrhunderts zu ignorieren. Der Umgang mit ihr gestaltete sich jedoch von Land zu Land unterschiedlich und veränderte nicht nur innenpolitische, sondern auch außenpolitische Ansichten. Auf den folgenden Seiten soll daher untersucht werden, inwiefern nationale Bestrebungen die internationalen Beziehungen zwischen den Großmächten veränderten und warum gerade diese zur oben genannten „Entzündbarkeit“ beitrugen. Die Untersuchung soll dabei chronologisch erfolgen. Der zeitliche Rahmen umfasst die Jahre zwischen 1815 und 1871, da mit der deutschen Reichsgründung die Ordnung des Wiener Kongresses grundlegend verändert wurde und somit ein neuer Epochenabschnitt begann, in welchem das nationalstaatliche Prinzip endgültig in Mitteleuropa etabliert worden war. Im Fokus dieser Arbeit sollen der außenpolitische Umgang der Großmächte mit Nationalbestrebungen und die daraus resultierenden Veränderungen in deren Beziehungen stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Außenpolitik nach dem Wiener Kongress
- Die Blockbildung innerhalb der europäischen Mächte
- Nationalismus an der Grenze zum Krieg zwischen den Großmächten
- Die Zäsur von 1848
- Die Zurückhaltung Englands und Russlands
- Zerfall der Wiener Ordnung und Veränderung der Außenpolitik
- Die Machtpolitik nach 1848
- Kriege im Zeichen des Nationalismus
- Interessenpolitik im Zeichen des Nationalismus
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Nationalgedankens auf die Außenpolitik der europäischen Großmächte im 19. Jahrhundert. Der Fokus liegt dabei auf der Zeit zwischen 1815 und 1871, da in dieser Phase die Ordnung des Wiener Kongresses maßgeblich von nationalstaatlichen Bestrebungen beeinflusst wurde.
- Die Blockbildung innerhalb der europäischen Mächte nach dem Wiener Kongress
- Die Rolle des Nationalgedankens als Katalysator für Konflikte und Krisen in Europa
- Die Reaktion der europäischen Großmächte auf nationale Bewegungen und deren Einfluss auf die internationale Ordnung
- Die Veränderungen in der Außenpolitik der Großmächte im Zuge des Vormarsches des Nationalismus
- Die Auswirkungen des Nationalgedankens auf die Entstehung nationaler Staaten in Europa
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Arbeit dar und erläutert den Einfluss des Nationalgedankens auf die europäischen Großmächte im 19. Jahrhundert.
Das erste Kapitel analysiert die außenpolitische Situation nach dem Wiener Kongress. Es beleuchtet die Blockbildung innerhalb der europäischen Mächte und die unterschiedlichen Ansichten über die Gestaltung des europäischen Gleichgewichts.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Zäsur von 1848. Es untersucht die Zurückhaltung Englands und Russlands im Umgang mit revolutionären Bestrebungen und die Folgen für die Wiener Ordnung.
Das dritte Kapitel beschreibt die Machtpolitik nach 1848. Es zeigt die Auswirkungen des Nationalismus auf die Kriegsführung und die Interessenpolitik der europäischen Großmächte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Nationalgedanken, der europäischen Großmachtpolitik, dem Wiener Kongress, Nationalismus, Nationalstaatsbildung, Blockbildung, Interessenpolitik und dem Einfluss nationaler Bestrebungen auf die internationale Ordnung im 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte der Nationalgedanke auf Europa nach 1815?
Der Nationalgedanke wirkte als Katalysator für revolutionäre Bestrebungen. Er forderte die bestehende Ordnung des Wiener Kongresses heraus und führte zu Spannungen zwischen den konservativen Großmächten.
Was war das Ziel des Wiener Kongresses?
Ziel war die Wiederherstellung eines stabilen Gleichgewichts zwischen den Großmächten (Pentarchie) und die Eindämmung revolutionärer sowie nationaler Bewegungen, um den Frieden in Europa zu sichern.
Warum gilt das Jahr 1848 als Zäsur in der Außenpolitik?
Die Revolutionen von 1848 erschütterten die Wiener Ordnung massiv. Sie zeigten die „Entzündbarkeit der Sozietät“ und zwangen Großmächte wie England und Russland zu einer Neuausrichtung ihrer Interessenpolitik.
Wie veränderte der Nationalismus die Kriege nach 1848?
Kriege wurden zunehmend im Zeichen nationaler Einigung oder Unabhängigkeit geführt. Die rein dynastische Machtpolitik wich einer Politik, die nationale Bestrebungen als Legitimationsgrundlage nutzte.
Was beendete die Ära des Wiener Kongresses endgültig?
Die deutsche Reichsgründung 1871 markiert das Ende dieser Epoche, da mit dem Entstehen eines mächtigen Nationalstaats in Mitteleuropa das alte Gleichgewicht der Kräfte grundlegend verändert wurde.
Was meint Dieter Langewiesche mit der „Entzündbarkeit der Sozietät“?
Damit ist das ständig vorhandene Konfliktpotenzial in der Bevölkerung gemeint, das durch nationale und liberale Ideen jederzeit zu Aufständen und Kriegen führen konnte.
- Citar trabajo
- Sebastian Flock (Autor), 2014, Der Einfluss des Nationalgedankens auf die Außenpolitik der europäischen Großmächte im 19. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346870