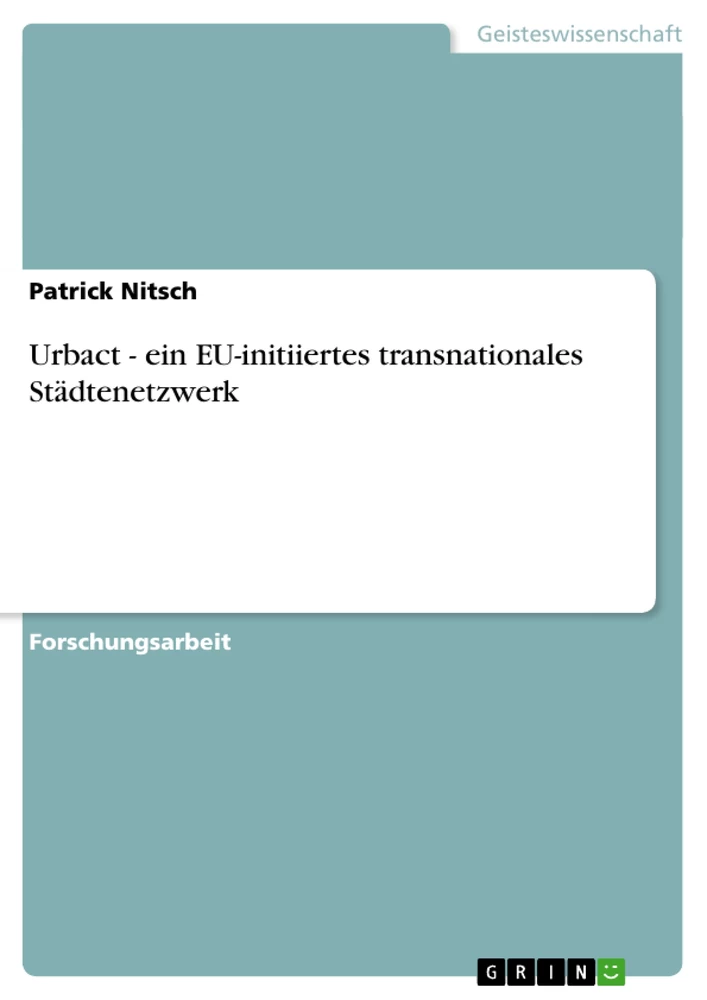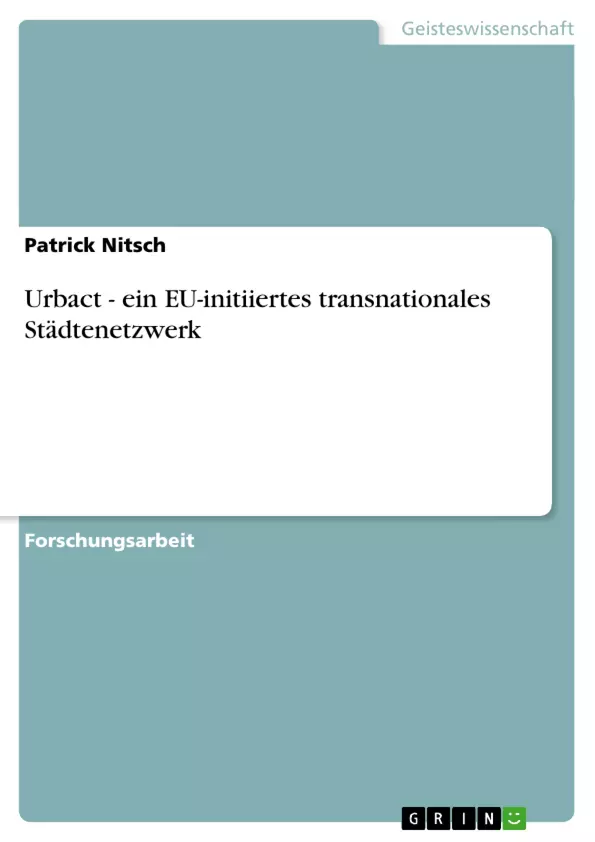Städtenetzwerke gibt es in den verschiedensten Ausführungen, was Größe oder Themengebiet betrifft. Eine besondere Form sind transnationale Städtenetzwerke. Kern beschreibt diese transnationalen Netzwerke, die hier am Beispiel Urbact der EU-Gemeinschaftsinitiative Urban genauer untersucht werden sollen, als „neuartige lokal-europäische Form von Governance“. Kern macht zwei Tendenzen für Städtenetzwerke aus, die auch anhand der Städtenetzwerke in der Gemeinschaftsinitiative Urban veranschaulicht werden können: · Von der nationalen hin zur europäischen und transnationalen Ebene: Im Rahmen des Programms Urban I, das 1994 von der Europäischen Kommission speziell für städtische Aufgabenfelder geschaffen wurde, um kritische Situationen in ausgewählten Stadtquartieren zu analysieren und zu beseitigen, entstand für die deutschen und österreichischen Urban-Städte das Deutsch-österreichische Urban-Netzwerk. Diese erste Phase von Urban lief bis 1999 und brachte weitere Netzwerke hervor, die jedoch weitestgehend auf den nationalen Rahmen beschränkt sind. Die Fortsetzung von Urban I startete im Jahr 2000.
· Spezialisierung: Urban II hat eine Laufzeit bis 2006 und entwickelte den Netzwerkgedanken, im Sinne der von Kern genannten zweiten Tendenz von Städtenetzwerken, weiter. Die transnationale Vernetzung innerhalb von Urban II trägt den Namen „Urbact“, vereint 14 spezialisierte transnationale Netzwerke und wird von der Europäischen Union als „einer der interessantesten Aspekte von Urban II“ benannt. Urbact läuft nun parallel zu den nationalen Urban-Netzwerken, die immer noch aktiv sind, da sich die Aufgabengebiete der Netzwerke nicht überschneiden. Die Städte, die durch Urban II neu in das Programm kamen, haben sich den nationalen Netzwerken angeschlossen, aber nicht unbedingt an Urbact teilgenommen. Obwohl allein in Deutschland 24 Städte an Urbact hätten teilnehmen können, beteiligen sich nur vier Städte, namentlich Leipzig, Chemnitz, Berlin und Gera an Netzwerken innerhalb Urbacts.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsinteresse
- Fallbeispiel: Urbact - ein EU-Initiiertes Städtenetzwerk
- Aufbau der Abhandlung und methodisches Vorgehen
- Forschungsergebnisse
- Die Einbindung deutscher Kommunen in europäische Governancestrukturen
- Funktionsweise und Anlass von Städtenetzwerken
- Begriffsbildung und Funktionsweise: Was ist ein Städtenetzwerk?
- Anlass: Warum Städtenetzwerke?
- Das Programm Urban und seine Netzwerke
- Die europäische Gemeinschaftsinitiative Urban
- Das Deutsch-österreichische Urban-Netzwerk
- Urbact
- Urbact aus Sicht der Beteiligten
- Städte, Städtenetzwerke und die Europäische Union
- Die europäische Union als Netzwerkbildner
- Netzwerk-Governance durch die Europäische Union
- Abnehmende Gestaltungsspielräume der Nationalstaaten und die transnationale Vernetzung
- Ausblick: Die Gemeinschaftsinitiative Urban einschließlich Urbact in der EU-Strukturpolitik nach 2006
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Abhandlung untersucht die Rolle des EU-Initiierten Städtenetzwerks Urbact als Beispiel für transnationale Vernetzung in der europäischen Stadtpolitik. Die Arbeit beleuchtet die Funktionsweise und den Anlass von Städtenetzwerken im Allgemeinen und geht dann auf die Besonderheiten von Urbact im Kontext der europäischen Gemeinschaftsinitiative Urban ein.
- Die Einbindung deutscher Kommunen in europäische Governancestrukturen
- Die Funktionsweise und den Anlass von Städtenetzwerken
- Das Programm Urban und seine Netzwerke, insbesondere Urbact
- Die Rolle der Europäischen Kommission als Netzwerkbildner
- Die Chancen und Potentiale transnationaler Vernetzung für die Europäische Union
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Forschungsinteresse an Urbact als transnationalem Städtenetzwerk vor und erläutert den Aufbau der Abhandlung. Es werden die Besonderheiten von transnationalen Städtenetzwerken im Kontext der EU-Gemeinschaftsinitiative Urban herausgestellt.
Kapitel 2 untersucht die Einbindung deutscher Kommunen in europäische Governancestrukturen. Es wird die Rolle von Städtenetzwerken als Instrument der interkommunalen Zusammenarbeit in Europa hervorgehoben.
Kapitel 2.2 beleuchtet die Funktionsweise und den Anlass von Städtenetzwerken. Der Begriff und die Funktionsweise werden definiert und die Gründe für die Entstehung von Städtenetzwerken werden diskutiert.
Kapitel 2.3 analysiert das Programm Urban und seine Netzwerke, insbesondere Urbact. Die europäische Gemeinschaftsinitiative Urban, das Deutsch-österreichische Urban-Netzwerk und Urbact werden näher betrachtet und die Perspektiven der beteiligten Akteure werden beleuchtet.
Kapitel 2.4 untersucht die Beziehungen zwischen Städten, Städtenetzwerken und der Europäischen Union. Die Rolle der EU als Netzwerkbildner, die Netzwerk-Governance durch die EU und die Bedeutung der transnationalen Vernetzung für die europäische Stadtpolitik werden analysiert.
Schlüsselwörter
Städtenetzwerke, transnationale Vernetzung, EU-Gemeinschaftsinitiative Urban, Urbact, europäische Stadtpolitik, Netzwerk-Governance, Gestaltungsspielräume der Nationalstaaten, interkommunale Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Urbact?
Urbact ist ein transnationales Städtenetzwerk der EU-Gemeinschaftsinitiative Urban, das den Erfahrungsaustausch zwischen europäischen Städten zu spezifischen städtischen Aufgabenfeldern fördert.
Welche Rolle spielt die EU-Initiative Urban?
Urban wurde 1994 geschaffen, um kritische Situationen in ausgewählten Stadtquartieren zu analysieren und zu beseitigen. Urbact stellt die transnationale Vernetzung innerhalb dieses Programms dar.
Warum beteiligen sich Städte an solchen Netzwerken?
Städtenetzwerke dienen als Form der „lokal-europäischen Governance“, ermöglichen den Wissensaustausch über nationale Grenzen hinweg und stärken die Position der Kommunen gegenüber dem Nationalstaat.
Welche deutschen Städte sind an Urbact beteiligt?
Obwohl viele Städte teilnehmen könnten, beteiligen sich laut Arbeit primär Leipzig, Chemnitz, Berlin und Gera an Netzwerken innerhalb von Urbact.
Was versteht man unter Netzwerk-Governance?
Es bezeichnet die Einbindung lokaler Akteure in europäische Entscheidungs- und Kooperationsstrukturen, wobei die EU oft als Initiator und Koordinator dieser Netzwerke fungiert.
- Arbeit zitieren
- Patrick Nitsch (Autor:in), 2005, Urbact - ein EU-initiiertes transnationales Städtenetzwerk, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34708