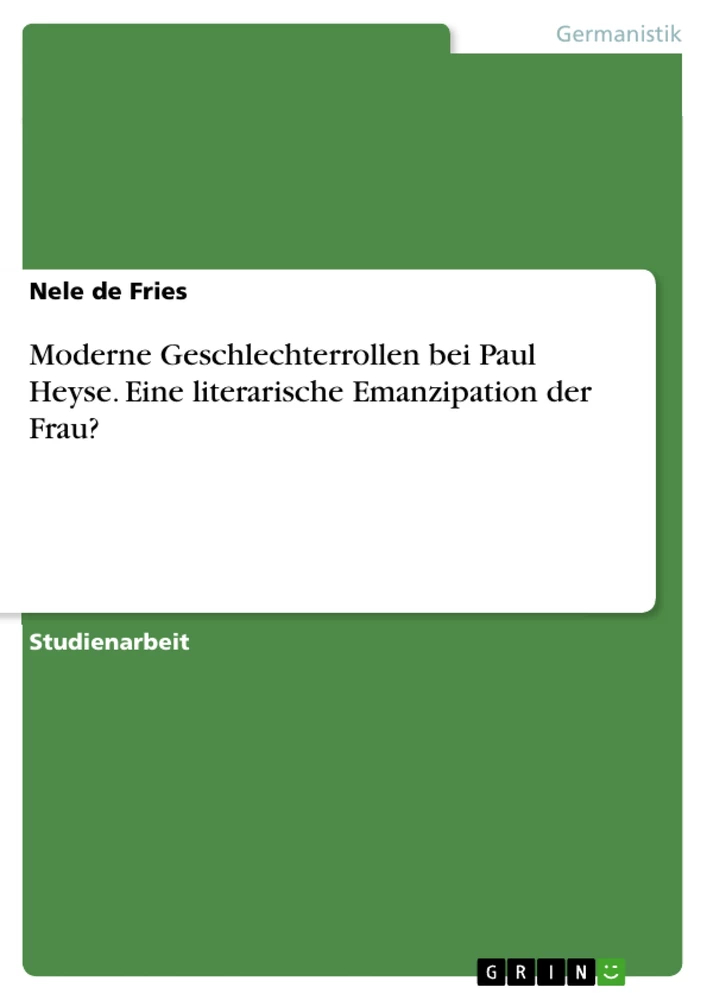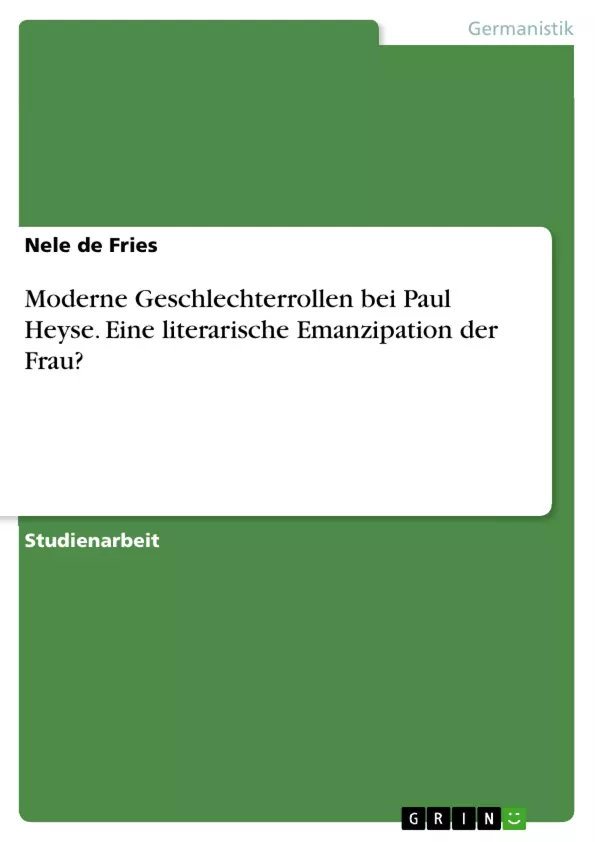Die Hausarbeit behandelt die bei Paul Heyse beschriebenen Geschlechterrollen, vorrangig in Bezug auf "L'arrabbiata" und "Das Mädchen von Treppi".
Der Autor Paul Heyse war ein Vorkämpfer der Frauenrechte, stets engagiert die Emanzipation voranzutreiben. In „L‘Arrabbiata“ wie auch in weiteren Novellen und Gedichten strengt Heyse moderne Geschlechterrollen an und stellt dadurch die Frage, ob durch die Erzählung solcher Modelle eine literarische Emanzipation der Frau erreicht werden kann.
Heyse unterstützte Frauen also hinsichtlich ihrer Rechte auf wissenschaftliche Bildung und Ausbildung, 1866 veröffentlichte er sogar ein Gedicht in der „Gartenlaube“ mit dem eindeutigen Titel „Frauenemancipation. Eine Fastenpredigt.“. Trotz der unmissverständlichen Benennung des Gedichts erzielt er durch die Versform eine gewisse Distanz zu seiner Kritik an der momentanen Bildungspolitik. Des Weiteren soll nun untersucht werden, ob Heyse das starke Frauenmotiv häufiger aufgreift, und erotische Situationen einen maßgeblichen Anteil an der Emanzipation haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Frauenbewegungen um 1860 - Bedeutung von Emanzipation, von Bildungsforderungen bis Frauenwahlrecht
- 3 L' Arrabbiata - "Die Eigensinnige" im Wandel
- 4 Starke Frauenrollen - Sittlichkeit und Sinnlichkeit im Kontrast
- 5 Vervollständigung Heysescher Mädchengestalten
- 6 Heyses literarisches Engagement für die Frauenemanzipation außerhalb der Novelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Paul Heyses Novelle "L' Arrabbiata" aus dem Jahr 1853, mit dem Fokus auf die Darstellung der weiblichen Figur Laurella und ihre Emanzipation im Kontext der gesellschaftlichen Normen und Frauenrechte der damaligen Zeit. Dabei wird die Frage untersucht, inwieweit Heyse in seinem Werk moderne Geschlechterrollen propagiert und ob durch die Darstellung solcher Modelle eine literarische Emanzipation der Frau erreicht werden kann.
- Darstellung der Frauenrechte und des Frauenbildes im 19. Jahrhundert
- Analyse der Figur Laurella in "L' Arrabbiata" und ihrer Entwicklung
- Untersuchung der Rolle von erotischen Situationen in Bezug auf die Emanzipation der Frau
- Heyses literarisches Engagement für die Frauenemanzipation im Kontext der zeitgenössischen Frauenbewegung
- Bedeutung der Novelle "L' Arrabbiata" für die Frauenliteratur und ihre Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Die Einleitung stellt die Protagonistin Laurella aus Heyses Novelle "L' Arrabbiata" vor und beleuchtet ihre selbstbestimmte und entschlossene Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen. Der Kontext der Frauenrechte und des Frauenbildes in der damaligen Zeit wird mit Bezug auf die Kirche und den bürgerlichen Moralkodex beleuchtet.
2 Frauenbewegungen um 1860 - Bedeutung von Emanzipation, von Bildungsforderungen bis Frauenwahlrecht
Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Frauenbewegung in Deutschland um 1860. Die Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins (ADF) und die Forderungen nach Bildung und Wahlrecht für Frauen stehen im Mittelpunkt der Ausführungen.
3 L' Arrabbiata - "Die Eigensinnige" im Wandel
Die Analyse der Figur Laurella in "L' Arrabbiata" steht im Zentrum dieses Kapitels. Es werden ihre anfängliche Ablehnung von Beziehungen und ihre Entwicklung im Laufe der Geschichte, insbesondere durch die Begegnung mit Antonio, beleuchtet.
4 Starke Frauenrollen - Sittlichkeit und Sinnlichkeit im Kontrast
Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung von starken Frauenrollen in Heyses Werk und dem Kontrast zwischen Sittlichkeit und Sinnlichkeit in der Figur der Laurella.
5 Vervollständigung Heysescher Mädchengestalten
Dieses Kapitel betrachtet die Figur der Laurella im Kontext weiterer weiblicher Figuren in Heyses Novellen und Gedichten.
6 Heyses literarisches Engagement für die Frauenemanzipation außerhalb der Novelle
Dieses Kapitel untersucht Heyses literarisches Engagement für die Frauenemanzipation in seinen anderen Werken, insbesondere in Bezug auf seine Gedichte und seine Auseinandersetzung mit der Bildungspolitik.
Schlüsselwörter
Frauenemanzipation, Frauenrechte, Frauenbild, Novelle, "L' Arrabbiata", Laurella, Paul Heyse, Bildung, Wahlrecht, gesellschaftliche Normen, Geschlechterrollen, erotische Situationen, literarische Emanzipation, Frauenbewegung, bürgerlicher Moralkodex, Kirche.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Paul Heyse und wie stand er zur Frauenemanzipation?
Paul Heyse war ein bedeutender Autor des 19. Jahrhunderts, der sich in seinen Werken für Frauenrechte, insbesondere für Bildung und wissenschaftliche Ausbildung, einsetzte.
Was ist das Besondere an der Figur Laurella in "L'arrabbiata"?
Laurella, auch "die Eigensinnige" genannt, ist eine starke Frauenfigur, die sich gegen gesellschaftliche Normen und traditionelle Rollenbilder auflehnt.
Wie thematisiert Heyse die literarische Emanzipation der Frau?
Er entwirft moderne Geschlechterrollen, in denen Frauen selbstbestimmt handeln und ihre Rechte auf Bildung und persönliche Freiheit einfordern.
Welche Rolle spielen erotische Situationen in Heyses Novellen?
Die Arbeit untersucht, ob Sinnlichkeit und erotische Spannungen bei Heyse als Mittel dienen, um traditionelle Moralvorstellungen aufzubrechen und zur Emanzipation beizutragen.
Welchen historischen Kontext behandelt die Hausarbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Frauenbewegungen um 1860, einschließlich der Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins und den Forderungen nach dem Frauenwahlrecht.
- Quote paper
- Nele de Fries (Author), 2015, Moderne Geschlechterrollen bei Paul Heyse. Eine literarische Emanzipation der Frau?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/347082