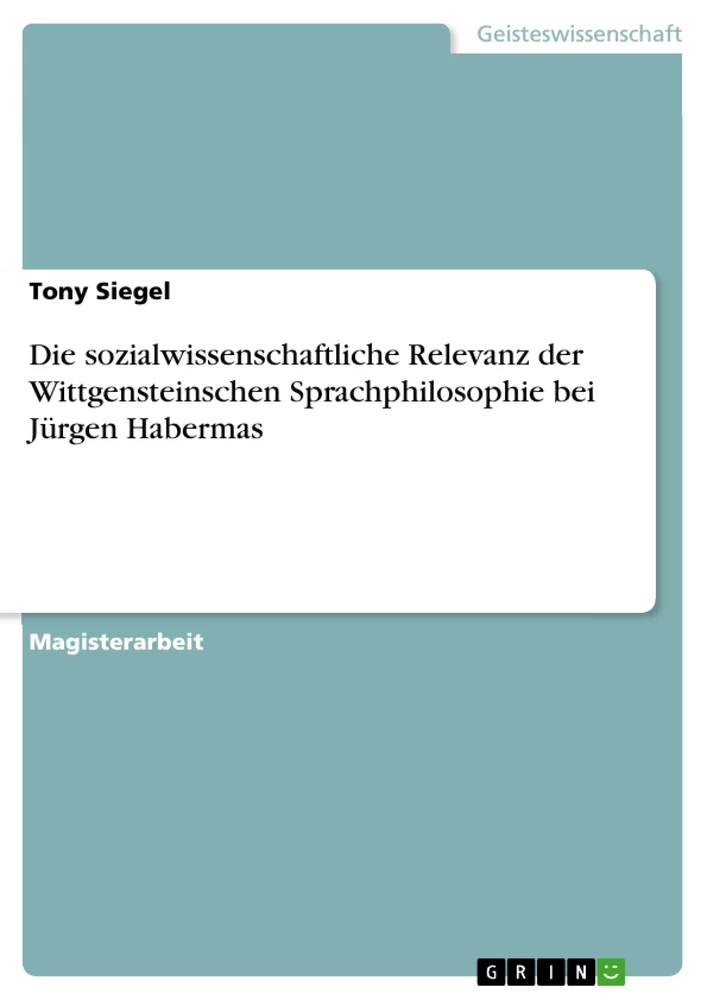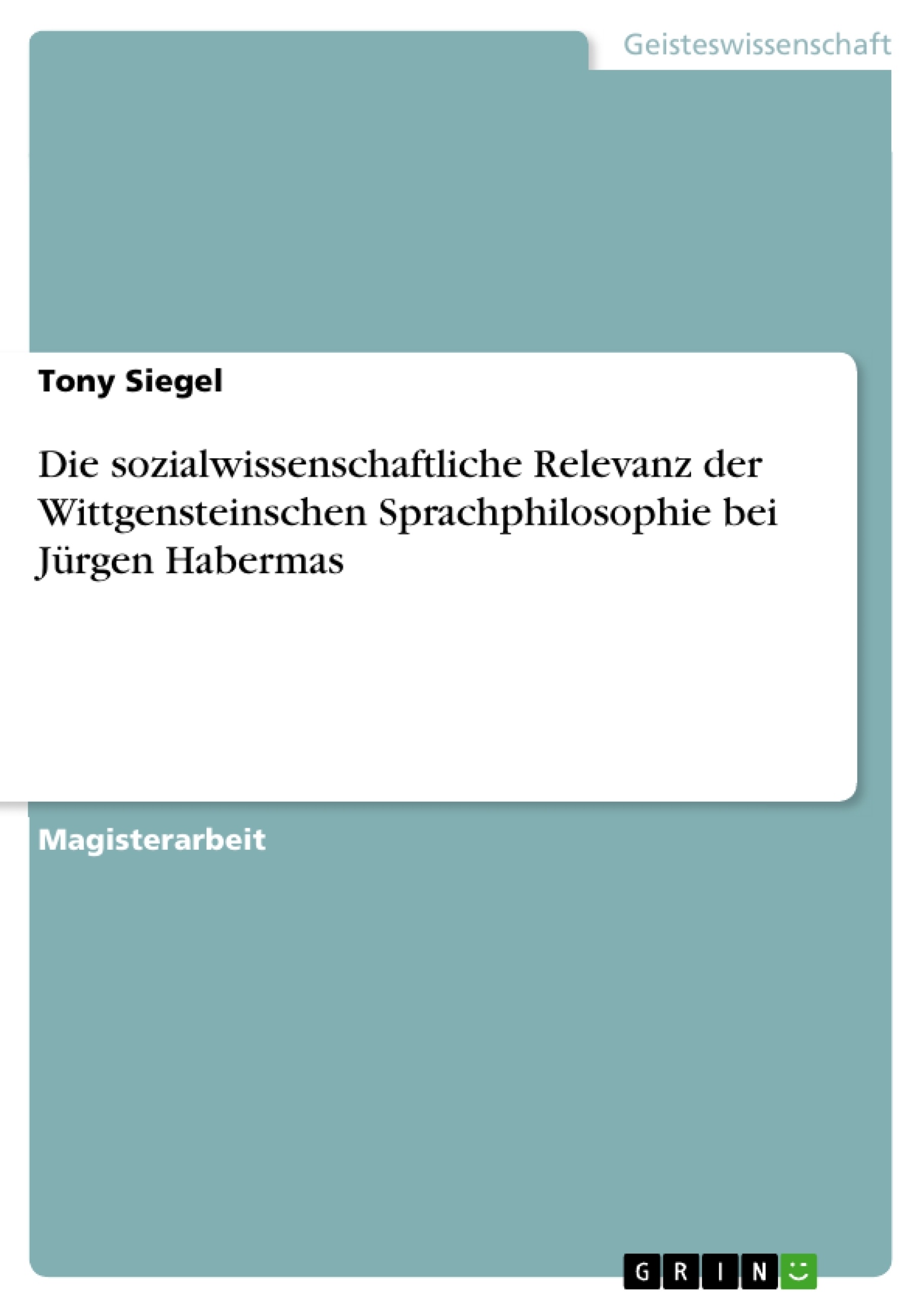In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, zu zeigen, inwiefern die Sprachphilosophie Wittgensteins einen prägenden Einfluss auf Habermas‘ Entwicklung eines kategorialen Rahmens für seine Kommunikationstheorie der Gesellschaft hat. Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, soll zunächst die Entstehungsgeschichte zu Habermas‘ kritischer Gesellschaftstheorie durchleuchtet werden, die in seiner Auseinandersetzung mit den frühen Ansätzen der Frankfurter Schule, Weber und Marx und ihrer Kritik zur instrumentellen Vernunft bzw. Zweckrationalität ihren Ursprung hat.
Die Überwindung der Bewusstseinsproblematik hat zur Folge, dass die Intersubjektivität eine Vorrangstellung vor der Subjektivität einnimmt. Dieser Aspekt ist für die theoretische Grundlage von Habermas‘ Gesellschaftskritik von zentraler Bedeutung.
Damit dies überhaupt vonstattengehen kann, ist ein Paradigmenwechsel erforderlich, wofür die Sprachphilosophie Wittgensteins eine Schlüsselrolle spielt. Ausgehend von diesen Gedanken ist Habermas nun in der Lage, das sprachtheoretische Fundament seiner Gesellschaftstheorie zu legen. Er bemängelt Wittgensteins Theorieverzicht zugunsten eines therapeutischen Umgangs philosophischer Probleme und betrachtet daher sein universalpragmatisches Programm als Weiterentwicklung der Wittgensteinschen Sprachspielanalyse.
Den Überlegungen zur Universalpragmatik folgend, ist die sprachliche Kommunikation für die Konstitution der Lebenswelt und die Begründung der Diskursethik verantwortlich. Nach einer Zwischenbetrachtung sollen die Elemente in Wittgensteins Spätphilosophie kurz skizziert werden, die den sozialwissenschaftlichen Charakter seiner Sprachanalyse auszeichnen. Der englische Philosoph Peter Winch gilt als einer der ersten, die versucht haben, die Sprachphilosophie Wittgensteins für die Sozialwissenschaften fruchtbar zu machen, insbesondere für die Grundlegung einer verstehenden Soziologie. Obwohl Winch in vielen Hinsichten Zustimmung bei Habermas findet, ergeben sich in Winchs Wittgenstein-Interpretationen Schwierigkeiten, die einer Weiterentwicklung bedürfen. Zur Lösung dieser Problematik soll die philosophische Hermeneutik Gadamers Habermas als Leitfaden dienen. Im abschließenden Kapitel werden die aufgeführten Argumente der vorliegenden Arbeit zusammengefasst und einen Ausblick über Themenvorschläge für eine mögliche Weiterforschung gehalten.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Siglenverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Jürgen Habermas: Die Genese einer Kritischen Gesellschaftstheorie
- 2.1 Zur Kritik der instrumentellen Vernunft: Eine Gefährdung der Moderne
- 2.2 Die Abkehr vom bewusstseinsphilosophischen Paradigma als Ausweg aus den Aporien der Moderne
- 2.3 Der Übergang von der Subjektivität zur Intersubjektivität
- 2.4 Der Paradigmenwechsel: Eine neue philosophische und soziologische Betrachtung
- 3 Die sprachtheoretische Grundlegung von Habermas' Soziologie
- 3.1 Was heißt Universalpragmatik? Das sprachtheoretische Fundament der Habermaschen Gesellschaftstheorie
- 3.2 Der sprachpragmatische Zugang zur Lebenswelt
- 3.3 Die Begründung der Diskursethik
- Zwischenbetrachtung
- 4 Zum sozialen Aspekt in Wittgensteins Sprachphilosophie: Wittgensteins Denkweg
- 4.1 Die Sprachspiele
- 4.2 Regelbefolgung und Gepflogenheiten
- 4.3 Wittgensteins Privatsprachenargument: Die Unmöglichkeit einer privaten Sprache
- 5 Die Grundzüge einer verstehenden Soziologie: Habermas' direkte Auseinandersetzung mit Wittgenstein und Winch
- 6 Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Relevanz der Wittgensteinschen Sprachphilosophie für die soziologische Theorie Jürgen Habermas. Sie verfolgt das Ziel, die Genese von Habermas' kritischer Gesellschaftstheorie nachzuzeichnen und die Bedeutung der sprachtheoretischen Grundlagen seiner Theorie aufzuzeigen. Dabei wird insbesondere die Rolle von Wittgensteins Sprachphilosophie im Hinblick auf die Konstruktion einer verstehenden Soziologie beleuchtet.
- Die Entwicklung der kritischen Gesellschaftstheorie bei Jürgen Habermas
- Die Relevanz der Sprache für die menschliche Verständigung und soziale Interaktion
- Die Bedeutung der sprachtheoretischen Grundlegung von Habermas' Soziologie
- Die Anwendung der Wittgensteinschen Sprachphilosophie auf soziologische Fragestellungen
- Die Herausarbeitung einer verstehenden Soziologie auf Grundlage von Wittgensteins und Habermas' Denkansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den theoretischen Rahmen der Arbeit vor. Sie erläutert die Bedeutung von Sprache für die menschliche Gesellschaft und die Relevanz von Wittgensteins und Habermas' Denkansätzen für die Soziologie.
- Kapitel 2: Jürgen Habermas: Die Genese einer Kritischen Gesellschaftstheorie
Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung von Habermas' kritischer Gesellschaftstheorie nach. Es analysiert die Kritik an der instrumentellen Vernunft und die Abkehr vom bewusstseinsphilosophischen Paradigma. Weiterhin beleuchtet es den Übergang von der Subjektivität zur Intersubjektivität und den Paradigmenwechsel in Habermas' Denken.
- Kapitel 3: Die sprachtheoretische Grundlegung von Habermas' Soziologie
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der sprachtheoretischen Grundlage von Habermas' Soziologie. Es erläutert die Universalpragmatik als das sprachtheoretische Fundament der Habermaschen Gesellschaftstheorie, den sprachpragmatischen Zugang zur Lebenswelt und die Begründung der Diskursethik.
- Kapitel 4: Zum sozialen Aspekt in Wittgensteins Sprachphilosophie: Wittgensteins Denkweg
In diesem Kapitel wird Wittgensteins Sprachphilosophie in Bezug auf den sozialen Aspekt der Sprache untersucht. Es werden die Konzepte der Sprachspiele, Regelbefolgung und Gepflogenheiten sowie Wittgensteins Privatsprachenargument behandelt.
- Kapitel 5: Die Grundzüge einer verstehenden Soziologie: Habermas' direkte Auseinandersetzung mit Wittgenstein und Winch
Kapitel 5 analysiert Habermas' Auseinandersetzung mit Wittgenstein und Winch und die daraus resultierende Konzeption einer verstehenden Soziologie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Sprache, Kommunikation, Gesellschaftstheorie, Sprachphilosophie, Universalpragmatik, Diskursethik, Lebenswelt, verstehende Soziologie, Wittgenstein, Habermas, Kritik der instrumentellen Vernunft.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte Wittgenstein auf Jürgen Habermas?
Wittgensteins Sprachphilosophie ermöglichte Habermas einen Paradigmenwechsel von der Bewusstseinsphilosophie zur Intersubjektivität, was das Fundament für seine Kommunikationstheorie der Gesellschaft bildete.
Was versteht Habermas unter „Universalpragmatik“?
Die Universalpragmatik ist Habermas’ Programm zur Erforschung der allgemeinen Bedingungen sprachlicher Verständigung. Er sieht sie als Weiterentwicklung von Wittgensteins Sprachspielanalyse.
Warum ist Wittgensteins „Privatsprachenargument“ für die Soziologie wichtig?
Das Argument zeigt die Unmöglichkeit einer privaten Sprache auf und betont, dass Bedeutung immer an soziale Regeln und öffentliche Gepflogenheiten gebunden ist, was eine rein subjektive Sichtweise ausschließt.
Welche Rolle spielt Peter Winch in dieser Arbeit?
Peter Winch war einer der ersten, der Wittgensteins Denken für eine „verstehende Soziologie“ nutzte. Habermas setzt sich kritisch mit Winchs Interpretationen auseinander und entwickelt diese weiter.
Was ist die „Kritik der instrumentellen Vernunft“?
Es ist ein zentraler Aspekt der Kritischen Theorie, der besagt, dass Vernunft in der Moderne oft nur noch als Mittel zum Zweck (Zweckrationalität) dient, was die menschliche Freiheit gefährdet.
Wie hängen Lebenswelt und Kommunikation zusammen?
Nach Habermas wird die Lebenswelt durch sprachliche Kommunikation konstituiert. Die Sprache dient als Medium, durch das soziale Interaktion und gesellschaftliche Integration stattfinden.
- Citar trabajo
- Tony Siegel (Autor), 2014, Die sozialwissenschaftliche Relevanz der Wittgensteinschen Sprachphilosophie bei Jürgen Habermas, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/347111