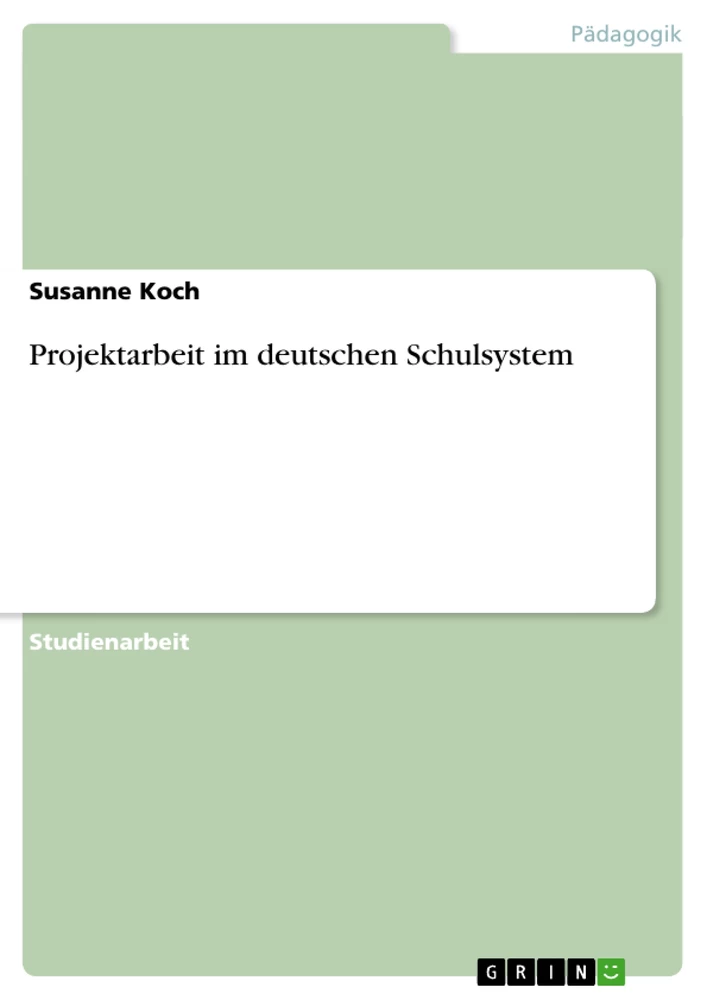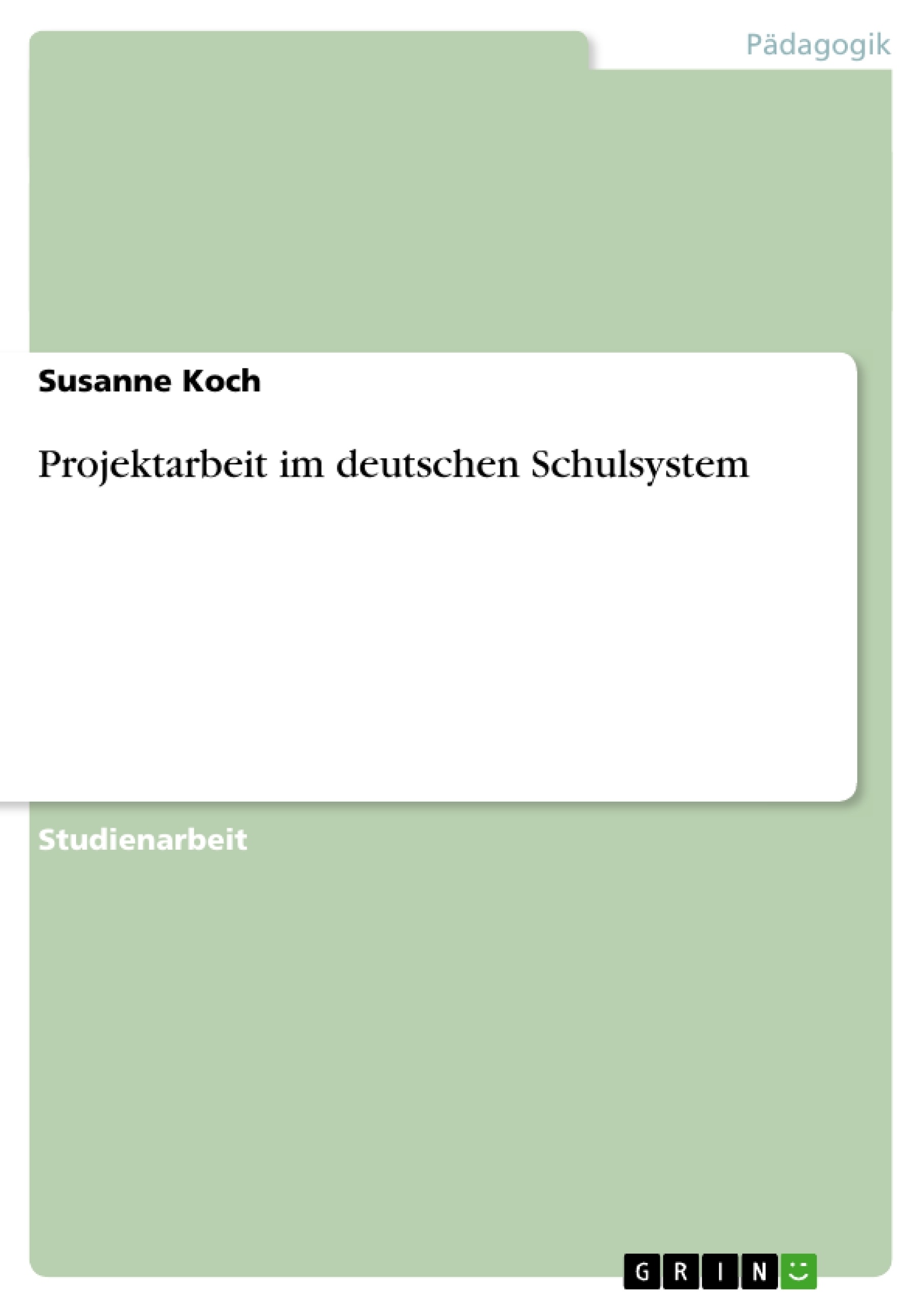„Deutsche Schüler – „Horde lernunwilliger, ungezogener, an Fernsehunterhaltung gewöhnter Bestien“, wie der Hamburger Bildungskritiker Dietrich Schwanitz sarkastisch meint? Zu unmotiviert, zu gelangweilt, zu abgelenkt, um sich für die Wissensgesellschaft des dritten Jahrtausends fit zu machen? Oder sind die Jungen und Mädchen einfach nur gut angepasst an eine Zeit, in der Wissen rasant verfällt, in der vom Werbespot bis zur Vorabendsoap der hedonistische Individualist den Ton angibt? Sind es deshalb vielleicht eher die Schulen mit ihren starren Lehrplänen, ihren großen Klassen und hergebrachten Unterrichtsmethoden, die dem Gesellschaftlichen Wandel nicht gewachsen sind und ihre kindliche Kundschaft allein lassen?“ (Der Spiegel, 23/2002)
Dieser Ausschnitt eines Artikels in dem Magazin „Spiegel“ spricht eine Thematik an, die ich in dieser Arbeit aufgreifen möchte. Kaum ein Begriff ist in der letzten Zeit so präsent gewesen, wie „Bildung“. Aufgrund des relativ schlechten Abschneidens Deutschlands in der PISA Studie, ist die Debatte um eine Bildungsreform so aktuell, wie seit den 60er Jahren nicht mehr. Alle Bildungsinstitutionen, vom Kindergarten bis zur Hochschule, werden beleuchtet und auch kritisiert.
Der Ruf nach einer schulpolitischen Reform wird immer lauter. Dennoch gehen die Meinungen von der Beibehaltung bzw. Verbesserung des bestehenden dreigliedrigen Systems bis hin zur Neureformierung der Schulformen weit auseinander.
Ich möchte in dieser Arbeit keine möglichen Reformierungsvorschläge anbieten, ich möchte die aktuelle Situation aufgreifen und hier Möglichkeiten aufzeigen, die (vielleicht) zu einer innerschulischen Verbesserung der Unterrichtsstrukturen führen können.
Im ersten Teil der Arbeit stelle ich den handlungsorientierten Unterrichtsansatz allgemein und, als eine mögliche Form dessen, die Projektarbeit, im speziellen, dar. Da eine komplette kritische Betrachtung in diesem Rahmen nicht möglich ist, konzentriere ich mich auf einige, für dieses System typische Elemente, um diese differenzierter darstellen zu können.
Mein Schwerpunkt liegt hierbei im System der Hauptschule und des Gymnasiums, als zwei schulpolitisch gegensätzliche Schulformen. Um eine einseitig literarische Sicht zu vermeiden, habe ich ein Interview mit einem Hauptschullehrer geführt, auf das ich mich im zweiten Teil beziehe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Handlungsorientierter Unterricht mit dem Schwerpunkt Projektunterricht
- Zum Begriff „Handlungsorientierter Unterricht“
- Zur Notwendigkeit handlungsorientierten Unterrichts
- Veränderte Sozialisationsbedingungen der Gegenwart
- Handlungsorientierter Unterricht als notwendige Alternative zum Frontalunterricht
- Wesentliche handlungsorientierte Unterrichtsformen
- Projektunterricht
- Begriffserklärungen
- Historischer Hintergrund des Projektunterrichts
- Merkmale des Projektunterrichts
- Das deutsche Bildungssystem
- Das deutsche Schulsystem
- Aufbau
- Die Dreigliedrigkeit und das Selektionsprinzip
- Sozialökonomische Schülerstruktur
- Erziehungs- und Bildungsziele
- Historische Vergangenheit des deutschen Schulsystems
- Die Hauptschule - Ein Abschied auf Raten?
- Schülerstruktur
- Aktuelle Situation
- Das Gymnasium – die eigentliche Hauptschule?
- Aktuelle Situation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema „Projektarbeit im deutschen Schulsystem“. Sie untersucht den handlungsorientierten Unterrichtsansatz und die Projektarbeit als eine seiner Formen im Kontext des deutschen Schulsystems. Die Arbeit analysiert die aktuelle Situation im Bildungswesen, insbesondere die Herausforderungen und Chancen der Hauptschule und des Gymnasiums im Vergleich.
- Handlungsorientierter Unterricht als Antwort auf veränderte Sozialisationsbedingungen der Gegenwart
- Projektunterricht als eine Form handlungsorientierten Unterrichts
- Der Aufbau und die Herausforderungen des deutschen Schulsystems
- Analyse der Situation an Hauptschule und Gymnasium
- Potenziale und Grenzen der Projektarbeit im deutschen Schulsystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Projektarbeit im deutschen Schulsystem“ vor und beleuchtet die aktuelle Debatte um Bildungsreform im Kontext der PISA-Studie. Die Arbeit fokussiert auf die Möglichkeiten einer innerschulischen Verbesserung der Unterrichtsstrukturen.
- Handlungsorientierter Unterricht mit dem Schwerpunkt Projektunterricht: Dieses Kapitel beschreibt den handlungsorientierten Unterrichtsansatz und seine theoretischen Grundlagen. Es beleuchtet die Notwendigkeit dieses Ansatzes im Kontext der veränderten Sozialisationsbedingungen der Gegenwart. Zudem wird der Projektunterricht als eine mögliche Form handlungsorientierten Unterrichts vorgestellt und seine Merkmale im Detail analysiert.
- Das deutsche Bildungssystem: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Aufbau und den zentralen Elementen des deutschen Schulsystems. Die Arbeit beleuchtet die Dreigliedrigkeit, das Selektionsprinzip und die sozialökonomische Schülerstruktur. Der Fokus liegt auf der Analyse der Hauptschule und des Gymnasiums als zwei schulpolitisch gegensätzliche Schulformen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen handlungsorientierter Unterricht, Projektunterricht, deutsche Bildungssystem, Hauptschule, Gymnasium, Sozialisationsbedingungen, Bildungsreform, PISA-Studie und Unterrichtsstrukturen. Sie analysiert die Chancen und Herausforderungen der Projektarbeit im Kontext des deutschen Schulsystems, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse und die sozioökonomische Schülerstruktur an Hauptschulen und Gymnasien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist handlungsorientierter Unterricht?
Dieser Unterrichtsansatz stellt das aktive Tun der Schüler in den Vordergrund. Ziel ist es, Wissen nicht nur passiv aufzunehmen, sondern durch selbstständiges Erarbeiten und Handeln zu verankern.
Welche Merkmale kennzeichnen Projektarbeit in der Schule?
Projektunterricht zeichnet sich durch Schülerorientierung, Selbstorganisation, Interdisziplinarität und die Erarbeitung eines konkreten Produkts oder Ergebnisses aus.
Warum ist Projektarbeit am Gymnasium oft schwieriger umzusetzen?
Oft stehen starre Lehrpläne, Zeitdruck durch das Abitur und ein Fokus auf rein fachwissenschaftliche Inhalte der offenen Struktur von Projekten entgegen.
Welche Vorteile bietet Projektunterricht an Hauptschulen?
An Hauptschulen hilft er besonders dabei, die Motivation durch Praxisbezug zu steigern und soziale Kompetenzen sowie lebenspraktische Fähigkeiten zu fördern.
Was war der Auslöser für die verstärkte Debatte um Bildungsreformen?
Das schlechte Abschneiden deutscher Schüler in der ersten PISA-Studie (2000) führte zu einer intensiven Diskussion über veraltete Unterrichtsmethoden und die Dreigliedrigkeit des Schulsystems.
- Quote paper
- Susanne Koch (Author), 2003, Projektarbeit im deutschen Schulsystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34712