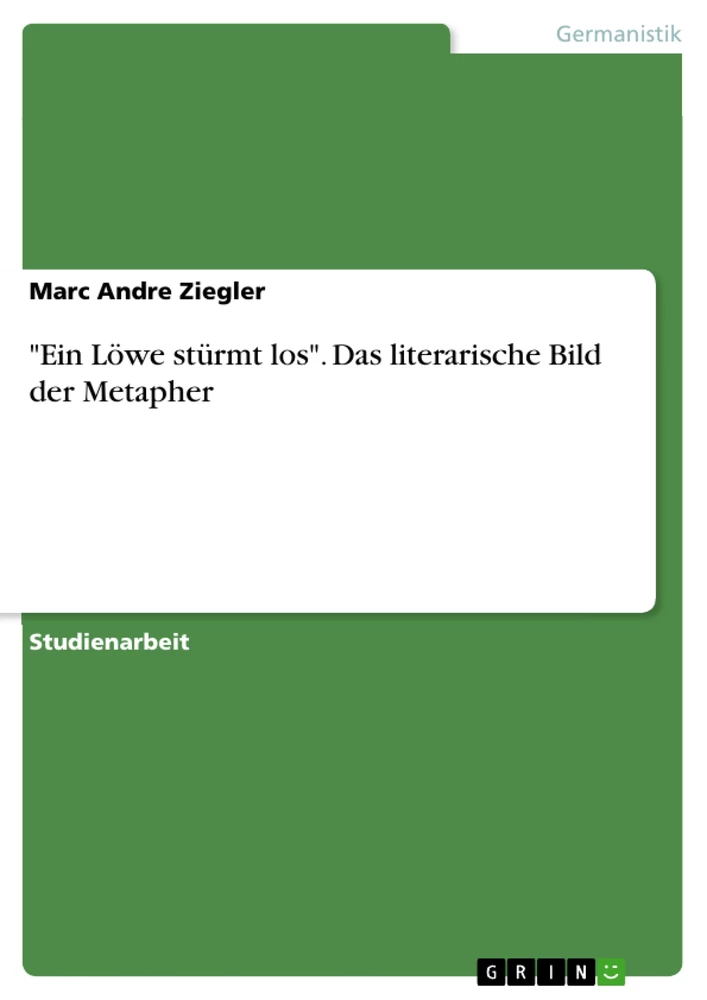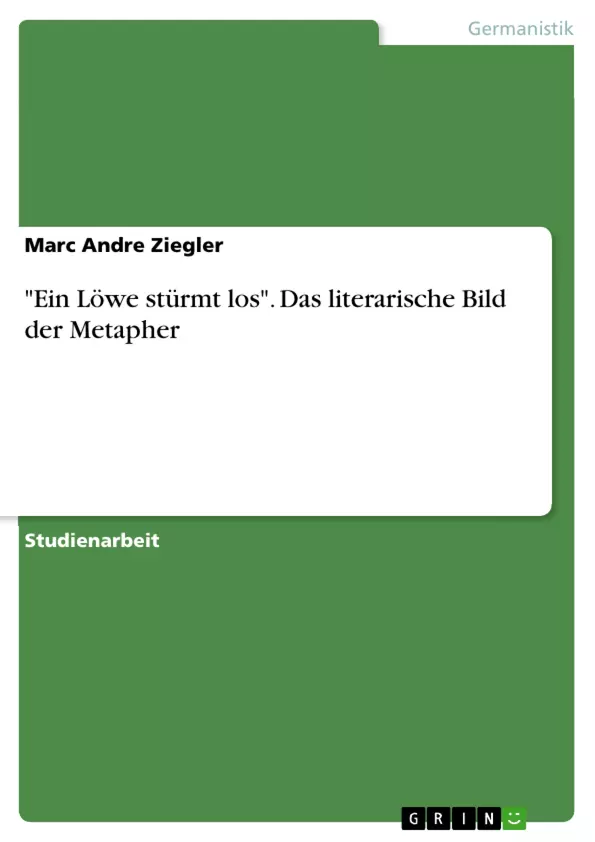Da es sich sowohl bei der Metapher als auch bei der Allegorie und dem Symbol um zentrale literaturwissenschaftliche Begriffe handelt, und diese nur schwer voneinander zu trennen sind, ist es unerlässlich, sie innerhalb einer Arbeit zumindest gemeinsam auftreten zu lassen. Im Übrigen sollte jeder, der sich mit Literatur beschäftigt, wissen, was sich hinter den Begriffen, mit denen man täglich zu tun hat, verbirgt.
Dennoch widmet sich die vorliegende Arbeit hauptsächlich der Metapher und hier besonders den unterschiedlichen Theorien und Definitionen. Schon hier sei darauf verwiesen, dass keine allgemein gültige Begriffsbestimmung gegeben werden soll, sondern lediglich eine Untersuchung bestehender Meinungen erfolgt. Vielmehr handelt es sich um einen Versuch der Redefinition.
Interessant wird es sein zu verfolgen, unter welchen Gesichtspunkten die jeweiligen Autoren die Erscheinung der Metapher betrachtet haben. Denn dies trägt entscheidend zur Beschreibung bei, die dann eventuell völlig anders als ihre Vorgänger ausfällt, ihnen jedoch keineswegs widersprechen muss. So muss man vermuten, dass es mehrere „richtige“ Definitionen der Metapher gibt, je nach dem aus welcher Perspektive man sie betrachtet.
Diese Arbeit beschäftigt sich unter anderem mit den Metapherntheorien von Max Black, Roman Jakobson und Harald Weinrich. Sie bietet außerdem einen Exkurs zu Allegorie und Symbol und schließlich einen eigenständigen Versuch zur Definition des Metaphernbegriffs.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorstellung und Begründung für die Wahl des Themas
- 1.1. Aufbau der Arbeit
- 2. Untersuchung verschiedener Lexikonartikel
- 2.1. Zusammenfassung
- 3. Metapherntheorien
- 3.1. Die Substitutionstheorie des Aristoteles
- 3.2. Andere Theorien
- 3.2.1. Max Black
- 3.2.2. Roman Jakobson
- 3.2.3. Harald Weinrich
- 4. Exkurs: Allegorie und Symbol
- 5. Der Versuch einer eigenen Definition von Metapher
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert verschiedene Ansätze zur Definition und Erklärung der Metapher in der Literaturwissenschaft. Dabei werden unterschiedliche Lexikonartikel und Metaphertheorien aus verschiedenen Epochen betrachtet, um die Entwicklung des Verständnisses dieses literarischen Bildes aufzuzeigen.
- Untersuchung verschiedener Lexikonartikel und deren Definitionen der Metapher
- Analyse verschiedener Metaphertheorien, insbesondere Vergleichstheorien
- Re-Definition der Metapher im Kontext der untersuchten Theorien
- Abgrenzung der Metapher von verwandten Begriffen wie Allegorie und Symbol
- Diskussion der Kontinuität und Divergenz in der Begriffsgeschichte der Metapher
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Motivation und den Aufbau der Arbeit, die sich mit der Untersuchung der Metapher im Kontext verschiedener Lexikonartikel und Theorien beschäftigt. Kapitel zwei analysiert verschiedene Lexikonartikel und extrahiert deren Kernpunkte, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Definitionen und Erklärungen des literarischen Bildes der Metapher aufzuzeigen. Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse verschiedener Metaphertheorien, wobei die Arbeit eine generelle Unterscheidung zwischen Vergleichstheorien und anderen Ansätzen vornimmt. Kapitel vier behandelt die verwandten Begriffe Allegorie und Symbol. Das fünfte Kapitel präsentiert den Versuch, aus den gewonnenen Erkenntnissen eine eigene, am Gebrauch orientierte Definition der Metapher zu entwickeln, die sich auf basale Aussagen beschränkt und Unterschiede im Vergleich zum Symbol hervorhebt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Metapher als literarisches Bild und befasst sich mit verschiedenen Lexikonartikeln, Theorien und Definitionen. Dabei stehen im Zentrum Begriffe wie Übertragung, Vergleich, Bildspender, Bildempfänger, Uneigentlichkeit, sprachlicher Ausdruck, Ähnlichkeitsbeziehung, Referenz, Kontext und Begriffsgeschichte. Weiterhin werden die verwandten Begriffe Allegorie und Symbol behandelt.
- Quote paper
- Marc Andre Ziegler (Author), 2005, "Ein Löwe stürmt los". Das literarische Bild der Metapher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/347154