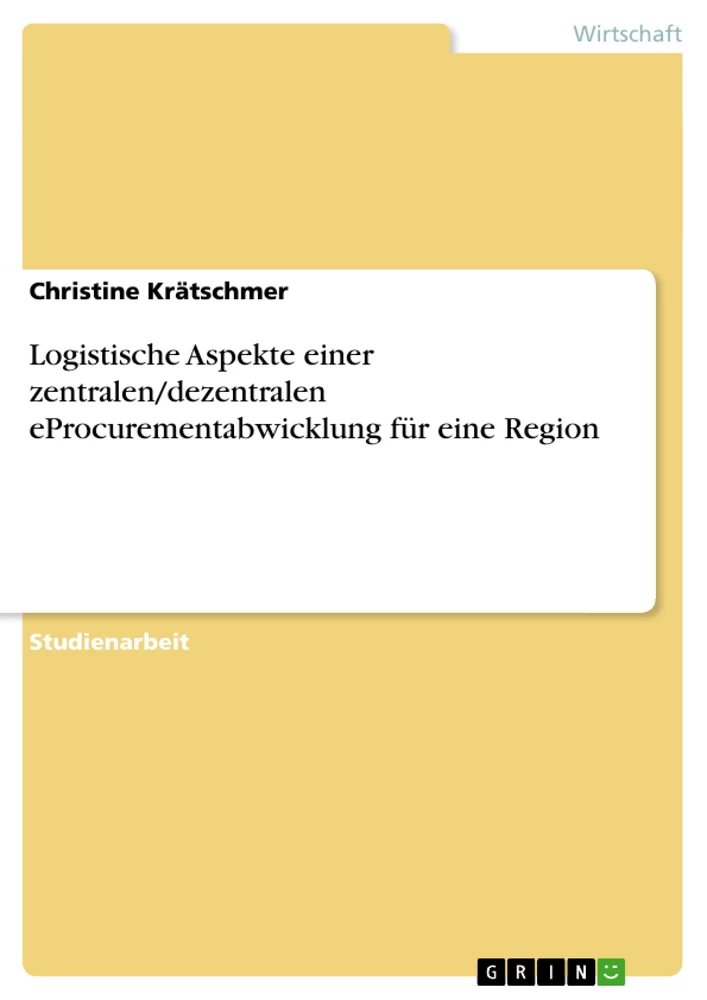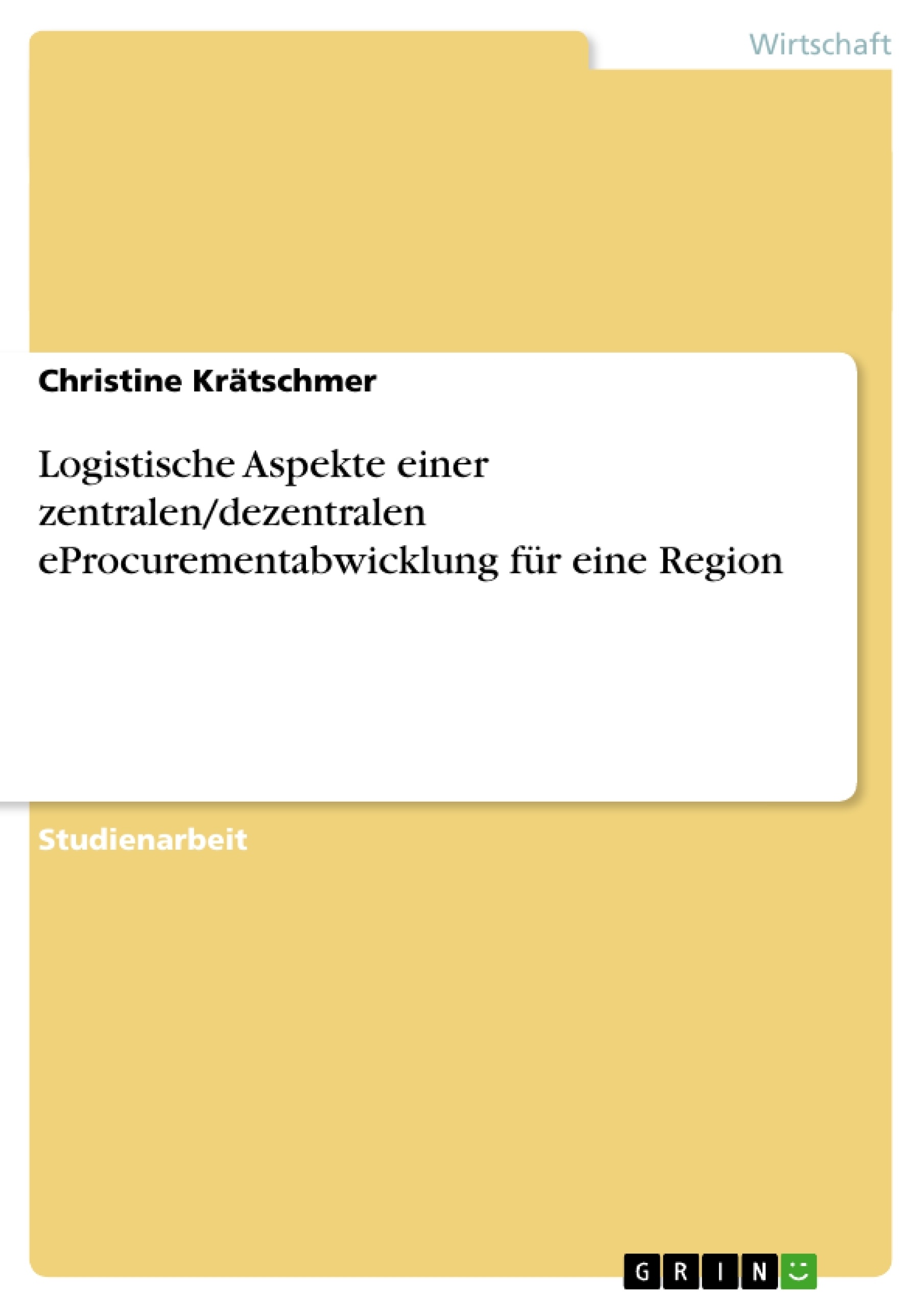Der Beschaffungsbegriff subsumiert all diejenigen Aktivitäten, die zur Versorgung einer organisatorischen Einheit mit Material, Dienstleistungen, Betriebs- und Arbeitsmitteln aus externen Quellen durchgeführt werden müssen. Primäres Ziel des Beschaffungsmanagements ist die Unterstützung der übergeordneten Unternehmensziele. Der Logistik als prozessorientierter Querschnittsfunktion fällt im Umfeld der Beschaffung neben der viel zitierten Aufgabe der zeitpunkt-, mengen- und ortsgerechten Bereitstellung benötigter Güter auch die Organisation der damit einhergehenden Informationsströme zu. Bei der Wahrnehmung all dieser Aufgaben steht stets die Verfolgung des Kostenminimierungsziels im Vordergrund. Beschaffungsfunktionen lassen sich im Wesentlichen in strategische und operative Aufgaben unterscheiden. Die strategische Beschaffung beinhaltet u.a. Aufgaben der Beschaffungsmarktbearbeitung i.S.v. Marktforschung, sowie Analyse, Bewertung und Auswahl von Lieferanten, Aushandeln von Rahmenverträgen mit Zulieferern und Pflege der Lieferbeziehungen. Zu den wesentlichen Aspekten der operativen Beschaffung gehören Bedarfsermittlung und Bestandskontrolle, sowie die Lieferantenauswahl in Fällen, in denen durch das strategische Beschaffungsmanagement kein Lieferant festgelegt wurde. Darüber hinaus sind der Bestellvorgang selbst, die Überwachung der Bestellung, und die Zahlungsabwicklung Bestandteile der operativen Beschaffungsfunktion. Abhängig davon, ob der Lieferant die Verantwortung für die (transport-) logistische Abwicklung trägt, oder ob ein Logistikdienstleister zwischengeschaltet ist, sind auch Transportaufgaben diesem Bereich zuzuordnen [BOGA04, S. 48ff.]. In der Praxis lässt sich beobachten, dass ein Ungleichgewicht in der Verteilung zwischen strategischen und operativen Beschaffungstätigkeiten vorherrscht. So verwenden die mit Beschaffungsaufgaben betrauten Mitarbeiter einen Großteil der verfügbaren Zeit auf die operativen Beschaffungsaktionen strategisch unbedeutender Güter [KEUP02, S. 181].
Inhaltsverzeichnis
- Logistische Ziele der Beschaffung
- eProcurement
- Eignung des eProcurement für die Güterbeschaffung
- Ausprägungsformen von eProcurement
- Katalogbasierte Beschaffungssysteme
- Elektronische Marktplätze
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den logistischen Aspekten von eProcurement, einem Konzept, das auf eine Optimierung der Beschaffungsprozesse durch Digitalisierung abzielt. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Eignung von eProcurement für die Beschaffung verschiedener Gütergruppen und der detaillierten Betrachtung von zwei zentralen Ausprägungsformen: katalogbasierten Beschaffungssystemen und elektronischen Marktplätzen.
- Optimierung der Beschaffungsprozesse durch Digitalisierung
- Analyse der Eignung von eProcurement für verschiedene Gütergruppen
- Detaillierte Betrachtung von katalogbasierten Beschaffungssystemen
- Detaillierte Betrachtung von elektronischen Marktplätzen
- Kostenminimierung als zentrales Ziel
Zusammenfassung der Kapitel
Logistische Ziele der Beschaffung
Dieses Kapitel definiert den Beschaffungsbegriff und beleuchtet die zentralen Ziele des Beschaffungsmanagements. Die Bedeutung der Logistik als Querschnittsfunktion wird im Kontext der Beschaffung hervorgehoben, wobei die Verfolgung des Kostenminimierungsziels im Vordergrund steht. Die Unterscheidung zwischen strategischen und operativen Beschaffungstätigkeiten wird erläutert, wobei ein Ungleichgewicht in der Praxis beobachtet wird.
eProcurement
Das Konzept des eProcurement wird eingeführt, wobei die Entlastung des Einkaufs von operativen Aufgaben und die Verbesserung von Zeit, Kosten und Qualität im Fokus stehen. Die Dezentralisierung und Automatisierung von Beschaffungsprozessen sowie die Freigabe von Ressourcen für strategische Funktionen werden beschrieben.
Eignung des eProcurement für die Güterbeschaffung
Dieses Kapitel untersucht die Eignung des eProcurement für die Beschaffung verschiedener Gütergruppen, insbesondere für indirektes Material wie MRO-Güter und C-Teile. Der hohe Standardisierungsgrad dieser Güter sowie der erhebliche Kostenaufwand bei traditionellen Beschaffungsprozessen machen sie besonders geeignet für eine Automatisierung.
Ausprägungsformen von eProcurement
Die beiden zentralen Ausprägungsformen von eProcurement, katalogbasierte Beschaffungssysteme und elektronische Marktplätze, werden in diesem Kapitel vorgestellt. Die Funktionsweise und die Vorteile der jeweiligen Lösungen werden ausführlich dargestellt, wobei auch auf die Herausforderungen bei der Implementierung und Pflege der Systeme eingegangen wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den logistischen Aspekten von eProcurement, einem Konzept, das auf die Optimierung der Beschaffungsprozesse durch Digitalisierung abzielt. Die zentralen Themengebiete sind die Eignung des eProcurement für die Beschaffung verschiedener Gütergruppen, die Analyse von katalogbasierten Beschaffungssystemen und elektronischen Marktplätzen, sowie die damit verbundenen Kostenminimierungsziele. Darüber hinaus werden Aspekte wie Standardisierung, Automatisierung, Dezentralisierung und die Bedeutung von Informationsströmen im Kontext des Beschaffungsmanagements beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eProcurement?
eProcurement bezeichnet die elektronische Unterstützung der Beschaffungsprozesse, um Zeit, Kosten und Qualität im Einkauf zu optimieren.
Welche Güter eignen sich besonders für eProcurement?
Besonders geeignet sind indirekte Materialien wie MRO-Güter (Maintenance, Repair, Operations) und C-Teile, da diese einen hohen Standardisierungsgrad aufweisen.
Was ist der Unterschied zwischen strategischer und operativer Beschaffung?
Strategische Beschaffung umfasst Marktforschung und Lieferantenauswahl, während operative Beschaffung die eigentliche Bestellung, Überwachung und Zahlungsabwicklung beinhaltet.
Wie helfen elektronische Marktplätze in der Logistik?
Sie bündeln Angebot und Nachfrage digital, reduzieren Prozesskosten und verbessern den Informationsfluss zwischen Unternehmen und Lieferanten.
Was sind katalogbasierte Beschaffungssysteme?
Dies sind Systeme, in denen Mitarbeiter aus vordefinierten elektronischen Katalogen bestellen können, was den operativen Aufwand im Einkauf massiv reduziert.
- Citar trabajo
- Christine Krätschmer (Autor), 2004, Logistische Aspekte einer zentralen/dezentralen eProcurementabwicklung für eine Region, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34763