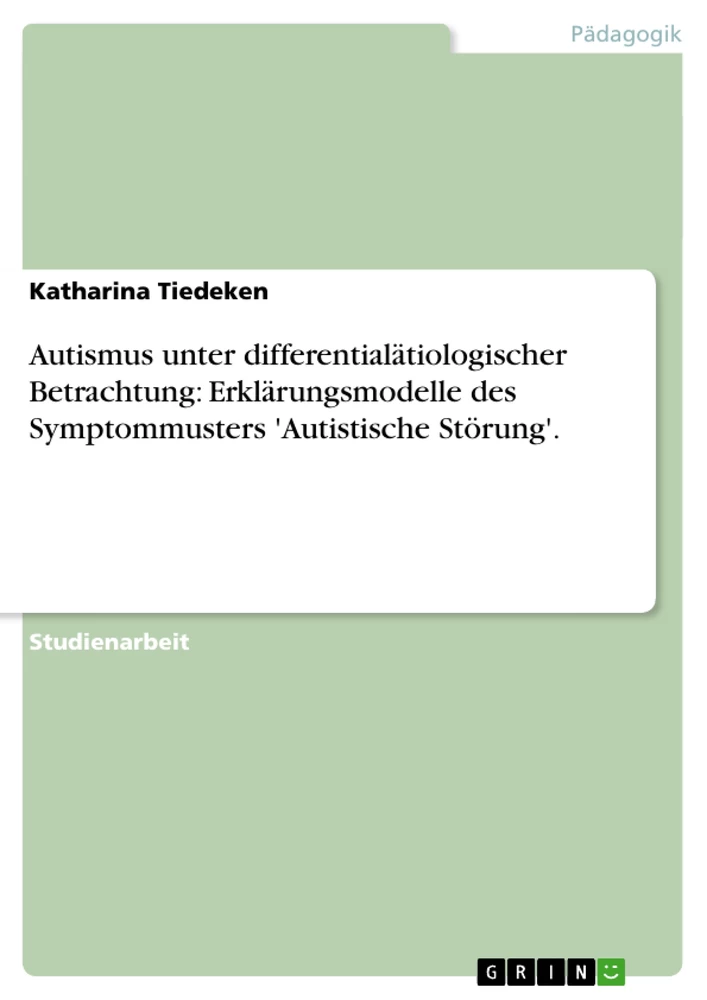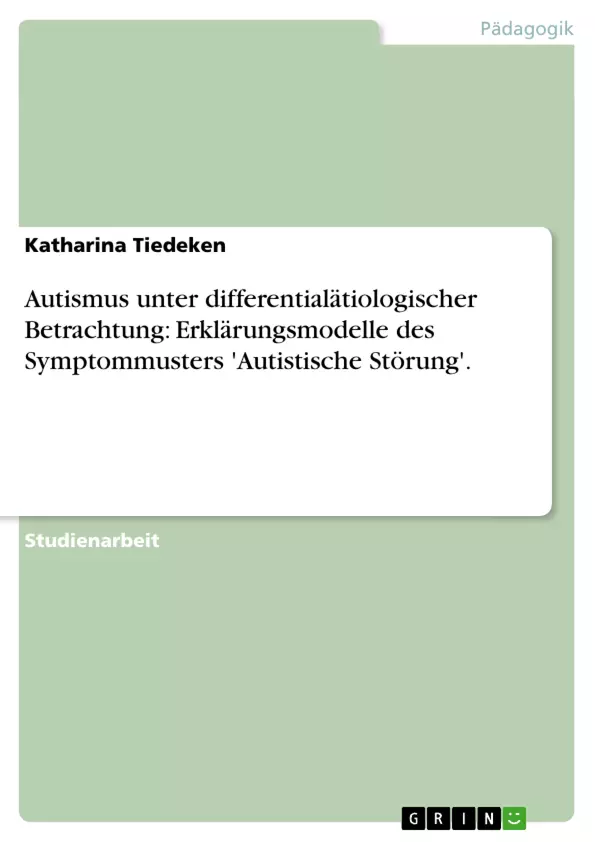Nach Paul Watzlawick (Watzlawick, Beavin, Jackson 1996, Seite 51) kann man nicht nicht kommunizieren, aber es gibt Menschen, denen die Fähigkeit, mit anderen Menschen fühlend verbunden zu sein, auf besondere Art und Weise nicht möglich ist.
Sie leiden unter dem, was in der Alltagssprache als „autistisch“ bezeichnet wird. Ausgehend von dem Gedanken, dass eine solche auf den sozialen Kontakt und die Empathie mit anderen Menschen bezogene Auffälligkeit auf Ablehnung der Umwelt stößt, möchte ich die These aufstellen, dass Aufklärung und Kenntnis über die Krankheit ein Schritt zu mehr Verständnisse und Integration sein kann. Walther (1999) schreibt zum Wissenstand über diese Krankheit: "Die Früherkennung gestaltet sich für viele Eltern schwierig, da das autistische Phänomen aufgrund seiner Seltenheit in der Allgemeinbevölkerung noch relativ unbekannt ist" (Walther 1999, Seite 13).
Zusätzlicher Handlungsbedarf in bezug auf eine Aufklärung über das Symptommuster Autismus findet seine Begründung darin, dass Kinder bei zunehmenden Ein-Kind-
Familien häufig erst im Vorschulbereich im Kindergarten Kontakte zu anderen Kindern finden oder Eltern einen Vergleich zu anderen Kindern erleben. Leitende These meiner Arbeit ist, dass ein Wissen über die Symptommuster der „autistischen Störung“ für im pädagogischen Bereich arbeitende Menschen wichtig ist, um den autistisch Behinderten und ihrem familiären Umfeld gerade am Anfang eines Lebensweges zum Beispiel im Vorschulbereich eine heilpädagogische Hilfe zu geben, mögliche autistische Kontaktstörungen zu erkennen und Kinder mit autistischen Zügen in einer heilpädagogischen Betreuung zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen und Begriffsbestimmungen
- Kanner-Syndrom
- Asperger-Syndrom
- Zusammenfassender Vergleich von Kanner-Syndrom und Asperger-Syndrom
- Weitere Ansätze
- Zusammenfassung der Hauptsymptome autistischer Störung
- Historiogenese der Erforschung
- Diskussion der Ursachen. Unsicherheiten der Ursachen
- Psychologische Erklärung
- Kognitive Theorie nach Baron-Cohen (1985)
- Theory of Mind
- Wahrnehmungsstörung
- Handlungstheoretisches Modell
- Bedeutung für den Umgang mit autistischen Kindern
- Kommunikationshilfen
- Die Rolle der Beobachtung
- Veränderungsangst
- Bedeutung des Spielens
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Besonderheiten von Autismus unter differentialätiologischer Betrachtung. Ziel ist es, die verschiedenen Ausprägungen und Ursachen dieser Störung zu beleuchten und Handlungsempfehlungen für den Umgang mit autistischen Kindern, insbesondere im Vorschulbereich, zu entwickeln.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Ausprägungen des Autismus, wie dem Kanner-Syndrom und dem Asperger-Syndrom
- Historische Entwicklung des Verständnisses von Autismus
- Diskussion der Ursachen und Unsicherheiten im Hinblick auf die Ätiologie der Störung
- Analyse psychologischer Erklärungsmodelle, insbesondere der „Theory of Mind“ nach Baron-Cohen
- Entwicklung heilpädagogischer Handlungsmuster für die Integration von Kindern mit Autismus in soziales Geschehen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik von Autismus und die Bedeutung von Aufklärung für ein besseres Verständnis und Integration von Menschen mit Autismus heraus. Das zweite Kapitel widmet sich den Definitionen und Begriffsbestimmungen von Autismus, wobei die verschiedenen Ausprägungen, wie das Kanner-Syndrom und das Asperger-Syndrom, sowie ihre Abgrenzung, diskutiert werden. Kapitel 3 befasst sich mit der historischen Entwicklung des Forschungsfeldes und der verschiedenen Ansätze zur Erforschung von Autismus.
Kapitel 4 beleuchtet die Ursachen von Autismus und zeigt die Unsicherheiten und unterschiedlichen Erklärungsmodelle auf. Kapitel 5 geht auf die „Theory of Mind“ von Baron-Cohen (1985) ein, welche wichtige Einblicke in die kognitiven Prozesse von Menschen mit Autismus liefert. Das Kapitel 6 widmet sich der Bedeutung des Umgangs mit autistischen Kindern und der Bedeutung von Kommunikationshilfen und Beobachtung für die pädagogische Praxis. Der Fokus liegt dabei auf den besonderen Bedürfnissen und Herausforderungen, die sich aus den Symptomen von Autismus ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Schwerpunkte Autismus, Kanner-Syndrom, Asperger-Syndrom, „Theory of Mind“, Kommunikationshilfen, Integration, heilpädagogische Handlungsmuster und Vorschulbereich. Die Arbeit beleuchtet sowohl die wissenschaftlichen Grundlagen als auch die praktische Umsetzung im Umgang mit Kindern, die von Autismus betroffen sind.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Kanner- und Asperger-Syndrom?
Die Arbeit vergleicht beide Syndrome als unterschiedliche Ausprägungen autistischer Störungen hinsichtlich ihrer Symptomatik und kognitiven Profile.
Was besagt die „Theory of Mind“ im Kontext von Autismus?
Nach Baron-Cohen (1985) beschreibt sie die Schwierigkeit autistischer Menschen, sich in die Gedanken und Gefühle anderer hineinzuversetzen.
Warum ist Früherkennung bei Autismus so wichtig?
Wissen über Symptommuster ermöglicht es pädagogischen Fachkräften, bereits im Vorschulbereich heilpädagogische Förderung anzubieten und die Integration zu unterstützen.
Welche Rolle spielt die „Veränderungsangst“ bei autistischen Kindern?
Die Arbeit thematisiert die Angst vor Veränderungen als zentrales Symptom und gibt Hinweise für den pädagogischen Umgang damit.
Wie können Kommunikationshilfen im Alltag unterstützen?
Sie dienen dazu, die oft eingeschränkte Fähigkeit zur sozialen Interaktion zu überbrücken und dem Kind den Kontakt zur Umwelt zu erleichtern.
- Quote paper
- Katharina Tiedeken (Author), 2004, Autismus unter differentialätiologischer Betrachtung: Erklärungsmodelle des Symptommusters 'Autistische Störung'., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34773