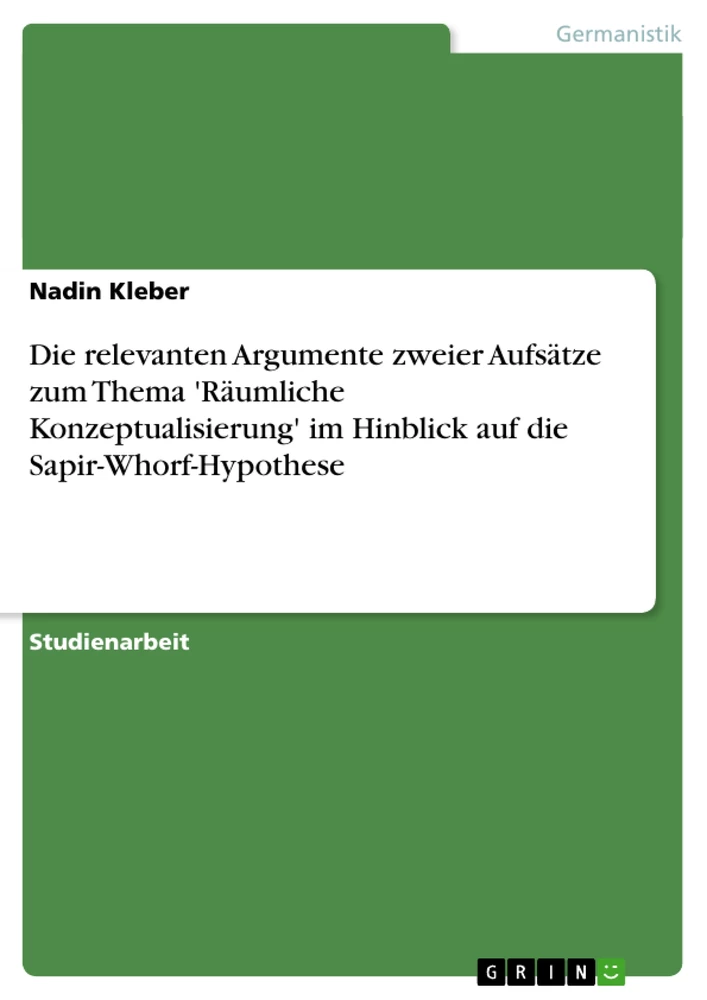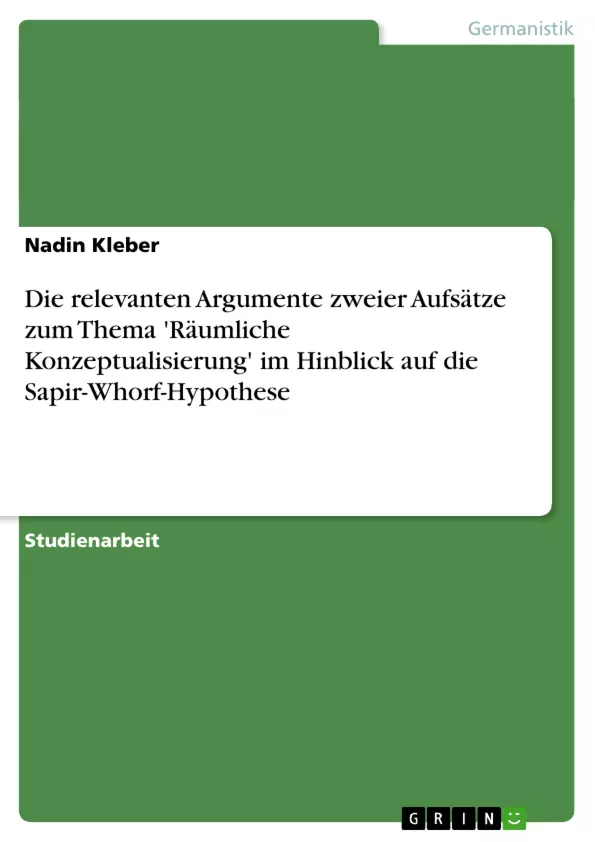Der enge Zusammenhang von Sprache und Denken wirft die Frage auf, welches von beidem zuerst vorhanden war bzw. welches der beiden Elemente sich am anderen orientiert. Geläufige Aussagen wie „Erst denken, dann sprechen“ werden häufig im Zusammenhang mit dieser Fragestellung genannt und ließen darauf schließen, dass das Denken immer zuerst kommt und so das Sprechen beeinflusst, wenn nicht gar erst möglich macht.
Schon Platon (427 - 347 v. u. Z.) sann über diese Fragestellung nach, wobei er Sprechen und Denken als identisch betrachtete, mit dem Unterschied, dass Denken im Gegensatz zur Sprache ohne lautliche Artikulation stattfinden kann. Für Wilhelm von Humboldt (1767-1835) gab es zwischen Sprache und Denken zwar auch einen engen Zusammenhang, er unterschied aber beide Komponenten, die er jedoch gleichzeitig als untrennbar voneinander bezeichnete. Die Sprache drückte seiner Ansicht nach das aus, was im Geist als Weltanschauung repräsentiert ist. Es behauptete, Sprache sei hierbei das bildende Organ der Gedanken.
Sprache und Denken haben immer einen Bezug zu der Welt, die sich dem einzelnen Individuum darbietet. Fraglich ist, ob die vorhandene Strukturiertheit durch Sprache bzw. Denken nur abgebildet wird, oder ob vielmehr die Art und Weise der Strukturiertheit erst durch Sprache und Denken so ist, wie sie ist. Whorf beispielsweise ging davon aus, dass der Vorgang der Wahrnehmung und Strukturierung ganz wesentlich durch Sprache bzw. Denken beeinflusst ist. Erst durch die sprachlich vorgegebenen Konventionen ist es einerseits möglich, die dargebotene Umwelt treffend einzuordnen und andererseits, diese durch ein mit der Gesellschaft getroffenes Abkommen, der Sprache, allgemein verständlich wiederzugeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sapir-Whorf-Hypothese
- Die Begründer
- Die Kernaussagen
- Pederson et al. 1998 ,,Semantic typology and spatial conceptualization"
- Die Versuchsanordnungen
- Das Men-and-tree game
- Die Animals-in-a-row-Aufgabe
- Die Ergebnisse
- Die Schlussfolgerungen
- Die Versuchsanordnungen
- Levinson et al. 2002 ,,Returning the tables: Language affects the spatial reasoning"
- Die Versuchsanordnungen
- Die Animals-in-a-row-Aufgabe
- Das Ententeichexperiment
- Das Motion-Maze-Task
- Die Ergebnisse
- Die Schlussfolgerungen
- Die Versuchsanordnungen
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Sapir-Whorf-Hypothese und untersucht deren Gültigkeit im Kontext der räumlichen Konzeptualisierung. Die Arbeit analysiert zwei Forschungsarbeiten, die den Zusammenhang von Sprache und Denken im Hinblick auf räumliche Wahrnehmung und Denkprozesse untersuchen.
- Die Sapir-Whorf-Hypothese und ihre Kernaussagen
- Räumliche Konzeptualisierung und der Einfluss von Sprache
- Analyse der Versuchsanordnungen und Ergebnisse der Studien
- Bewertung der Argumente für und gegen die Sapir-Whorf-Hypothese
- Diskussion des Zusammenhangs von Sprache, Denken und Wahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Frage nach dem Primat von Sprache oder Denken und beleuchtet die historischen Positionen von Platon und Wilhelm von Humboldt. Sie führt in die Sapir-Whorf-Hypothese ein und erläutert deren zentrale Aussagen. Die Arbeit untersucht dann zwei Studien von Pederson et al. (1998) und Levinson et al. (2002) zum Thema „Semantic typology and spatial conceptualization“ bzw. „Returning the tables: Language affects the spatial reasoning“.
Die beiden Studien werden im Detail hinsichtlich ihrer Versuchsanordnungen, Ergebnisse und Schlussfolgerungen dargestellt.
Kapitel 3 fokussiert auf die Studie von Pederson et al. (1998), die sich mit der Untersuchung räumlicher Konzeptualisierung in verschiedenen Sprachen beschäftigt. Die Autoren analysieren die Ergebnisse von zwei Experimenten: dem „Men-and-tree game“ und der „Animals-in-a-row-Aufgabe“.
Kapitel 4 befasst sich mit der Studie von Levinson et al. (2002), welche die Rolle von Sprache im räumlichen Denken untersucht. Die Studie präsentiert drei verschiedene Experimente: die „Animals-in-a-row-Aufgabe“, das „Ententeichexperiment“ und das „Motion-Maze-Task“.
Schlüsselwörter
Sapir-Whorf-Hypothese, räumliche Konzeptualisierung, Sprach- und Denkstruktur, linguistisches Relativitätsprinzip, Versuchsanordnung, Ergebnisse, Schlussfolgerungen, Men-and-tree game, Animals-in-a-row-Aufgabe, Ententeichexperiment, Motion-Maze-Task.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Sapir-Whorf-Hypothese?
Die Hypothese besagt, dass die Struktur einer Sprache das Denken und die Weltanschauung ihrer Sprecher beeinflusst oder sogar bestimmt (linguistisches Relativitätsprinzip).
Wie beeinflusst Sprache die räumliche Wahrnehmung?
Die Arbeit analysiert Studien, die zeigen, dass Sprecher unterschiedlicher Sprachen Räume verschieden konzeptualisieren (z. B. relativ mit „links/rechts“ vs. absolut mit „Norden/Süden“).
Was ist das „Animals-in-a-row“-Experiment?
Ein Versuch, bei dem Probanden Objekte anordnen müssen. Er zeigt, ob sie sich an ihrem eigenen Körper (relativ) oder an den Himmelsrichtungen (absolut) orientieren.
Welche Position vertrat Wilhelm von Humboldt zu diesem Thema?
Humboldt sah die Sprache als das „bildende Organ der Gedanken“ an und betonte die untrennbare Verbindung zwischen Sprache und der geistigen Weltanschauung.
Sind Sprache und Denken identisch?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Ansätze, von Platon (Denken als lautlose Sprache) bis hin zu modernen kognitiven Theorien, die Unterschiede zwischen beiden Komponenten machen.
- Quote paper
- Nadin Kleber (Author), 2005, Die relevanten Argumente zweier Aufsätze zum Thema 'Räumliche Konzeptualisierung' im Hinblick auf die Sapir-Whorf-Hypothese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34775