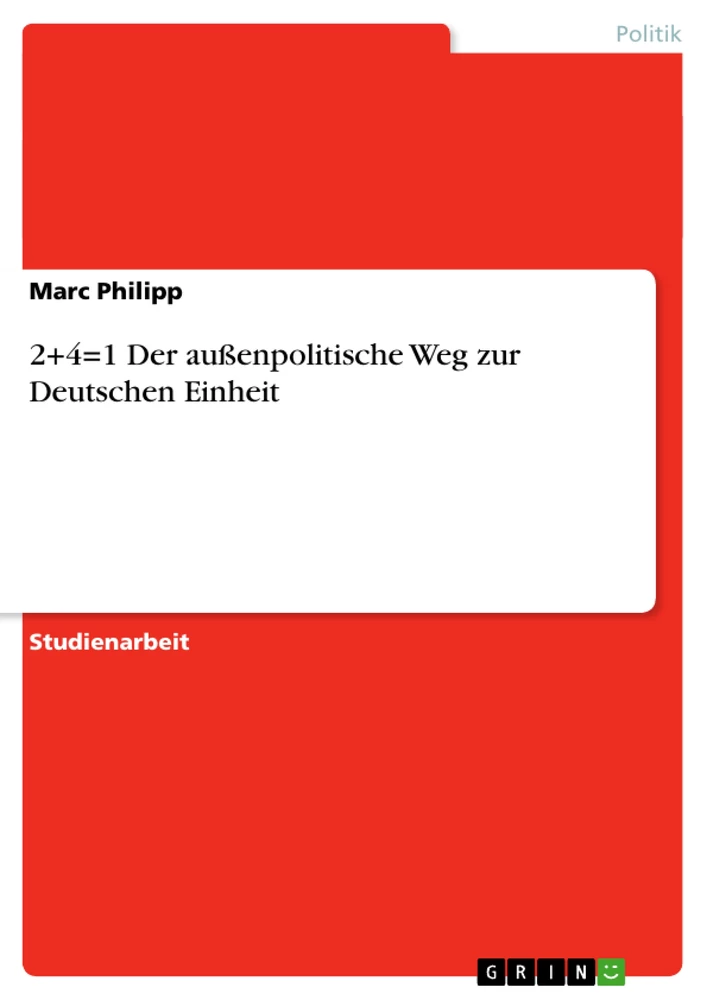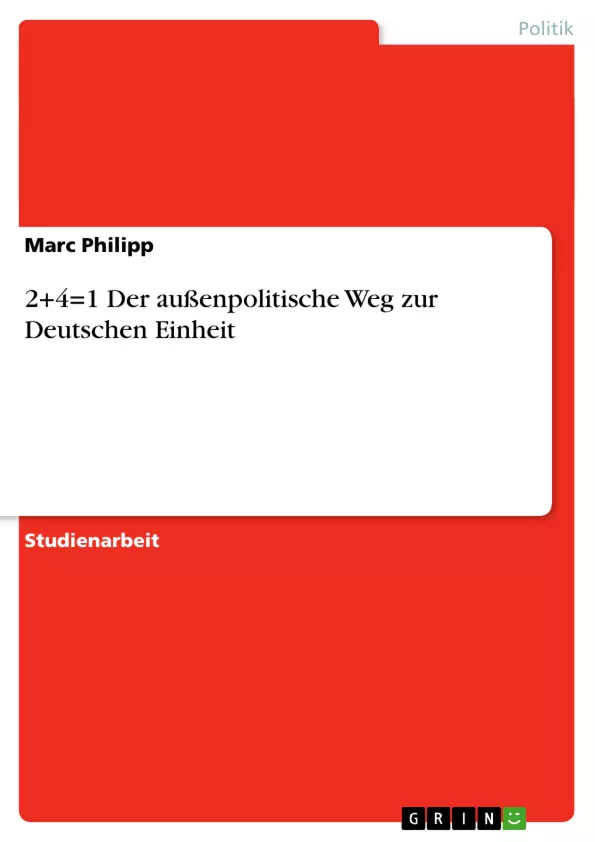1989 war eines der seltenen, geschichtlich bedeutsamen Jahre europäischer Politik, dem man ohne Übertreibung das Prädikat „epochale Wende“ verleihen kann. Mehr noch als zur Revolution von 1848, mit der die Ereignisse von 1989/90 des öfteren verglichen wurden, bestehen Parallelen zu 1789, 1918 und 1945, in denen ganze politische Systeme sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene grundlegende Veränderungen erfuhren. Denn im Gegensatz zu 1848 wurden die Menschen 1989 Zeugen einer fast gleichzeitigen, fundamentalen Machtveränderung in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, der DDR, Rumänien, Bulgarien sowie in Ansätzen bereits auch in der Sowjetunion. 1 Die Tatsache, daß im Vergleich zu den anderen Revolutionen nur die deutsche als „Frage“ tituliert worden ist, zeigt sehr deutlich, daß es sich hierbei um ein Problem besonderer Komplexität und politischer Brisanz handelt. Die Bezeichnung „Frage“ zeugt von einer tiefen Angst, einem fundamentalen Zweifel und einem schier unlösbaren Identitäts- und Strukturkomplex, der weit über das Instrumentale eines gewöhnlichen Problems hinausreicht. 2 Seit Jahrzehnten war außer Zweifel, daß der Schlüssel für eine Lösung der Deutschen Frage in der Sowjetunion lag, die einer deutschen Wiedervereinigung im Wege stand, auch wenn sie gelegentlich nicht ernsthaft gemeinte Initiativen in diese Richtung startete oder lancierte. Als dann am 9. November 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer die Deutsche Frage auf die politische Tagesordnung rückte, löste dies bei den westeuropäischen Partnern Deutschlands nicht nur Freude aus. 3 Daß Moskau dem Zerfall der DDR nicht sehr frohmütig entgegnen und sich einer Deutschen Einheit vorerst versagen würde, überraschte niemanden; die Tatsache, daß die größten Bedenken gegen die Einheit jedoch in London und Paris vorgetragen wurden, dagegen schon. Der französische Staatspräsident François Mitterand hatte bei einem Besuch in Ost-Berlin Hans Modrow zur Fortsetzung der Existenz der DDR überreden wollen, während die britische Premierministerin Margaret Thatcher von London aus ebenfalls wenig freundliche Töne von sich gab. Es ist überaus bemerkenswert, daß ausgerechnet Frankreich und Großbritannien als enge Partner Deutschlands in Europa solch eine ablehnende Haltung einnahmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Für oder gegen die Einheit? – Die Positionen der vier alliierten Siegermächte am Morgen nach dem Mauerfall
- Die sowjetischen Ahnungen
- Die amerikanischen Interessen
- Die französischen Sorgen
- Die britischen Vorbehalte
- Die strittigen Fragen der Zwei-plus-vier-Verhandlungen
- Die Frage der Bündniszugehörigkeit Gesamtdeutschlands
- Sicherheitspolitische Fragen
- Die Frage der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze
- Schlußbetrachtung
- Auswahlbibliographie
- Quellen, Memoiren, zeitgenössische Zeitungsartikel
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den außenpolitischen Weg zur Deutschen Einheit im Kontext der Ereignisse nach dem Fall der Berliner Mauer. Sie untersucht die Positionen der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs in Bezug auf die Wiedervereinigung und die Herausforderungen der Zwei-plus-vier-Verhandlungen.
- Die Positionen der vier Siegermächte (USA, UdSSR, Frankreich, Großbritannien) zur deutschen Wiedervereinigung
- Die strittigen Themen der Zwei-plus-vier-Verhandlungen
- Die Rolle der deutschen Außenpolitik im Vereinigungsprozess
- Die Bedeutung der Sicherheitspolitischen Fragen für die Einheit
- Die Frage der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den historischen Kontext und die Bedeutung der deutschen Frage nach dem Mauerfall. Sie führt den Leser in die Problematik der deutschen Wiedervereinigung ein und zeigt die komplexen politischen Herausforderungen auf. Das zweite Kapitel analysiert die Positionen der vier Siegermächte (USA, UdSSR, Frankreich, Großbritannien) zur deutschen Einheit. Es beleuchtet die unterschiedlichen Interessen und Bedenken, die die Verhandlungen prägten. Das dritte Kapitel fokussiert auf die strittigen Punkte der Zwei-plus-vier-Verhandlungen. Es beleuchtet die zentrale Frage der Bündniszugehörigkeit Gesamtdeutschlands, die Sicherheitspolitischen Fragen und die Debatte um die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze.
Schlüsselwörter
Deutsche Einheit, Zwei-plus-vier-Verhandlungen, Siegermächte, Bündniszugehörigkeit, Sicherheitspolitik, Oder-Neiße-Grenze, Außenpolitik, deutsche Geschichte, 1989/90, Mauerfall, Kalter Krieg, Wiedervereinigung.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Zwei-plus-vier-Verhandlungen?
Es waren Verhandlungen zwischen den beiden deutschen Staaten und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, um die außenpolitischen Bedingungen der Deutschen Einheit zu regeln.
Warum hatten Frankreich und Großbritannien Vorbehalte gegen die Einheit?
Es herrschte Sorge vor einem zu mächtigen Deutschland in der Mitte Europas und einer Verschiebung des geopolitischen Gleichgewichts.
Welche Rolle spielte die Sowjetunion bei der Wiedervereinigung?
Moskau hielt lange den Schlüssel zur Einheit; erst durch die Reformpolitik Gorbatschows und Verhandlungen über die Bündniszugehörigkeit wurde der Weg frei.
Was war die strittige Frage der Oder-Neiße-Grenze?
Es ging um die endgültige Anerkennung der Grenze zu Polen, was eine Voraussetzung der Alliierten und Polens für die Zustimmung zur Einheit war.
Wie wurde die Bündniszugehörigkeit des vereinten Deutschlands geregelt?
Nach intensiven Verhandlungen wurde vereinbart, dass das vereinte Deutschland Mitglied der NATO bleiben darf, was ein großer Erfolg der westlichen Diplomatie war.
- Quote paper
- Marc Philipp (Author), 2004, 2+4=1 Der außenpolitische Weg zur Deutschen Einheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34794