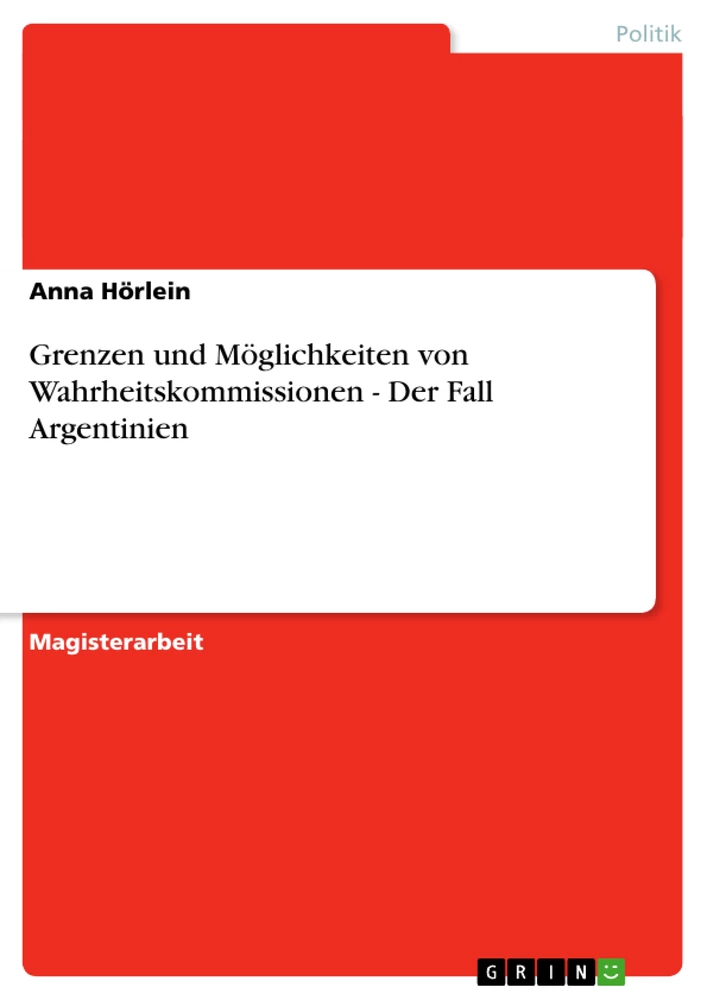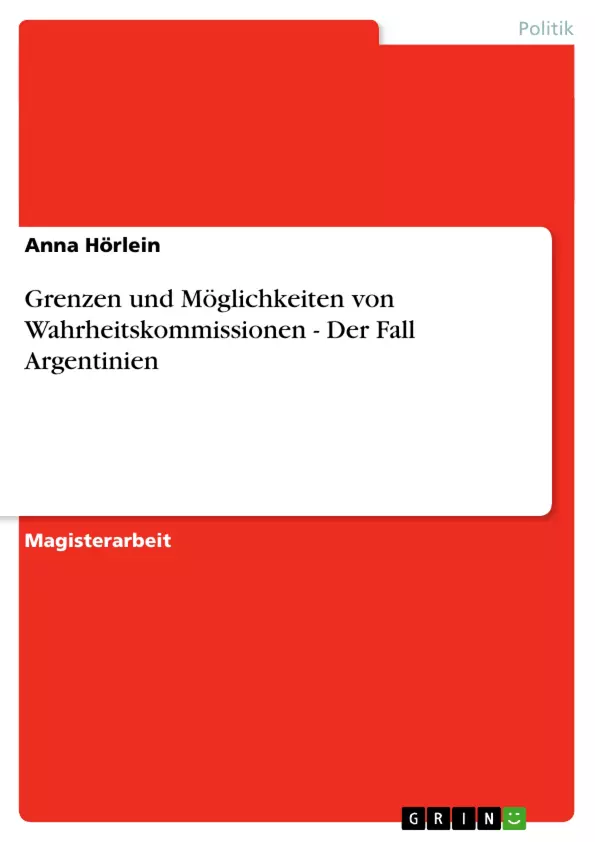[...] Im Fall Argentiniens scheiden sich die Geister bis heute über die Frage, wie stark die neue Regierung des ersten Präsidenten tatsächlich unter dem Druck der Militärs stand. Der langwierige Machtverlust der Militärs, der 1982 im Desaster des Falklandkrieges kulminierte, soll deshalb genau untersucht werden. Nach dieser Klärung der Vorbedingungen der argentinischen Wahrheitskommission, wird diese in Kapitel drei untersucht. Dazu muss in erster Linie das Design und die Arbeitsweise der Kommission betrachtet und diskutiert werden. In Hinblick auf die ideale Wahrheitskommission ist an dieser Stelle zu klären, auf welche Weise sie eingesetzt wurde, welche Zielvorgaben der Kommission mit auf den Weg gegeben wurden, wie sie konkret konzipiert wurde, wie sie praktisch arbeitete und welche Ergebnisse sie schlussendlich hervorbrachte. Abschließend wird die wichtige Frage nach den Motiven und den politischen Umstände für die Schaffung der CONADEP gestellt. Wie schon angedeutet, kann eine Wahrheitskommission immer nur der Anfang einer Vergangenheitsaufarbeitung sein. Die Arbeit der CONADEP war nach einigen Monaten 1984 beendet und verstärkte mit ihren Ergebnissen die Frage nach den nächsten Schritten, d.h. welche Maßnahmen zur Bestrafung der Täter und zur Wiedergutmachung der Opfer sollen ergriffen werden? Was soll mit dem Militärapparat passieren, inwiefern muss er reformiert werden usw.? In der nachbetrachtenden Analyse, die Inhalt des Kapitel vier sein wird, kann von einem progressiven zu einem regressiven Verlauf gesprochen werden. Was überaus hoffnungsvoll mit der CONADEP begann, wurde zunehmend durch Rückschläge getrübt. Zwar kam es in der Folge zu ernstgemeinten Bestrebungen einer wirklichen Strafverfolgung, zu einem Reparationsprogramm und zu Reformen im Militärsektor. Doch ersteres und letzteres wurden nur halbherzig durchgeführt, was wichtige Rückschlüsse für den Stand der Demokratisierung gibt. Die generelle Amnestie 1989/90 von Präsident Menem, als „Zeichen der Versöhnung“ wirft die Frage auf, ob hier nicht einfach Versöhnung von oben verordnet wurde. Ein zunächst verheißungsvoller Versuch einer konsequenten Vergangenheitsbewältigung, eingeleitet durch die CONADEP, wurde damit entgültig beerdigt. Die Implikationen, die diese Entwicklung der für die generelle Demokratisierung Argentiniens mit sich bringt, wird den Abschluss dieser Arbeit bilden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Sinn und Funktion von Wahrheitskommissionen
- 2. Die Militärdiktatur (1976-1983)
- 2.1. Totalitäres Militär
- 2.1.1. Argentinien zwischen Diktatur und Pseudodemokratie
- 2.1.2. Das Militär als „,,Retter der westlichen Zivilisation“
- 2.1.3. Das totalitäre Feindbild der Militärs
- 2.1.4. Struktur und Dimension der Repression
- 2.2. Der Weg zurück in die Kasernen
- 2.2.1. Faktoren des Wandels
- 2.2.2. Ein kontrollierter und verhandelter Übergang?
- 2.3. Zusammenfassung
- 3. Die Comesion nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)
- 3.1. Konzeption und Arbeit
- 3.1.1. Aufgabe, Befugnisse und Strukturierung
- 3.1.2. Verlauf der Untersuchungen
- 3.2. Ergebnisse und Wirkung
- 3.2.1. Der CONADEP-Bericht „Nunca Más
- 3.2.2. Es fehlen die Täter
- 3.2.3. Die Empfehlungen der CONADEP
- 3.2.4. Gesellschaftliche und politische Wirkung der CONADEP
- 3.3. Motive für die Schaffung der CONADEP
- 3.3.1. Das Schicksal der Verschwundenen
- 3.3.2. Präsidentiale Wahrheitskommission oder parlamentarisches Straftribunal
- 3.3.3. Im Spannungsfeld der Interessen
- 3.4. Zusammenfassung
- 4. Nach CONADEP – der schwierige Umgang mit der Wahrheit
- 4.1. Justiz unter realpolitischen Restriktionen
- 4.1.1. Die Vorbereitungen der Strafverfolgung
- 4.1.2. Der Junta Prozess
- 4.1.3. Sukzessive Einschränkung der Strafverfolgung
- 4.2. Der Schlussstrich Menems
- 4.2.1. Das Militär und die Demokratisierung
- 4.2.2. Amnestie per Dekret
- 4.2.3. Reparationen – ein Ersatz für Gerechtigkeit?
- 4.2.4. Vergangenheitsaufarbeitung - ein Beitrag zur Demokratisierung?
- 4.3. Zusammenfassung
- 5. Abschließende Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den Fall Argentinien und untersucht, wie Wahrheitskommissionen zur Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen während der Militärdiktatur eingesetzt wurden. Die Arbeit beleuchtet die Wirksamkeit und Grenzen dieses Instruments im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Transformation.
- Der Weg zur und die Geschichte der Militärdiktatur in Argentinien
- Die Rolle und Funktionsweise der CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas)
- Die juristische und politische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nach der CONADEP
- Die Bedeutung der Wahrheitsfindung für den Prozess der Demokratisierung
- Die Herausforderungen und Dilemmata im Umgang mit den Folgen der Militärdiktatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert das Thema und stellt die Bedeutung von Wahrheitskommissionen im Umgang mit staatlich verübten Menschenrechtsverletzungen dar. Kapitel 2 beleuchtet die argentinische Militärdiktatur in ihren wesentlichen Aspekten: Totalitäre Strukturen, Repressionsmechanismen und der Weg zurück in die Kasernen. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die CONADEP, ihrer Konzeption, Arbeitsweise und den Einfluss ihrer Ergebnisse.
Kapitel 4 analysiert die schwierige juristische und politische Aufarbeitung der Vergangenheit nach der CONADEP. Es behandelt Themen wie die Strafverfolgung, die Amnestie und die Debatte um Reparationen. Die Arbeit endet mit einer abschließenden Zusammenfassung.
Schlüsselwörter
Wahrheitskommissionen, Argentinien, Militärdiktatur, Menschenrechtsverletzungen, CONADEP, Aufarbeitung, Strafverfolgung, Amnestie, Demokratisierung, Versöhnung, Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Aufgabe der CONADEP in Argentinien?
Die CONADEP wurde gegründet, um das Schicksal der "Verschwundenen" während der Militärdiktatur (1976-1983) aufzuklären.
Was ist der Bericht "Nunca Más"?
Es ist der Abschlussbericht der CONADEP, der die grausamen Menschenrechtsverletzungen der Militärjunta dokumentiert und weltweit Beachtung fand.
Warum scheiterte die vollständige Aufarbeitung in Argentinien zunächst?
Aufgrund von Druck aus dem Militärapparat wurden Amnestiegesetze und Begnadigungen (z.B. durch Präsident Menem) erlassen, die die Strafverfolgung stoppten.
Welche Rolle spielte der Falklandkrieg für die Demokratisierung?
Das Desaster im Falklandkrieg 1982 beschleunigte den Machtverlust der Militärs und ebnete den Weg für freie Wahlen.
Können Wahrheitskommissionen Versöhnung "verordnen"?
Die Arbeit zeigt, dass eine rein staatlich verordnete Versöhnung ohne Gerechtigkeit oft als Beerdigung der Vergangenheitsbewältigung wahrgenommen wird.
- Citation du texte
- Anna Hörlein (Auteur), 2002, Grenzen und Möglichkeiten von Wahrheitskommissionen - Der Fall Argentinien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34862