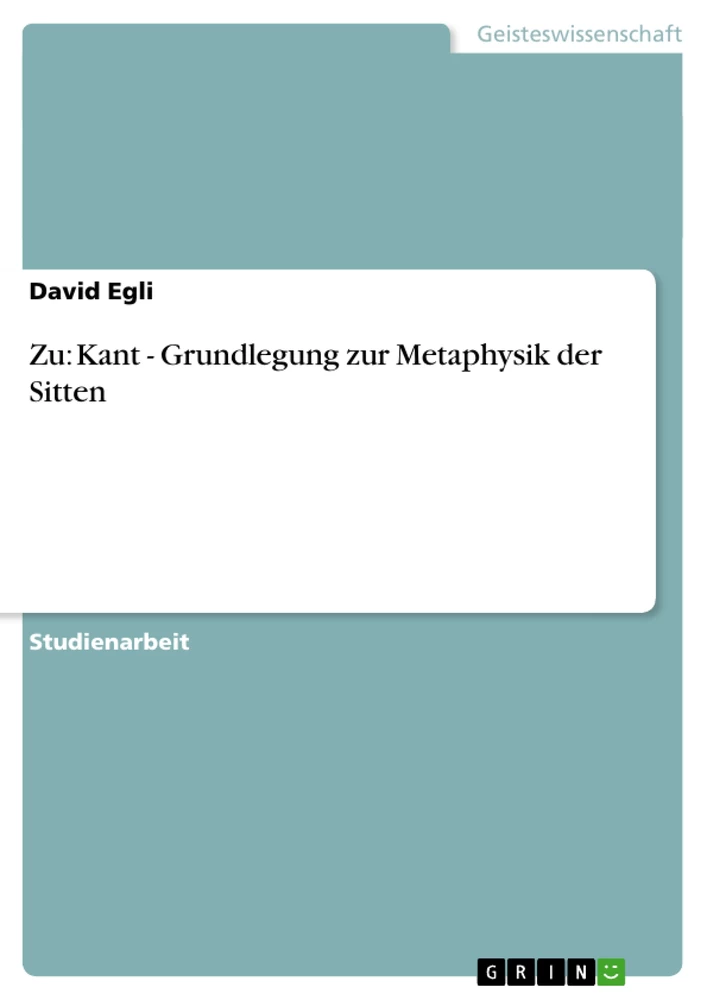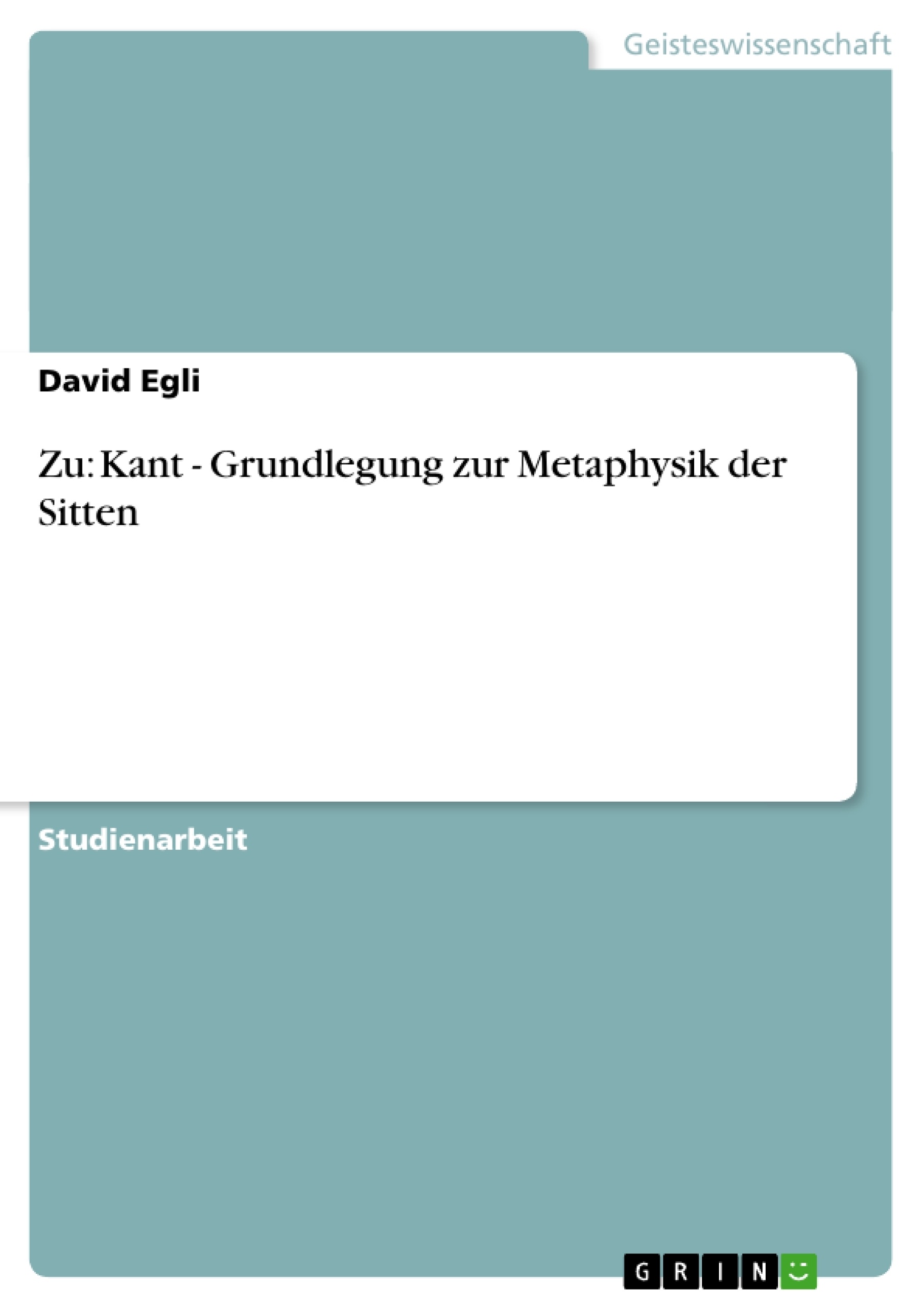Ethik beschäftigt sich mit moralischen Urteilen, also mit der Frage ob eine Handlung gut oder schlecht ist. Oder anders formuliert, ob eine gewisse Handlungsweise geboten oder verboten ist. Diesem moralischen Urteilen kommt auch in der heutigen Zeit eine enorme Bedeutung zu: Man denke nur an aktuelle Diskussionen über Folter, Asylrecht oder erleichterte Einbürgerungen. Im Zug der Aufklärung und einer zunehmenden Säkularisierung, wurde der Moral zunehmend die ‚Glaubensgrundlage’ entzogen, d.h. man konnte für seine moralischen Urteile keine religiösen Begründungen mehr verwenden.
Bei Urteilen in der Physik oder der Chemie, sprich bei der Beantwortung der Frage ‚Was ist der Fall?’, leiten wir den Wahrheitsanspruch aus der Erfahrung, d.h. empirisch her. Bei moralischen Urteilen ist dies jedoch nicht möglich, hier können wir nur subjektiv entscheiden, ob wir eine Handlungsweise für gut oder für schlecht befinden. Das sagt aber nichts darüber aus, ob die Handlung wirklich gut oder wirklich schlecht ist. Kant hat diese Problematik genau erkannt und versuchte eine Ethik zu begründen die frei von allem empirischen ist, die demnach unabhängig von aller Erfahrung gelten soll. Bereits in der ‚Vorrede’ der ‚Grundlegung zur Metaphysik der Sitten’ nimmt er eine Einteilung der Philosophie vor, die dieses Vorhaben verdeutlicht: Reine Ethik bzw. Metaphysik der Sitten ist hierbei frei von allem Empirischen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Willensbegriff
- Abgrenzung von Natur- und Glücksgaben
- Bestimmung des Willensbegriffs
- Der Pflichtbegriff
- Der erste Satz der Pflicht
- Der zweite Satz der Pflicht
- Der dritte Satz der Pflicht
- Ableitung des kategorischen Imperativs
- Bemerkungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der philosophischen Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von Immanuel Kant. Sie analysiert den 1. Abschnitt der "Grundlegung" und beleuchtet Kants Ansatz einer Ethik, die frei von allem Empirischen und unabhängig von aller Erfahrung gelten soll. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Kants Argumentation Schritt für Schritt nachzuvollziehen und vereinfacht darzustellen.
- Der gute Wille als einziges uneingeschränkt Gutes im moralischen Sinn
- Die Abgrenzung des Willens von Natur- und Glücksgaben
- Die Bedeutung des "Wollens" als Grundlage für moralische Urteile
- Die Analyse des Pflichtbegriffs und die drei Sätze der Pflicht
- Die Ableitung des kategorischen Imperativs als Begründungsgrundlage für moralische Urteile
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Ethik und die Problematik des moralischen Urteilens ein. Sie erläutert den Hintergrund der Aufklärung und der zunehmenden Säkularisierung, wodurch der Moral die Glaubensgrundlage entzogen wurde. Kant wird als ein Denker vorgestellt, der eine Ethik zu begründen suchte, die frei von allem Empirischen ist und unabhängig von aller Erfahrung gelten soll.
Der Willensbegriff
Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach dem uneingeschränkt Guten im moralischen Sinne. Kant argumentiert, dass der gute Wille der Mensch selbst das einzige uneingeschränkt Gute ist. Dazu grenzt er den Willen von Natur- und Glücksgaben ab und erklärt, warum diese nicht als uneingeschränkt gut betrachtet werden können. Im Weiteren wird der Begriff des Willens genauer bestimmt und die entscheidende Rolle des "Wollens" bei der moralischen Beurteilung hervorgehoben.
Der Pflichtbegriff
Dieses Kapitel behandelt die Frage nach dem Inhalt des guten Willens und führt den Begriff der Pflicht ein. Kant analysiert den Pflichtbegriff und präsentiert drei Sätze der Pflicht, die als Grundlagen für moralische Handlungen dienen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Ethik, wie dem guten Willen, der Pflicht, dem kategorischen Imperativ, sowie der Abgrenzung von Natur- und Glücksgaben. Im Fokus stehen die theoretischen Grundlagen der Kantschen Ethik und deren Bedeutung für das moralische Urteil. Die Arbeit untersucht auch die Verbindung zwischen dem Willen, der Pflicht und der rationalen Begründung von moralischen Urteilen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Ziel von Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“?
Kant möchte eine Ethik begründen, die frei von Erfahrung (empirischen Einflüssen) ist und rein auf der Vernunft basiert, um allgemeingültige moralische Gesetze zu finden.
Was versteht Kant unter dem „guten Willen“?
Für Kant ist der gute Wille das einzige uneingeschränkt Gute auf der Welt. Talente oder Glücksgaben sind nur dann gut, wenn der Wille, der sie gebraucht, gut ist.
Was ist der Kategorische Imperativ?
Es ist das oberste Prinzip der Moral: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“
Wie definiert Kant den Begriff der Pflicht?
Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz. Eine Handlung hat nur dann moralischen Wert, wenn sie „aus Pflicht“ und nicht nur „pflichtmäßig“ (z.B. aus Eigennutz) geschieht.
Warum lehnt Kant eine empirische Begründung der Moral ab?
Erfahrungen sind subjektiv und wechselhaft. Eine moralische Regel, die für jeden und jederzeit gelten soll, muss laut Kant a priori, also vor aller Erfahrung, in der Vernunft begründet sein.
- Citar trabajo
- B.A. Philosophie David Egli (Autor), 2004, Zu: Kant - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34956